Jimmy Spider – Folge 8
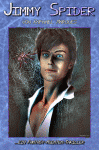 Jimmy Spider und das Schiff in den Wolken (Teil 2 von 3)
Jimmy Spider und das Schiff in den Wolken (Teil 2 von 3)
Kaum, dass mein Flieger in Rio gelandet war, hatten mich meine Kollegen zu einem Hubschrauber der TCA gebracht, der mich zu dem geheimnisumwitterten Schiff in den Wolken bringen sollte. Der Pilot, ein braun gebrannter und muskulöser Brasilianer, der ebenfalls für meine Firma tätig war, hatte mir noch einen guten Flug gewünscht, bevor er gestartet war.
Nun, das hatte er wohl nicht ohne Grund getan, denn das Fluggerät schlingerte in der Luft wie ein Lama auf Kneipentour.
Einen Blick auf den Zuckerhut hatte ich mir erspart. Von diesem hohlen Törtchen hatte ich nach meiner Begegnung mit Raymond Sterling und seinen Schoßtierchen erst mal die Nase voll. Stattdessen beobachtete ich die Wellen des Meeres und stellte mir vor, zu Hause vor meinem Kamin zu sitzen, eine Zigarre zu rauchen und einfach die Welt um mich herum zu vergessen.
Doch leider blieb es bei der Vorstellung, denn mein Pilot schien sich meine neue und sündhaft teure Wodka-Flasche aus meinem ebenso neuen Einsatzkoffer unter den Nagel gerissen zu haben. Der Alte hatte leider vor einigen Wochen mitsamt eines einsam in der Gegend herumstehenden Galgens einen wenig glorreichen Abgang hingelegt.
Ich beugte mich zu dem Piloten vor, um ihn auf seinen seltsamen Flugstil aufmerksam zu machen. »Entschuldigen Sie, aber Sie fliegen wie eine gesenkte Sau.«
Er antwortete mir in akzentfreiem Englisch. »Was, Sie sind schon blau?«
Der Mann hatte offenbar auch einen Hörschaden. »Nein, aber Sie. Und Sie bekommen gleich noch ein Auge in der passenden Farbe dazu, wenn sie nicht auf der Stelle ihren Flugstil ändern.
Augenblicklich erbleichte der Pilot, und tatsächlich wurde der Flug jetzt wesentlich ruhiger. So konnte ich mich auf den Himmel konzentrieren. Irgendwo da draußen musste sich das Schiff verstecken. Aber wenn es wirklich zwischen den Wolken segelte, konnte ich es unmöglich mit dem Hubschrauber erreichen. Folgerichtig musste ich mich überraschen lassen, ob die Schiffe nicht doch im Sommer tiefer fliegen.
Die Zeit verstrich, und ich hatte das Gefühl, dass alles im Schneckentempo verlaufen würde. Von einem Schiff war weit und breit nichts zu sehen, von Wolken gar nicht erst zu sprechen. Abgesehen von denen, die mein Pilot dank eines Zigarillos in seinem Mund ausstieß.
Ich drehte meinen Kopf nach links. Auch dort war nichts als blauer Himmel und blaues Meer zu sehen … oder nicht? Plötzlich stutzte ich. Am Horizont hatte sich tatsächlich eine Wolkenwand aufgebaut. Noch nahm sie keine große Fläche ein, aber sie schien sich langsam zu verbreitern.
Ich klopfte meinem Piloten auf die Schulter, der sofort zusammenzuckte, als würde man ihm ein Messer an die Kehle halten. Der Mann konnte offenbar nicht viel vertragen.
»Hey, hören Sie. Fliegen Sie nach Westen, auf die Wolkenwand zu!«
Der Pilot drehte sich zu mir herum und sah mich etwas verwirrt an. »Welche Wolkenwand? Sind Sie etwa auch noch benebelt?«
Langsam ging mir der Kerl auf die Nerven. »Sehen Sie doch nach links, Mann!«
Er zuckte mit den Schultern und murmelte Der spinnt doch vor sich hin, bis er plötzlich zusammenzuckte. »Heilige Maria, das gibt es noch nicht. Was zur Hölle ist das?«
Kaum dass er diese Worte ausgesprochen hatte, bekreuzigte er sich.
»Vergessen Sie es, Senõr Spider! Da bringen mich keine 10 Pferde hin.«
Solche Leute kannte ich. Wegen Typen wie ihm war meine Spesenrechnung so hoch. Wenige Sekunden später wedelte ich mit ein paar Geldscheinen vor seinem Gesicht herum. »Zehn Pferde vielleicht nicht, aber wie wäre es mit hundert Dollar?«
»Amerikanische?«
»Für Sie immer.«
Noch einmal schlug er ein Kreuzzeichen, dann nickte er mir zu. »Dieses eine Mal wird mir die Heilige Maria schon vergeben.«
Was für ein Glück für ihn.
Tatsächlich drehte er die Flugrichtung des Hubschraubers um 90 Grad und hielt auf die Wolkenfront zu, die sich mittlerweile über große Teile des Horizonts erstreckte.
Die Zeit verstrich, nur diesmal schien sie ungemein schnell zu verlaufen. Die Wolkenberge rückten immer näher, während sie eine gewaltige Größe anzunehmen schienen.
Nach einiger Zeit waren wir nur noch wenige Hundert Meter von der Front entfernt, doch der Pilot drosselte das Tempo.
Ich beugte mich zu ihm vor. »Was ist los?«
Ich sah, dass der Mann am ganzen Leib zitterte. Die Wolkenberge, die so unnatürlich in der Landschaft schwebten, schienen ihm große Angst zu bereiten.
»Ich kann das nicht. Ich kann da nicht hineinfliegen. Wissen Sie, ich habe eine Familie, drei Kinder und …«
… und den Rest seiner Rede konnte er sich sparen, denn die Wolkenbank hatte uns verschluckt. Sie musste uns entgegen gewandert sein, während wir uns unterhalten hatten.
»Tja, wir sind drin.« Mehr fiel mir in diesem Moment auch nicht ein.
»Verdammt!« Kaum hatte der Pilot das gerufen, als er sich wieder bekreuzigte.
Langsam war ich es leid. »Fuchteln Sie nicht ständig mit ihren Armen herum. Bleiben sie lieber am Steuerknüppel und fliegen Sie tiefer hinein. Drin sind wir schon mal, also ist es doch alles halb so schlimm.«
»O … okay.« Widerwillig akzeptierte der Pilot und beschleunigte das Tempo.
Mir fiel auf, dass ich seinen Namen noch nicht mal kannte. Sofort fragte ich ihn danach.
»Senõr, mein Name ist Rodrigo del Monte.«
»Aber natürlich.«
»Doch es ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wem ich diesen dämlichen Nachnamen zu verdanken habe. Aber aus der Gegend stammte er wahrscheinlich nicht.«
Weise Worte. Wie dem auch sei, ich konzentrierte mich wieder auf das, was vor uns lag – Wolken. Mittlerweile konnte man aus dem Cockpit kaum einen Meter weit sehen, so dicht war die Wand um uns herum.
Eine halbe Minute hielt dieser Zustand noch an, dann waren wir durch. Oder besser gesagt: Im Auge der Wolkenfront.
Ich war ehrlich, so etwas Kolossales hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Um den Mittelpunkt des Auges herum zogen die Wolken einen Kreis mit einem Radius von mindestens einem Kilometer. Über allem schwebte eine leichte Dunstglocke, die jedoch den Blick auf den strahlend blauen Himmel nicht verwehrte.
Doch das phänomenalste war der Mittelpunkt dieses nicht weniger phänomenalen Phänomens, der phänomenaler weise gut drei Kilometer über der Wasseroberfläche schwebte. Ein Schiff – Das Schiff in den Wolken.
Es existierte also wirklich. Ein gewaltiger Dreimaster, dessen Segel sich wie in voller Fahrt aufgebläht hatten. Das Schiff sah aus, als wäre es gerade vom Stapel gelaufen.
Ich bekam den Mund kaum mehr zu. Auch Rodrigo musste es ähnlich ergehen.
Doch ich fing mich als erster. »Fliegen Sie näher heran!«
»Ich … ich soll …«
»Tun Sie es!«
Augenblicklich gab er Gas. Das war offenbar zu viel für die Maschine, denn jetzt geriet der Hubschrauber ins Schlingern. Doch Rodrigo schaffte es, den Vogel wieder unter Kontrolle zu bringen. Etwas langsamer flogen wir dem Schiff entgegen.
Aus der Nähe betrachtet war der Anblick noch immer schier unglaublich. Der Dreimaster wäre wirklich eine Augenweide für Liebhaber historischer Schiffe.
Während ich das Deck betrachtete, fielen mir dort einige farbige Punkte auf. Als wir näher kamen, wurde mir klar, was (oder vielmehr wer) dort zu sehen war – Menschen.
Wie war das möglich? Nicht nur, dass dieses Schiff offenbar schwerelos in der Luft schwebte, es lebten auch noch Menschen auf ihm. Zumindest ging ich davon aus, dass es welche waren. Genauso gut hätten es aber auch Marsmenschen, Trolle oder Oompa-Loompas sein können.
Mittlerweile waren wir nur noch weniger als zwanzig Meter von dem Segler entfernt. Rodrigo drehte sich noch einmal zu mir herum. »Und nun?«
»Nun werden Sie mich auf dem Schiff absetzen.« Ich hatte das vollkommen locker dahin gesagt, doch wirklich wohl fühlte ich mich dabei nicht. Mich hatte schon eine gewisse Aufregung erfasst, denn so ein Phänomen war etwas ganz anderes und gewaltigeres als irgendwelche größenwahnsinnige Superschurken, goldene Kätzchen oder besessene Scheren.
Rodrigo antwortete nichts und brachte mich näher heran. Schließlich schwebten wir über der Reling, sodass ich mit einem Sprung das Deck erreichen konnte. Trotz meines mulmigen Gefühls zog ich einen Rucksack über, den man mir von der TCA für Notfälle (irgendwo darin sollte sich auch ein Fallschirm befinden) bereitgestellt hatte, griff mir meinen Einsatzkoffer und setzte zum Sprung an.
Mein Flug schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, doch schlussendlich landete ich sicher auf den Planken, rollte mich ab und drehte mich sofort wieder zu Rodrigo und dem Hubschrauber um, um dem Piloten meine Anweisungen zuzurufen. »Fliegen Sie zurück und warten Sie darauf, dass ich Sie anfunke. Dann …«
Rodrigo schüttelte den Kopf und unterbrach mich. Dann schrie er mir etwas entgegen, was mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. »Es tut mir unendlich Leid, Senõr Spider. Ich werde nicht zurückkommen. Leben Sie wohl!«
Nur Sekunden später riss er den Steuerknüppel des Hubschraubers herum und flog davon.
Ich wollte es nicht wahrhaben. »Nein! Kommen Sie zurück, Sie verfluchter Feigling!«
Es half nichts. Der Hubschrauber flog weiter der Wolkenfront entgegen und verschwand schließlich in ihr.
Jetzt war ich allein hier auf einem Schiff, das völlig grundlos in drei Kilometern Höhe über dem Wasser schwebte. Nein, Moment – da waren noch die Menschen (oder solche, die ich dafür hielt), die ich von dem Hubschrauber aus gesehen hatte.
Und ich drehte ihnen den Rücken zu. Die Erkenntnis ließ mir wieder einen Schauer über den Rücken laufen.
Langsam drehte ich mich um – und wollte meinen Augen nicht trauen.
Alle Menschen auf dem Schiff, es mussten gut dreißig Männer und Frauen sein, starrten mich an. Zumindest sahen sie auf den ersten Blick aus wie Menschen. Doch unter ihrer vollkommen normal aussehenden, wenn auch etwas mittelalterlich wirkenden Kleidung, die meist aus weißen oder mit bunten Linien versehenen Hemden, kurzen Hosen und altertümlichen Schuhen bestand, malten sich halb verweste Leiber ab. Waren das Zombies?
Ich zog meine Desert Eagle, öffnete meinen Einsatzkoffer und nahm eine Machete heraus. Sollten diese Untoten scharf auf mein Fleisch sein, würde ich sie selbst zur Schlachtbank führen.
Einige der abgehalfterten Gestalten wankten auf mich zu. Einer von ihnen zog ohne Vorwarnung einen Dolch und wollte ihn auf mich zuschleudern. Ich legte an und …
»Nein!«
Ich zuckte zusammen. Die Stimme hatte so überzeugend geklungen, dass ich meine Waffe sinken ließ, und auch das Wesen mit dem Dolch erstarrte mitten in der Bewegung.
»Auf meinem Schiff wird nicht sinnlos Blut vergossen.«
Ich drehte mich herum. Meine Augen suchten nach dem Sprecher. Als sie ihn erfassten, wollte ich meinen Augen nicht trauen. An dem Eingang zur Treppe, die ins Innere des Schiffes führte, stand eine weitere Gestalt. Doch dieser Mann war keineswegs verwest. Sein altersloses Gesicht zeigte keine Spuren von Verfall, und auch seine Hände waren völlig normal.
Der Mann, der etwa fünfzehn Meter von mir entfernt stand und den ich bisher nicht bemerkt hatte, war mindestens einen Kopf größer als ich. Sein langes schwarzes Haar lag in Wellen über seinen Schultern. Das weder dicke noch dünne Gesicht konnte man wirklich nur als alterslos bezeichnen. Es war zwar nicht mehr jung, aber auch nicht so faltenreich, dass man den Mann als alt hätte bezeichnen können. Er mochte um die dreißig sein, möglicherweise aber auch viel älter.
Ein langer schwarzer geöffneter Mantel umspielte ihn, da ein leichter Wind aufgekommen war. Darunter trug er ein in der Mitte mit weißen Wellen verziertes ebenso weißes Hemd. Eine braune Hose reichte ihm bis zu den hohen Stiefeln. An der Hüfte glänzte eine große, goldene Gürtelschnalle, die mich für einen Augenblick an das Outfit eines irischen Kobolds erinnerte.
Seine Arme hatte er ausgebreitet und streckte sie mir entgegen.
»Ich wusste, dass du kommen würdest, Jimmy Spider. Ich habe es sogar gehofft. Ich freue mich, dich auf der Cursed Virgin willkommen zu heißen.« Mit seinem rechten Arm zeigte er auf die Gestalten, die sich mir genähert hatten. »Fürchte dich nicht vor ihnen. Sie mögen zwar in deinen Augen schrecklich und Furcht einflößend aussehen, aber letztendlich haben sie genauso viel Angst wie du. Sie sind auch nur Menschen, auch wenn sie nicht so aussehen.«
Da wir offenbar schon beim freundschaftlichen Du angekommen waren, verzichtete ich auf das förmliche Siezen. »Und wer bist du? Und wer sind die anderen … Menschen auf dem Schiff?« Mir fiel es noch immer schwer, diese halb verwesten Gestalten als Menschen zu akzeptieren.
Der Mann lächelte mir entgegen. »Mein Name ist Geoffrey McShady. Kapitän Geoffrey McShady. Und die Leute um dich herum sind meine Mannschaft. Ich weiß, dass du sie nicht als Menschen akzeptieren kannst, aber sie sind es wirklich. Zwar nicht so wie du, aber dennoch Menschen. Sie müssen sich nur wieder regenerieren.«
Er gab mir einen Moment Zeit, um seine Worte auf mich wirken zu lassen.
Geoffrey McShady. McShady … McShady. Irgendwo hatte ich diesen Namen schon mal gehört. McShady … meine Güte, jetzt wusste ich es wieder, und die Erkenntnis traf mich wie ein Hammerschlag. McShady war der Mädchenname meiner Mutter gewesen.
Erinnerungen, die ich lange verdrängt hatte, stiegen wieder in mir hoch. Meine Mutter war eine so wunderbare Person gewesen, beinahe ein Engel. Zumindest für mich. Vor meiner Geburt hatte sie sich von meinem Vater getrennt und mit einem anderen Mann ihr Glück gefunden. Dieser Mann war für mich auch zu einer Vaterfigur geworden. Meine Augen glänzten, als ich an die wundervolle Zeit meiner Kindheit dachte. Wundervoll, bis eines Tages … nein, daran konnte und wollte ich nicht mehr denken. Auch die Stimme von Geoffrey McShady hielt mich davon ab. Er schien meine Gedanken gelesen zu haben.
»Ich weiß, wie dir zumute ist, und ich weiß auch von dem Schrecken, der dir widerfahren ist und den ich leider nicht verhindern konnte, aber es ist die Wahrheit. Du bist mein Nachfahre, genauer gesagt mein Urururenkel.«
Wieder lächelte er mir entgegen. Es war ein warmes Lächeln, gleichzeitig auch ein bedauerndes, welches mich trösten sollte. Irgendwie half es auch, die düsteren Gedanken aus meinem Kopf zu vertreiben.
Um mich herum kamen die Gestalten plötzlich in Bewegung. Viele beugten sich herab und legten sich nieder, andere wiederum fielen einfach um, als hätte ihnen jemand ein Brett vor den Kopf gezimmert.
Eine unnatürliche Stille breitete sich auf dem Schiff aus, die nur kurz von der Stimme meines Vorfahren unterbrochen wurde. »Sieh jetzt genau hin, Jimmy. Ihre Regeneration beginnt.«
Hunderte Fragen kreisten in meinem Kopf, während ich einem Schauspiel zusah, dass ich nie in meinem Leben vergessen würde.
Winzige Lichtfunken huschten über die Körper hinweg, ein heller Schein legte sich über die teils skelettierte Besatzung. Etwas zuckte auf ihren Körpern. Nein, zucken war das falsche Wort. Etwas wuchs. Adern, die schon lange verwest sein mussten, bildeten sich neu. Über sie legten sich Muskelstränge, Sehnen, Fleisch. Als kein blanker Knochen mehr zu sehen war, entstand auch wieder Haut, die die einstmals großen Wunden bedeckten.
Nun lagen tatsächlich normale Menschen vor mir auf den Planken. Ich sah junge und alte Gesichter, Männer und Frauen, aber keine Kinder.
Langsam kamen die Menschen wieder in Bewegung, richteten sich auf und blickten mich neugierig an. Einer von ihnen, eine etwa dreißigjährige Frau, schien all ihren Mut zusammen genommen zu haben, trat vor und sprach mich an.
»Seid Ihr es wirklich? Seid Ihr Jimmy Spider, von dem Geoffrey schon so viel erzählt hat?«
Ich wusste zunächst nicht, was ich sagen sollte und suchte nach den passenden Worten. »Ich … ja, ich bin Jimmy Spider. Und wer seid Ihr?«
Die Frau lächelte etwas verlegen. »Ich heiße Jenny … McShady. Geoffrey ist mein Ehemann. Seit mehr als dreihundert Jahren.«
Die Aussage schockte mich, obwohl ich mir etwas Ähnliches bereits nach den Ausführungen meines Urururgroßvaters (diese Tatsache allein konnte ich schon kaum fassen) hätte denken können.
Ich warf ihm einen fragenden Blick entgegen. Er nickte seiner Frau zu und wandte sich wieder an mich.
»Ich will es dir erklären, zumindest zum Teil.« Er legte eine kurze Pause ein, bevor er weitersprach. Sein Lächeln war verschwunden, dafür hatte sein Gesicht einen traurigen und leicht träumerischen Ausdruck angenommen. »Vor 304 Jahren waren meine Crew und ich auf der Magellanstraße unterwegs. Im Auftrag der britischen Krone sollten wir dort einige Erkundungen machen. Eines Tages trafen wir auf ein einsames Boot, in dem ein ohnmächtiger Mann lag. Wir nahmen ihn an Bord und pflegten ihn, doch während er an Bord war, häuften sich unerklärliche Todesfälle in unserer Mannschaft. Doch es war nicht der Mann, der für diese Zwischenfälle gesorgt hatte. Eine finstere Macht war ihm, einem Magier, auf den Fersen, und da wir dem Mann geholfen hatten, wurden wir von dieser Macht verflucht, auf ewig als Untote durch die Weltmeere zu treiben. Aber das Schicksal war uns hold. Der Mann, den wir an Bord bis zur dunklen Stunde gepflegt hatten, verschwand. Jedoch nicht, ohne sich für unsere Hilfe zu bedanken. Zwar konnte er den Fluch nicht rückgängig machen, aber er gab uns die Möglichkeit, wieder Menschen zu werden. Zusätzlich schuf er uns mit der Wolkenfront und der Flugfähigkeit unseres Schiffes einen Schutzwall vor dem Rest der Welt. Allerdings wird die Magie in den letzten Jahren immer schwächer, sodass sich die Mannschaft zwar stetig regenerieren kann, aber oft auch so aussieht, wie du sie erlebt hast.«
Ich war fasziniert von der Erklärung, und doch blieben so viele Fragen für mich offen. Wer war diese finstere Macht? Wer dieser Magier? Wieso war mein Vorfahre nicht so verwest wie seine Mannschaft? Ich gierte förmlich nach Antworten, aber wieder schien Geoffrey McShady meine Gedanken gelesen zu haben.
»Mehr kann und will ich dir nicht erzählen. Ich weiß, was passieren würde, wenn du die ganze Wahrheit erfahren würdest. So weit darf es nicht kommen. Noch nicht.«
McShady seufzte und blickte dem blauen Himmel entgegen. »Dank des Magiers sind wir zwar Gefangene geworden, und trotzdem spüren wir hier eine unbändige Freiheit.« Er schloss seine Augen und breitete die Arme aus, als wollte er sich selbst in die Lüfte erheben.
Ich trat an die Reling. Der Blick war wirklich faszinierend. Tief unter dem Schiff breitete sich das Meer aus, die Wolkenfront schien plötzlich so weit entfernt, und als ich in den wolkenfreien Himmel blickte, spürte ich auch dieses unfassbare Gefühl von Freiheit.
Eine Hand legte sich auf meine rechte Schulter. Es war Geoffrey McShady, dessen Augen mich wissend und weise anblickten.
»Ich weiß, was du jetzt empfindest. Was in den letzten Minuten auf dich eingestürmt ist, muss für dich kaum fassbar sein. Aber es ist die reine Wahrheit.«
Ich nickte nur.
»Aber all diese Erklärungen waren nicht der Grund, dessentwegen ich gehofft und schließlich auch gewusst habe, dass du kommen würdest. Es ist etwas anderes, vor dem ich dich warnen möchte.«
Plötzlich spannte sich etwas in mir an. Vor was wollte er mich warnen? Doch vor der finsteren Macht?
In dieser Sekunde wurde mir klar, dass er wirklich meine Gedanken lesen konnte. »Nein, es geht um etwas anderes. Es ist eine Gefahr, die ich vor einiger Zeit gespürt und gesehen habe. Außer dem Schiff gibt es in dieser Gegend noch etwas, was sich in einer riesigen Wolke versteckt hält. Ich kann nicht genau beschreiben, was es ist, aber es strahlt etwas Böses aus. Und ich befürchte, dass es mir bereits auf die Spur gekommen ist.«
»Wie meinst du das?«
McShady zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht genau, es ist nur so ein Gefühl. Ich …«
Ohne Ansatz schrie mein Vorfahre plötzlich auf, krümmte sich und fasste sich an sein Herz.
Ich zog ihn wieder hoch und sah ihn erschrocken an. »Was ist los?«
Geoffrey McShadys Gesicht war schmerzverzerrt. »Sie sind hier. Sie … sie sind gekommen, um uns zu vernichten!«
Wie um seine Worte noch einmal zu untermauern, gellten Schreie an Bord auf. Ein gelber Lichtfaden zischte über das Deck und traf einen Mann von der Besatzung. Schreiend ging er zu Boden. Als ich bei ihm war, sah ich mit Schrecken, dass sich in Höhe des Bauches ein gewaltiges Loch befand. Ich blickte ihm ins Gesicht und sah, dass die Augen gebrochen waren. Die Haut, die sich eben noch regeneriert hatte, blätterte wie altes Papier vom Gesicht ab. Der Rest des Körpers nahm einen grauen Farbton an, und nur Sekunden später zerfiel der Mann zu Staub.
Ich drehte mich herum und suchte nach dem Täter. Es war eine kleine silberne Maschine, die gut drei Meter über den Planken schwebte. Dieses Ding wurde von zwei Düsen an der linken und rechten Seite angetrieben. Sie waren durch kurze Flügel mit dem Mittelteil, einer fußballgroßen silbernen Kugel verbunden. Zwei Löcher befanden sich darin. In einem Loch befand sich eine Art Kamera, das andere musste den Laserstrahl verschossen haben.
Ich zog wieder meine Desert Eagle und legte auf die Killermaschine an. Mein Finger lag schon auf dem Abzug, als hinter ihm ein Dutzend weitere dieser Maschinen auftauchte. Sie hatten offenbar im Schutze der Reling auf diesen Auftritt gelauert.
Ich drückte trotzdem ab, und während meine Kugel in eine der Düsen einschlug, gingen die anderen Fluggeräte zum Angriff über.
Gnadenlos verschossen sie ihren gelblichen Strahlen auf die Besatzung, die in Panik ziellos über das Deck rannte. Direkt vor mir wurden zwei Frauen von den Strahlen getroffen und zerfielen nur Sekunden später zu Staub.
Ich konnte den Schrei nicht für mich behalten. »Neeein!«
Dann gab es für mich kein Halten mehr. Ich schoss gleich mehrfach auf die umherfliegenden Killermaschinen. Bei einer landete ich einen Glückstreffer. Die Kugel hatte offenbar direkt die Kameralinse getroffen. Einen Augenblick später explodierte das Fluggerät in einem grellen Feuerball.
Doch noch waren zwölf dieser Ungetüme übrig, die wahllos auf die Besatzung schossen und schon mindestens ein Drittel vernichtet hatten. Ich wollte nicht zulassen, dass es noch mehr wurden.
Ich verschoss den Rest meines Magazins auf eines der Fluggeräte, das versuchte, einen der Masten zu flambieren. Einige Kugeln prallten nur an der Hülle ab, aber zwei trafen die Düsen. Dunkler Rauch quoll aus ihnen hervor, während die Maschine in einem unkontrollierten Zickzackkurs gen Himmel trudelte.
Mit gewaltigen Sätzen hechtete ich zu meinem Einsatzkoffer und öffnete ihn.
Den Wodka konnte ich zurzeit nicht gebrauchen. Auch die Handgranaten waren zu gefährlich. Dafür besaß ich die Mini-Ausgabe eines Raketenwerfers. Auf Knopfdruck verschoss diese Waffe Raketen von der Größe einer Wasserflasche. Doch leider hatte ich nur vier Raketen zur Verfügung.
Während ich den Raketenwerfer lud und mir die restliche Munition in die Anzugtaschen steckte, tobte um mich herum der Kampf.
Ein älterer Mann hatte sich von irgendwo her eine altertümliche Pistole geholt und schoss auf die Flugobjekte. Zwei Schüsse gingen fehl, doch einer fand sein Ziel und sorgte für ein kleines Feuerwerk. Da waren es nur noch zehn.
Endlich hatte ich meinen Raketenwerfer fertig geladen, als mich von irgendwoher Geoffreys Warnruf erreichte. »Vorsicht Jimmy, hinter dir!«
Mit einer Blitzreaktion rollte ich mich zur Seite ab. Eines der Fluggeräte hatte mich offenbar rammen wollen und machte jetzt Bekanntschaft mit der hölzernen Reling.
Die Flugmaschine brach zwar durch das Holz, aber irgendetwas schien dabei kaputtgegangen zu sein, denn das Gerät schlingerte unaufhaltsam der Meeresoberfläche entgegen.
Ich sah mich nach weiteren Gegnern um. Sechs der Angreifer machten weiter Jagd auf die dezimierte Besatzung, aber drei von ihnen waren verschwunden. Dafür hörte ich plötzlich ein gewaltiges Bersten und Brechen.
Der hinterste der drei Masten brach zur rechten Seite weg und fiel von Bord. Offenbar hatten die verschwundenen Fluggeräte den Stamm mit ihren Lasern zersägt.
Darum konnte ich mich jedoch nicht kümmern, denn ein weiterer Angreifer sauste direkt auf mich zu. Doch ich hielt ihm den Mini-Raketenwerfer entgegen und drückte ab. Das relativ kleine Explosivgeschoss zischte dem Killerroboter entgegen, traf und sorgte wieder für Silvesterstimmung.
In der Nähe hörte ich plötzlich einen grauenvollen und markerschütternden Schrei.
Ich kreiselte herum, meine Augen weiteten sich. Ein Laserstrahl musste Jenny McShady getroffen haben, die langsam in den Armen ihres Mannes zu Staub zerfiel.
Ich sah direkt in das vor Wut, Hass und Trauer verzerrte Gesicht meines Urururgroßvaters und hatte plötzlich das Gefühl, nicht mehr denselben Mann wie noch vor wenigen Minuten zu sehen. Und doch war er es, nur konnte er seine Gefühle nicht mehr im Zaum halten.
Wie aus dem nichts geholt hielt er plötzlich ein schwarzes Gewehr in den Händen und schoss auf die umherfliegenden Maschinen. Zwei wurden getroffen und explodierten, eine weitere fiel meiner zweiten Rakete zum Opfer.
Gleichzeitig barst der zweite, der größte der drei Masten und begrub zwei noch lebende Besatzungsmitglieder unter sich, bevor er von Bord stürzte.
Geoffrey lief weiter schreiend umher und schoss, doch keine seiner Kugeln traf. Als er keine Kugeln mehr zum Nachladen hatte, warf er seine Waffe einfach weg und attackierte die Fluggeräte mit bloßen Händen. Einer der Roboter nutzt die Situation aus, schoss und traf.
Der Kapitän des Schiffes wankte, was mir einen Stich ins Herz versetzte.
Mit einer weiteren Rakete traf ich erneut ein Ziel und brachte es zur Explosion. Mein letztes Geschoss jedoch ging fehl, da das Fluggerät, das ich ganz am Anfang getroffen hatte, nur ziellos und mit einer qualmenden Düse umhersurrte.
Damit war der Kampf jedoch noch immer nicht vorbei. Die beiden letzten noch kampffähigen Angreifer versuchten, den Stamm des dritten Mastes zu zerstrahlen.
Einem warf ich meinen Raketenwerfer entgegen, doch dadurch konnte er nur abgelenkt werden.
Ich hechtete wieder zu meinem Einsatzkoffer und holte einen dunkelbraunen Beutel hervor. In ihm befanden sich kleine, schwarze Kugeln, die bei einem Zusammenprall mit einem Objekt sofort für eine kleine Explosion sorgten.
Einem der Angreifer warf ich gleich zwei Kugeln entgegen. Beide trafen, und ihre Wirkung war dieselbe wie bei den Raketen. Die Killermaschine verendete in einem grellen Feuerball, der auch das zweite Fluggerät erwischte und zur Explosion brachte.
Der letzte Mast wankte schon verdächtig, aber er hielt. Wenigstens etwas.
Doch ich hatte mich zu früh gefreut, denn noch gab es einen dieser verfluchten Roboter, und der raste ungebremst auf den Mast zu.
Zwar wurde durch den Aufprall endlich der letzte der Angreifer zerstört, aber auch dem Mast hatte der Einschlag den Rest gegeben. Er kippte zur rechten Seite weg.
Erst jetzt wurde mir das gesamte Ausmaß der Zerstörung bewusst. Von der Besatzung lebte keiner mehr. Einzig Geoffrey hielt sich verletzt oder im Todeskampf an der Reling fest. Teile der Planken waren aufgerissen oder standen in Flammen.
Ich wollte schon zu meinem Vorfahren eilen, als ein gewaltiges Stöhnen und Ächzen aufklang. Das Schiff brach nicht auseinander, wie ich zuerst befürchtet hatte. Nein, es kippte langsam nach vorne weg, der Meeresoberfläche entgegen.
Dazu viel mir nur ein Kommentar ein. »Ach du Scheiße …!«
Fortsetzung folgt …
Copyright © 2008 by Raphael Marques
Schreibe einen Kommentar