Jimmy Spider – Folge 4
Ich hasse Niederlagen, und besonders hasse ich es, wenn wahnsinnige Superschurken (diesmal samt eines süßen Kätzchens) mir vor der Nase wegfliegen. Aber irgendwie war ich mir sicher, dass ich ihn wiedersehen würde – sonst wäre er ja kein Superschurke.
Wenigstens konnte mir meine Zigarre etwas Trost spenden, als ich langsam wieder die Treppe des Geheimganges hinunterging.
Als ich wieder die große Höhle betrat, wünschte ich mir, meine Nase würde auf der Stelle abfallen. Es roch wahrlich erbärmlich. Doch ich brauchte mich nur umzusehen, um zu erkennen, was der Grund dafür war – oder besser gesagt die Gründe: die toten Monchoppies. Ihre herumliegenden Kadaver stanken schlimmer als verbrannte Bisamratten. Nun, damit sollte sich ein Entsorgungskommando der TCA auseinandersetzen, ich dagegen wollte mich schnellstmöglich entfernen.
Silvios verrosteter Kutter stand immer noch an derselben Stelle, an der ich ihn verlassen hatte. Nur von seinem Kapitän fehlte weiter jede Spur. Einzig seine Mütze hatte ich an einem für seine Gesundheit äußerst unangenehmen Ort wiedergesehen.
Nachdem ich das Schiff betreten und schließlich auch den Motor in Gang gebracht hatte, fühlte ich mich seltsamerweise an meine Kindheit erinnert. Mein Onkel, zu dem ich damals einen recht engen Kontakt hatte, war bis zu seinem Tod ein leidenschaftlicher Bootsfahrer gewesen, wohl auch deshalb, weil (wie ich erst viel später erfuhr, damals hatte er mich nur öfter auf normalen Bootsfahrten mitgenommen) er bei dem britischen Geheimdienst als Testfahrer für Schiffe eingesetzt wurde. Nun ja, bis er einmal einen neuen Schleudersitz für U-Boote ausprobieren sollte …
Aber das lag lange zurück, und mittlerweile hatte ich selbst einige Bootslehrgänge hinter mich gebracht, sodass ich den alten Kahn problemlos selbst steuern konnte.
Als ich den Ausgang der Höhle erreichte, wollte ich meinen Augen kaum trauen: Der Himmel war komplett bewölkt. Wie war das möglich? Noch vor weniger als fünfzehn Minuten war Sterling samt Katze und Hubschrauber der strahlenden Mittagssonne entgegen geflogen, ohne dass auch nur eine einzige Wolke zu sehen gewesen war.
Ein dumpfes Grollen unterbrach meine Gedankengänge. Tatsächlich, der ganze Himmel war bedeckt, sogar recht dunkel, und in meinem Nacken spürte ich einen Juckreiz. Ein untrügliches Zeichen für das, was mir bevorstand: Ich musste mich kratzen.
Erste Tropfen prasselten auf meinen dunklen Anzug. Zum Glück habe ich stets einen Spezial-Regenschirm der TCA in meiner Tasche. Er hatte die Form einer kleinen, rechteckigen Box. Nachdem ich auf einen kleinen roten Knopf gedrückt hatte, spannte sich der Schirm auf.
Der Regen wurde immer stärker, und auch Nebel kam über der See auf. Nach wenigen Minuten wurde er so dicht, dass selbst fliegende Fische die Orientierung verloren hätten.
Irgendetwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Deswegen stellte ich den Motor des alten Kutters ab. Das Getriebe jaulte noch einmal auf wie ein sterbender Kojote, dann erstarb es.
Und doch – irgendetwas tuckerte noch immer. Es musste sich also noch ein zweites Boot in der Nähe befinden.
Leider hatte Silvios Boot keine Nebelscheinwerfer. So musste ich beinahe blind der Dinge harren, die auf mich zu kamen.
Ohne Vorwarnung riss vor mir die Nebelwand auf und gab ihren Inhalt preis: ein zweites Fischerboot. Nur war dieses ungefähr doppelt so groß wie das, auf dem ich mich befand. Es gab auch einen größeren Kapitänsaufbau, doch zu sehen war dort niemand.
Erst jetzt bemerkte ich, dass das Schiff direkt auf mich zusteuerte.
Wenn mir nicht bald etwas einfiel, würde ich zu Meereshackfleisch verarbeitet werden.
Ich versuchte, den Motor wieder anzubekommen, aber es rührte sich nichts. Der Kutter hatte offenbar genug vom Leben, denn er trieb zusätzlich noch auf das sich nähernde Schiff zu.
Ich zog und entsicherte hastig meine Desert Eagle. Wenn mich der Kapitän schon nicht sehen konnte (oder wollte), konnte ich so wenigstens auf mich aufmerksam machen.
Das große Fischerboot kam immer näher, während ich für meinen ersten Warnschuss anlegte.
Als ich abdrückte, ruckelte plötzlich der Kutter, und die Kugel flog nicht gerade in die von mir gewünschte Richtung. Das Spezialgeschoss zischte direkt durch das Vorderfenster des Deckaufbaus und zerstörte es augenblicklich.
Wenn der Kapitän noch kein Motiv für seinen Konfrontationskurs gehabt hatte, jetzt hatte er eines. Und das Schiff hielt noch immer direkt auf mich zu.
Ich musste springen, um mein Leben zu retten. Oder doch nicht? Mir kam eine Idee. Ich stellte mich so weit rechts auf das Heck des Kutters, wie es nur ging.
Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber hinterher ist man bekanntlich immer klüger.
Der Kutter musste an irgendetwas unter Wasser hängen geblieben sein, dann schwenkte er auf die Breitseite und schmiss mich fast von Bord. Doch gerade so konnte ich mich an der Reling festhalten. Zumindest war ich jetzt immer noch auf der rechten Seite.
Noch wenige Sekunden, dann war es so weit. Direkt neben mir barsten die Planken auf. Das Fischerboot riss Silvios Kutter, der nun endgültig in die ewigen Fischgründe einging, in zwei Hälften. Die eine verzog sich recht schnell in den wässrigen Untergrund, die andere (und das war glücklicherweise die, auf der ich mich befand), trieb an der rechten Seite des Fischerbootes entlang.
Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich tatsächlich eine Strickleiter an dem großen Boot herunterhängen sah. War das vielleicht ein Beweis des guten Willens des Kapitäns? Ich machte mir keine weiteren Gedanken mehr darüber und kletterte einfach hoch.
Zuerst hatte ich Mühe, an der triefend nassen Leiter halt zu finden, doch schließlich schaffte ich es und kletterte über die Reling an Bord.
An Bord empfing mich der Nebel. Wenigstens war bis jetzt noch nichts von irgendwelchen verfluchten Seemännern, die sich für ihren Tod rächen wollten, oder ähnlichem Gezücht zu sehen.
Die Planken knarrten unter meinen Schuhsohlen, als ich mit gezogener Waffe das Schiff inspizierte. Langsam schlich ich auf das Kapitänshaus zu. Noch immer war niemand zu sehen. War die Besatzung verschwunden?
Plötzlich spürte ich hinter mir einen leichten Luftzug. Instinktiv zog ich meinen Kopf ein.
Etwas ungeheuer Scharfes zischte knapp an meiner glücklicherweise unversehrten Frisur vor- bei und zerschmetterte Teile des Kapitänshauses.
Mit meiner Desert Eagle in der rechten Hand drehte ich mich um. Vor dem Hintergrund eines beinahe schwarzen, durch zuckende Blitze erhellten Wolkenvorhangs sah ich die Schreckgestalt vor mir. Ein Berg von einem Menschen, etwa zwei Meter groß und vielleicht auch ebenso breit. Seinen gesamten Körper verhüllte ein dunkelblaues Regencape, und auch sein Gesicht war durch die weit nach unten hängende Kapuze nicht zu erkennen. Und obwohl ich seine Augen nicht sah, schien es mir, als würde mir aus ihnen die pure Mordlust entgegensprühen. Es konnte sich aber auch um Sprühregen handeln.
Meine Augen weiteten sich vor Schreck, als er seine Waffe, eine mächtige Machete mit einer gut einen halben Meter langen Klinge, aus dem Kapitänshaus zog und sie erneut zum Schlag erhob.
Mit einem gewaltigen Hechtsprung, der jeden Spitzensportler vor Neid hätte erblassen lassen, brachte ich mich in Sicherheit, während die Machete das Holz der Planken zum Bersten brachte.
Kaum war ich wieder auf die Füße gekommen, schritt auch schon der Machetenschwinger auf mich zu. Doch ich wollte es nicht zu einer weiteren Auseinandersetzung kommen lassen und versuchte mein Glück mit Konversation.
»Hören Sie, Mr … Fischer?«
Der Angreifer blieb tatsächlich stehen.
»Wenn es Ihnen wirklich so wichtig ist, kann ich Ihnen gerne die zerschossene Scheibe ersetzen. Ich habe eine gute Versicherung, und wenn wir erst mal die Formali…«
Irgendetwas musste ihn an meiner Rede aufgeregt haben, denn plötzlich fing er infernalisch an zu brüllen und rannte mit erhobener Machete auf mich zu.
Ich wollte mich erneut in Sicherheit bringen, doch diesmal hielt mich etwas davon ab. Ein herumliegender Rettungsring behinderte mich beim Sprung, sodass ich mehr oder weniger freiwillig den Beinen des herannahenden Fischers entgegenfiel.
Funken sprühten vor meinen Augen, als mich eine Kniescheibe des Angreifers an der Stirn traf. Wie aus weiter Ferne hörte ich wieder ein Brüllen, nur diesmal hörte es sich eher panisch an. Verschwommen sah ich, wie der Fischer wild mit den Armen rudernd der Reling entgegen trudelte. Ein Mann wie ich hätte vielleicht den Schwung noch abfangen können, doch dieser Mount Everest auf zwei Beinen war einfach zu schwer dafür. Mit seiner gesamten Masse krachte er gegen die Reling, die unter dem Druck zum Teil einbrach und mitsamt dem Fischer ins Meer stürzte.
Ich atmete tief durch. Noch immer sah ich kleine Sterne vor den Augen, aber auch die konnten mich nicht davon abhalten, eine Siegerzigarre aus meiner Manteltasche zu ziehen. Wenigstens wieder ein Erfolg, nachdem mir dieser Sterling entkommen war.
Doch kaum hatte ich die Zigarre an- und sie mir in den Mund gesteckt, wurde mir schwarz vor Augen …
Ich wusste nicht, wie lange es gedauert hatte, bis ich aus meinem unfreiwilligen Mittagsschlaf erwacht war, aber lange konnte es nicht gewesen sein, denn die Zigarre steckte immer noch in meinem Mund, war erst zur Hälfte abgebrannt und reckte sich stolz gen Himmel.
Langsam erhob ich mich wieder. Erst da merkte ich, dass ich wieder im strahlenden Sonnenschein stand. Kein einziges Wölkchen, kein Gewitter, kein Regen, kein Nebel und auch kein tollwütiger Fischer. Damit hatten sich auch etwaige Probleme mit der Versicherung geklärt …
Copyright © 2008 by Raphael Marques
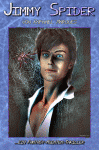
Schreibe einen Kommentar