Jimmy Spider – Folge 27
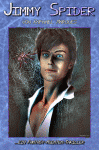 Jimmy Spider und der Horror-Zug
Jimmy Spider und der Horror-Zug
Eine Zugfahrt ist für mich immer etwas Eigenartiges. Zwar kann man sich gemütlich zurücklehnen und den Dingen seinen Lauf lassen. Andererseits bringt es mein Job aber mit sich, mit der Zeit bei solchen Fahrten etwas paranoid zu werden. Was hatte man nicht schon alles Grausiges über diese fahrenden Ungeheuer gehört? Höllenzüge, Horrorzüge, Mörderzüge, Zugmörder, Horrorzüge, Geisterzüge, Terrorzüge, Todeszüge, Horrorzüge und weitere schauerliche Begriffe schossen mir da durch den Kopf. Nicht zu vergessen: Horrorzüge. Zwar war ich bisher noch nicht an einen in die Unterwelt rauschenden Geisterzug geraten oder in eine von Terroristen initiierte Zugentführung, deren Ziel es ist, die Welt mittels eines laserverschießenden Satelliten in die Knie zu zwingen, aber das konnte ja noch werden.
Manchmal kommt man aber nicht umhin, sich doch seiner Paranoia zu stellen und den öffentlichen Verkehrsmitteln im direkten Duell gegenüberzustehen.
Da ich kein eigenes Auto besaß und der Dienstwagen nur zu dienstlichen Zwecken eingesetzt werden durfte (und Glenrothes leider keinen Flughafen sein Eigen nannte), musste ich also auf den guten alten Zug zurückgreifen. Ein lieber Verwandter, mein Großonkel Montgomery Spider, von dem ich bis zu seiner Todesnachricht übrigens noch nie im Leben etwas gehört hatte (wahrscheinlich auch, weil ich mit der Familie meines leiblichen Vaters wenig bis gar nichts am Hut hatte), war bei einem bedauerlichen Unfall, bei dem eine Flasche Whisky und eine Wendeltreppe nicht unwesentliche Rollen gespielt hatten, dahingeschieden.
Jedenfalls war ich zu der Beerdigung eingeladen worden, und da sich mein Vater glücklicherweise weit weg befand (gerüchteweise hielt er sich in Indien auf, um dabei zu helfen, nach flüchtigen Helfern von Vijay Brahma Singh, seinem letzten großen Coup, zu fahnden), sprach eigentlich nichts dagegen, dort auch mal vorbeizuschauen. Nicht, dass ich wirklich um meinen Großonkel trauern wollte oder musste, aber ein wenig interessierte mich schon, wie so meine weitere Verwandtschaft aussah. Denn außer meiner Ex-Frau und meiner Tochter, die ich so gut wie nie sah, war mit Ausnahme meines mehr oder weniger verschiedenen Urahnen Geoffrey McShady von meinem Standpunkt aus keine Familie vorhanden.
Um zu verhindern, dass ich mich einer Whiskyorgie hingeben musste (in Glenrothes, so hatte ich gelesen, schien es außer diesem hochprozentigen Getränk keine weitere flüssige Nahrung zu geben), hatte ich mir vorsorglich noch meinen Einsatzkoffer, der gut und gerne auch als Reisegepäck durchgehen konnte, mitsamt der darin enthaltenen Wodkaflasche mitgenommen.
Ich befand mich beinahe allein in meinem Abteil. Nur eine attraktive blondhaarige Frau und ein etwas zerlumpter älterer Herr waren mir bisher aufgefallen. Letzterer sandte einen Geruch aus, als hätte er die letzten zwei Wochen neben einer toten Katze geschlafen.
Es war mittlerweile kurz vor Mitternacht. Wenn ich einen Blick nach draußen warf, bekam ich nur eine undurchdringliche Schwärze zu sehen, selten unterbrochen von ein paar Signalleuchten. Die Lichter entfernter Dörfer waren nicht erkennbar. Es schien, als wäre der Zug eine Welt für sich und alles außerhalb der Kabinen weit entfernt.
In meinem Job kam es selten vor, dass man sich einfach zurücklehnen und seine Gedanken auf Reisen schicken konnte. In diesem Fall war es mir möglich und so ließ ich meine letzten Erlebnisse Revue passieren: Untote Magier, rächende Magier, uralte Magier und verschiedene weitere Magier-Variationen kamen mir da in den Sinn. Daneben natürlich mysteriöse Sammler, codierte Briefe und das geheimnisvolle House B der TCA.
Meine Gedankengänge wurden jäh unterbrochen, als vom Eingang des Waggons ein Geräusch erklang. Jemand hatte die Tür geöffnet. Neugierig lugte ich über einige Sitze hinweg, konnte aber außer dem blonden Haarschopf meiner Mitfahrerin nichts erkennen.
»Fahrkarten, bitte!«, erklang es aus dem Mittelgang.
Das Gesetz schläft nie, dachte ich mir. Aber scheinbar war es in diesem Fall unsichtbar, denn von einem Schaffner bekam ich nichts zu sehen, obwohl ich mich aufgerichtet hatte.
Da ich nichts sah, versuchte ich mich auf mein Gehör zu konzentrieren. Und tatsächlich, ein leises Tapsen drang an meine Ohren. Als wäre ein Hund auf leisen Sohlen unterwegs in den Speisewaggon.
Beschäftigte die Zuggesellschaft neuerdings etwa auch Hunde als Schaffner? Nun gut, von Geldsorgen hörte man ja immer wieder, aber das Risiko, dass die Fellknäuel die Fahrkarten nicht nur kontrollierten, sondern gleich verspeisten, erschien mir für eine Vollzeitbeschäftigung doch zu hoch.
Plötzlich schrie jemand heftig auf. Es war die blonde Frau, die einige Reihen vor mir saß. Entweder hatte sie gerade gemerkt, dass sie gar keinen Fahrschein besaß, oder sie hatte eine schreckliche Entdeckung gemacht. Ich tippte eher auf Letzteres.
Sofort sprang ich auf, lief in den Gang hinein – und entdeckte den Schaffner (oder zumindest etwas, das entfernt nach einem Schaffner aussah). Offensichtlich beschäftigte die Zuggesellschaft doch keine sprechenden Hunde. Dafür aber alte Bekannte von mir: Kobolde!
Schon zwei Mal waren mir in Schottland diese unfreundlichen Gesellen begegnet. Beim ersten Aufeinandertreffen wäre ich beinahe von einem eher klischeehaften, weil reimenden und einen Topf voll Gold am Ende eines Regenbogens bewachenden Vertreter dieser Gattung ins Jenseits befördert worden. Einige Zeit später hatte in der Nähe von Glasgow ein weiterer Kobold versucht, seinen Artgenossen zu rächen, was für ihn allerdings ein explosives Ende genommen hatte.
Und nun stand ich wieder vor einer dieser Gestalten. Dies erkannte ich jedoch nur an der Größe und der runzligen, rot-braunen Haut, denn der Kobold trug die Miniaturausführung einer altertümlichen Schaffneruniform, sogar samt Hut. Zusätzlich hatte er eine übergroße Sonnenbrille über seine Augen gezogen.
»Mr Spider, nehme ich an?«, fragte mich der kleine Wicht in einer Tonlage, die genauso gut auch zu Rumpelstilzchen aus Grimms Märchen gepasst hätte.
Offensichtlich war ich mittlerweile in Koboldkreisen zu einer kleinen Berühmtheit aufgestiegen, wobei ich mir nicht sicher war, ob ich das eher als Ehre oder als Fluch betrachten sollte. Wie auch immer, ich antwortete ihm in aller Freundlichkeit. »Sehr richtig. Und mit wem habe ich die Ehre?«
Er kicherte zunächst nur, dann aber brachte er doch noch ein paar Worte hervor. »Man nennt mich Afifi.« Offensichtlich erwartete er ein brüllendes Lachen meinerseits, doch er erntete nur betretenes Schweigen. Stattdessen gab er sich doch die Blöße und sprach nach einem kurzen Moment der Ruhe weiter. »Nun ist der Moment der Rache gekommen. Zwei von uns hast du bereits ermordet und darauf steht keine andere Strafe als der Tod. Dieser Zug ist in unserer Gewalt. Wenn du dich freiwillig ergibst, wird niemandem etwas passieren.«
»Außer mir, nehme ich an.«
Damit hatte ich den Kobold wohl aus dem Konzept gebracht. »Ähm, ja …«, stammelte er. »Natürlich, außer dir.«
Das waren ja tolle Aussichten, die sich da plötzlich ergeben hatten. Ein normaler selbstloser Bürger würde an meiner Stelle sich vielleicht in sein Schicksal ergeben. Aber ich war schon mit weit größeren Gefahren fertig geworden, als einem Zug voller Kobolde. Blutrünstige Monchoppies, irre Serienkiller, riesige Seemonster und eine Bande schießwütiger Wildwest-Banditen standen da ganz oben auf meiner Liste. Und außerdem, wer konnte sich schon auf das Wort eines Kobolds verlassen? Vielleicht würde die Bande nach meinem (mutmaßlich äußerst schmerzhaften) Tod trotzdem über die Insassen des Zuges herfallen. Obwohl mir bei dem nach toten Katzen duftenden Kerl ernste Zweifel kamen, ob sich die grünen Gestalten wirklich für diese Geschmacksrichtung interessierten.
»Und, wie hast du dich entschieden?«, fragte Afifi grinsend.
Ich gab ihm die Antwort auf meine Weise. Mit einer routinierten Bewegung zog ich meine Desert Eagle aus meinem Jackett hervor. Doch noch bevor ich auf ihn anlegen konnte, sprang mir der Kobold mit einem wilden Schrei entgegen. Dabei zog er blitzschnell ein kleines aber feines Messer.
Ebenso blitzschnell packte ich mit meiner freien linken Hand die Kreatur an ihrer Uniform und schleuderte sie über mich hinweg. Mit dem Kopf voraus prallte sie auf den Boden und richtete sich leicht benommen auf.
Die Zeit nutzte ich, um meine Waffe zu entsichern.
Der Kobold knurrte wütend und stürzte sich mir wieder entgegen. Doch diesmal hielt ich ihm meine Desert Eagle entgegen und schoss. Das Spezialprojektil fuhr ihm direkt in die Stirn.
Der kleine Wicht stolperte mir noch einige Schritte entgegen, brach dann aber, ohne ein weiteres Wort von sich zu geben, zusammen.
Nach wenigen Sekunden begann das Wesen sich aufzulösen. Der Inhalt der Uniform dünnte zunächst aus, doch plötzlich wurde auch die Kleidung selbst zerstört. Der vernichtete Körper des Kobolds wirkte in seinem flüssigen Stadium wie eine Säure. Das Gebräu brannte sich förmlich durch den Boden des Waggons, bis nur noch eine ovale Öffnung zu sehen war, durch die man auf oder besser gesagt zwischen die Gleise blicken konnte. Zum Glück breitete sich das Loch aber nicht weiter aus.
»Was … was war … denn das?«, stammelte die Frau, die von ihrem Platz den gesamten Vorgang mit angesehen hatte.
»Ein Kobold.«
Nun mischte sich auch der Tote-Katzen-Freund ein. »Hihi, kleine grüne Männchen in meinem Zug. Dass ich das noch erleben darf. Dabei hab ich noch gar keine zwei Flaschen heute getrunken«, nuschelte er vor sich hin. Offensichtlich hatte er schon vor dem Einsteigen eine längere Unterhaltung mit seinem Vetter Al Cohol gehabt.
Ich reagierte gar nicht auf seine Ursachen-Deutung und wandte mich wieder der Frau zu, die offensichtlich unter Schock stand – ob nun durch meine Erscheinung oder die Vernichtung des Kobolds, ließ ich mal dahingestellt. »Beruhigen Sie sich, Miss! Es ist alles in Ordnung.«
Damit konnte sie sich wohl nicht so ganz abfinden. »A … a … aber d … der Schaffner, der hat sich ver…verflüssigt.« Nach dieser tief greifenden Feststellung gab sie noch ein kurzes Kichern ab, das aber wohl eher von ihrem Schrecken als der Belustigung durch die letzten Ereignisse stammte.
Irgendwie musste ich die Frau wieder beruhigen und da fiel mir nur eine Möglichkeit ein: mein Wodka! Nicht, dass ich mein Lieblingsgetränk gerne wildfremden Menschen andrehe (zum Beispiel sicher nicht Mister Ich-hab-kleine-grüne-Männchen-gesehen, damit er seine Tagesration doch noch erreicht), aber in diesem Fall erschien es mir als die einzige Lösung.
Ich öffnete meinen Einsatzkoffer, zog die Flasche hervor und reichte sie der blondhaarigen Frau. »Hier, trinken Sie!«
Zögernd griff sie zu. »Das … das ist doch nicht etwa Wodka, oder?«
»Nein, russisches Felsquellwasser. Und nun trinken Sie, es wird Ihnen gut tun!«
Tatsächlich kam sie nun meiner Anweisung nach und nahm zwei große Schlucke, die sie ohne Husten oder ähnlichen Reaktionen überstand. Danach nahm ich ihr die Flasche wieder ab und legte sie zurück in den Koffer.
Der Alkohol verfehlte seine Wirkung nicht. Die Frau beruhigte sich tatsächlich. Mit einem leisen »Danke« gab sie mir zu verstehen, dass sie letztendlich die Notwendigkeit meines Nachdruckes eingesehen hatte.
Mit einem kurzen Winken verabschiedete ich mich von ihr, griff meinen Koffer und machte mich auf den Weg in die vor uns liegenden Abteile. Meine Desert Eagle hielt ich dabei weiter in der rechten Hand. Man konnte ja schließlich nie wissen, wann der nächste Kobold sein Versteck verlassen würde.
Ich stellte kurz den Koffer ab, bevor ich mit der nun freien Hand die Abteiltür öffnete. Danach nahm ich den Koffer wieder an mich.
Ein Blick durch das Türfenster in das nächste Abteil zeigte mir, dass sich im Gang zumindest niemand aufhielt. Wieder öffnete ich eine Tür, um den nächsten Waggon zu betreten.
Die Stille, die mich empfing, war geradezu bedrückend. Kein Atmen, kein Räuspern, nicht einmal ein Knacken war zu hören. Ein Friedhof auf Schienen geradezu.
Dabei sah ich, dass einige Leute in diesem Abteil saßen. Zumindest drei Köpfe zählte ich. Alle Personen saßen starr auf ihren Plätzen und gaben durch nichts zu verstehen, dass sie mich in irgendeiner Weise registriert hatten.
Vorsichtig ging ich weiter durch den Mittelgang. Wenig später erreichte ich den ersten Fahrgast. Als ich ihn mir näher ansehen wollte, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Jemand hatte dem Mann die Kehle durchgeschnitten.
Vom Alter her schätzte ich ihn auf etwa sechzig Jahre. Seine Haare und sein Vollbart waren bereits ergraut, im Gegensatz zu seinem Anzug, der in einem satten Schwarz strahlte.
Die Kobolde hatten also Afifis Drohung wahr gemacht. Aber von ihnen selbst sah ich nichts. Entweder hatten sie sich in die weiter vorne gelegenen Waggons zurückgezogen, oder der eine oder andere hielt sich noch zwischen den Sitzen versteckt.
Ich setzte meine Suche fort – und wurde fündig. Nur anders, als ich erwartet hatte. Ein Sitz auf der rechten Seite sah aus, als hätte sich eine Horde Termiten daran gütlich getan. An den grün-braunen Resten, die noch an den Rändern des Lochs klebten, erkannte ich aber, dass das einmal ein Kobold gewesen war. Aber wer hatte ihn vernichtet?
Plötzlich erklang hinter mir eine mir fremde Stimme. »Ich denke, Sie haben mir einiges zu erklären, Mr Spider.«
Die Desert Eagle immer noch erhoben, drehte ich mich um. Vor dem letzten Sitz auf der rechten Seite hatte sich ein Mann erhoben. Er hatte dunkles, volles Haar und trug einen dichten, schwarzen Vollbart. Bekleidet war er, soweit ich das erkennen konnte, mit einem braunen Ledermantel. Dazu trug er schwarze Handschuhe.
Offenbar war ich meinem Gegenüber nicht unbekannt. Dafür hatte ich ihn noch nie zuvor gesehen.
»Ich sehe, Sie grübeln noch etwas über mich«, sprach er mit ernster Stimme. »Aber machen Sie sich keine Hoffnungen. Ich werde Ihnen nicht verraten, wer ich bin und woher ich Sie kenne. Nur eines ist wichtig: Lebendig aus diesem Zug hinauszukommen. Und das werde ich ohne Ihre Hilfe wohl nicht schaffen. Leider.«
»Ich nehme gerne jede Hilfe an, die ich kriegen kann. Aber eine gewisse Neugier können Sie mir nicht verbieten.«
»Damit müssen Sie dann leben.« Er hob seinen linken Arm leicht an, sodass ich einen Blick auf die mit einem Schalldämpfer bestückte Pistole in seiner Hand werfen konnte. »Wie schon gesagt, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Was haben diese grünhäutigen Gestalten hier zu bedeuten?«
»Wenn Sie mir schon nichts über sich verraten, warum sollte ich Ihnen dann die Zusammenhänge hier erklären?«, fragte ich abweisend.
»Nun, entweder kommen wir hier gemeinsam wieder heraus, oder gar nicht. Und da wäre es wirklich hilfreich, wenn ich wüsste, worum es hier geht.«
Einerseits traute ich diesem Kerl nicht über den Weg, aber andererseits wusste ich auch nicht, wie viele Kobolde diesen Zug besetzt hielten. Meine Munition würde sicher nicht für eine ganze Armee reichen. Da wäre es hilfreich, noch einen bewaffneten Verbündeten zu besitzen. Wobei Verbündeter in diesem Fall wohl eher Waffenbruder bedeuten würde. Schließlich entschloss ich mich doch, ihm zumindest grob die Situation zu erklären. »Einige Kobolde – ich weiß nicht, wie viele – die sich an mir rächen wollen, haben den Zug besetzt. Sie drohen, alle Fahrgäste zu töten, wenn ich mich nicht ergebe, was meinen sicheren Tod bedeuten würde. Und wahrscheinlich auch den der restlichen Fahrgäste.«
Der Mann nickte. »Schön, dass wir das geklärt haben.« Er trat in den Gang hinein. »Dann sollten wir dieser Brut mal einheizen.«
Viel anderes blieb uns auch nicht übrig, aber das sprach ich nicht aus. »Wie darf ich Sie eigentlich nennen, Mister?«, fragte ich stattdessen.
»John.«
»Und Smith mit Nachnamen?«
»Schön, dass wir uns verstehen«, antwortete er mit ernster Miene. Offensichtlich lächelte mein neuer Freund nicht allzu oft. Oder er hatte gerade einen miesepetrigen Tag erwischt.
Ich wandte mich wieder um und blickte auf die Sitzreihen. Zwei Köpfe sah ich, aber keine der zu ihnen gehörenden Personen gab einen Laut ab. Ich befürchtete, dass auch für diese Fahrgäste jede Hilfe zu spät kam.
Um etwas mehr darüber zu erfahren, was hier geschehen war, fragte ich Selbiges meinen neuen Begleiter.
»Ich hatte für eine Weile die Augen geschlossen. Plötzlich hörte ich ein Geräusch, dann ging alles sehr schnell. Plötzlich erschien einer dieser Kobolde, sprang hoch und zerschnitt dem alten Mann die Kehle. Dann wechselte er die Sitzreihe und visierte mich an, aber ich kam ihm zuvor. Kurz darauf sind Sie gekommen.«
»Was mit den beiden da vorne passiert ist, wissen Sie also nicht?«
»Nein, Mr. Spider.«
Es interessierte mich wirklich brennend, woher dieser John meinen Namen kannte. Aber mit jeder weiteren dahingehenden Frage würde ich nur auf Granit beißen.
Stattdessen ging ich vor, den beiden mutmaßlich toten Fahrgästen entgegen. Je näher ich ihnen kam, desto merkwürdiger erschienen sie mir. Beide hatten schwarze, ungekämmte Haare und recht kleine Köpfe. Für Kinder waren sie aber zu groß. Waren das etwa …?
Ich konnte den Gedanken nicht zu Ende führen, denn plötzlich sprangen beide Fahrgäste fast gleichzeitig auf und wandten sich um. Es waren Kobolde!
Ich konnte meinen Pistolenarm gar nicht so schnell heben, wie mir die kleinen Wichte entgegenflogen. Einer von ihnen traf mich so wuchtig an der Brust, dass ich zu Boden geschleudert wurde.
»Jetzt bist du fällig!«, schrie er, einen kleinen Dolch erhoben.
Aber noch bevor er zustoßen konnte, hatte ich meine Desert Eagle erhoben und gegen sein linkes Ohr gelegt. Augenblicklich drückte ich ab.
Der kleine Kopf schien förmlich zu zerspringen. Bevor der Körper sich auflösen und mir ein hübsches Loch in der Brust verpassen konnte, stieß ich ihn mit meiner linken Hand von mir herunter.
Über mich zischten zwei Kugeln hinweg. Ihr Ziel war der zweite Kobold. Die Geschosse trafen ihn mitten im Sprung.
Auch dieser Körper hatte offensichtlich vor, sich auf meiner Brust aufzulösen. Gerade noch rechtzeitig erhob ich mein rechtes Bein und trat den heranfliegenden Kobold einfach weg. Er landete mitten im Gang, zuckte noch kurz und begann schließlich zu vergehen.
Während ich mich erhob, erhielt der Waggonboden ein hübsches Guckloch.
Ich warf meinem Begleiter einen kurzen Blick zu. Er nickte mir zu, um zu signalisieren, dass er bereit war.
Die Waffe im Anschlag und den Einsatzkoffer in der linken Hand haltend setzte ich meinen Gang fort. Nichts regte sich, nur der Zug fuhr unermüdlich weiter. Automatisch fragte ich mich, wer ihn wohl lenkte. Vielleicht war der Lokführer bisher von den Angriffen der Kobolde verschont geblieben, vielleicht aber auch schon tot. Und wenn die Kobolde keinen Lokführer in ihren Reihen hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir mit einem anderen Zug kollidierten.
Diesen Gedanken verdrängte ich schnell, denn auch so schon ging es hier um das nackte Überleben.
Mittlerweile hatten wir die Plätze, an dem die beiden Kobolde gesessen hatten, fast erreicht. Alles schien friedlich, doch plötzlich waren sie wieder da.
Zwei weitere dieser grünen Wichte hatten sich an denselben Plätzen wie ihre Artgenossen versteckt gehalten. Einer sprang mir entgegen, der zweite nahm sich John vor.
Der Kobold hielt eine Sichel in der Hand und schlug damit zu. Die Klinge schnitt in meinen Oberschenkel wie in warme Butter. Ich verkniff mir einen Schmerzensschrei und schoss. Die Spezialkugel bohrte sich mitten in die Stirn und sorgte für die Vernichtung dieses Wesens.
Der zweite Kobold aber wehrte sich noch immer. Mein Begleiter hatte ihn gepackt und schleuderte ihn gegen ein Fenster. Die Scheibe erhielt ein paar Risse, brach aber nicht.
Dafür warf sich die kleine Kreatur uns erneut entgegen. Beinahe gleichzeitig drückten wir ab. Beide Geschosse trafen sie in die Brust und sorgten dafür, dass sie zusammenbrach. Wieder einer weniger.
»Langsam werden diese Biester lästig«, murmelte John Smith.
Ich ging nicht näher darauf ein und blickte stattdessen auf meine Wunde. Die Klinge war zum Glück nicht tief eingedrungen, aber Blut strömte dennoch hervor.
»Sind Sie verletzt, Mr Spider?«
»Halb so wild«, versetzte ich. Tatsächlich behinderte mich die Wunde kaum. Außer dass meine teure Hose einen leicht roten Teint erhielt.
»Wie viele Waggons hat dieser Zug eigentlich?«, fragte ich meinen Begleiter.
»Vier, glaube ich.«
»Dann haben wir zumindest die Hälfte des Zuges gesäubert.«
Mein Begleiter grinste. »Und was erwarten Sie noch?«
Ich grinste nicht zurück. »Ich rechne mit allem.«
Wie um meine Aussage zu bestätigen, erklang von irgendwoher plötzlich ein leises Wispern.
»Hören Sie das auch?«, fragte ich meinen neuen Freund.
»Was?«
Ich winkte ab.
Das Wispern verstärkte sich. Es schien erst einmal aus einer weit entfernten Sphäre zu mir vordringen zu müssen. Aber das Wispern gab es scheinbar nur in meinem Kopf.
Plötzlich war die Stimme da. In ihr lag ein Hauch Weiblichkeit. »Jimmy Spider – Jimmy Spider …«
»Falsch verbunden«, antwortete ich.
John Smith sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Ich konnte es ihm nachfühlen, durfte aber jetzt auf meinen guten Ruf keine Rücksicht nehmen.
»Man nennt mich Matra«, erklang die Stimme wieder.
»Aha.«
»Ich bin Matra, die Königin der Kobolde. Höre mir zu, höre mir gut zu.«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Wer meine Kinder tötet, tötet einen Teil von mir. Und wer einen Teil von mir tötet, ist des Todes. Alles, was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorspiel dessen gewesen, was noch folgt. Begib dich in den vordersten Waggon und stelle dich deinem Schicksal … Schicksal … Schicksal …« Das Echo der Stimme hallte mir noch einige Male entgegen, dann war die Leitung tot.
»Was war denn das?«, fragte mein Begleiter konsterniert.
»Ein Ferngespräch aus Koboldistan.«
John blickte mich verständnislos an.
Schließlich hatte ich Erbarmen mit ihm und gab ihm eine kurze Zusammenfassung meines Gesprächs mit der Koboldkönigin.
»Das klingt ziemlich stark nach einer Falle«, lautete sein geistreicher Kommentar.
»Der ganze Zug ist eine Falle. Was bleibt uns schon übrig, als dem Feind direkt gegenüberzutreten?«
In dem Fall war keine Antwort auch eine Antwort, denn John Smith schwieg.
Ich warf einen kurzen Blick in mein Magazin. Vier Kugeln befanden sich noch darin. Ich ging auf Nummer sicher und legte ein neues ein. Mein Begleiter nutzte die Zeit und tat es mir nach.
Gemeinsam setzten wir unseren Weg fort. Diesmal erfolgte kein weiterer Angriff.
An der Waggontür ließ ich meinem Begleiter den Vortritt, da ich alle Hände voll hatte.
Als wir das dritte Abteil betraten, sahen wir nur gähnende Leere. Kein weiterer Fahrgast hielt sich hier auf, aber scheinbar auch kein Kobold. Offenbar wollte diese Matra, dass wir ungeschoren zu ihr vorstoßen konnten.
»Diese Ruhe gefällt mir nicht. Irgendetwas liegt hier im Busch«, sagte John Smith.
Er behielt recht. Plötzlich war es mit der Ruhe vorbei. Aber keine Kobolde erschienen, es geschah etwas völlig anderes. Die Trennwand zum vordersten Waggon verschwand wie durch Zauberhand. Nun konnten wir bis zur Tür, die zum Lokführer führte, blicken. Und was wir sahen, konnte uns gar nicht gefallen.
Im Gang und auf den Sitzen verteilten sich mindestens zwei Dutzend Kobolde. Einige trugen grüne Bio-Kostüme, die sie wohl im Second-Hand-Busch des hiesigen Shoppingwaldes erstanden hatten. Andere hatten sich wie Afifi als Schaffner verkleidet, einige frönten dagegen der Freikörperkultur.
Aber alle hatten etwas gemeinsam: Sie waren bis an die Zähne bewaffnet. Messer, Dolche, Schwerter und Sicheln warfen uns einen funkelnden Schein entgegen. Einige hielten auch Blasrohre in den kleinen Händen.
In der Mitte des Ganges aber befand sich eine riesige Gestalt. Von ihrem Körper selbst war nichts zu sehen, da eine gewaltige Robe ihn umhüllte. Dieses Wesen musste mindestens zweieinhalb Meter groß sein.
Aus der dunklen Öffnung der Robe schallte uns die Stimme entgegen, die schon in meinem Kopf aufgeklungen war. »Endlich stehen wir uns gegenüber, Jimmy Spider. Ich habe mich aus meinem Reich in diese mechanisierte Welt begeben, damit du endlich deiner gerechten Strafe zugeführt wirst. Ich, Matra, seit mehr als tausend Jahren Königin des großen Volkes der Kobolde, werde deinem Leben nun ein Ende setzen.«
Die Kapuze der Robe flog zurück, und zum Vorschein kam das hässlichste Frauengesicht, das mir je untergekommen war. Fett, aufgedunsen, mit einer riesigen, von braunen Warzen übersäten Nase und Falten, in denen ein ausgewachsener Mann ein Nickerchen halten konnte. Die Augen glommen in einem kalten Gelb, doch tief in dem Licht erkannte ich auch ein düsteres, schwarzes Leuchten, das direkt aus dem Reich der Finsternis zu stammen schien.
»Das sieht alles andere als gut aus. Haben Sie einen Plan?«, flüsterte mein Begleiter mir zu.
»Vielleicht.«
Die Kreatur öffnete den Mund und gewährte mir einen Blick auf ihre spitzen, unterarmgroßen Zähne.
»Nun ist dein Ende gekommen«, sprach Matra weiter. »Möchtest du noch ein paar letzte Worte an die Welt, die du nun für immer verlassen wirst, richten?«
»Ja – friss Blei!«, schrie ich und schoss. Zwei Kugeln jagte ich der riesigen Kreatur entgegen.
Beide schlugen in Matras voluminöse Nase, aber außer einem kurzen Zucken passierte nichts.
»Toller Plan«, sagte John Smith.
Ich reagierte nicht darauf. Stattdessen beobachtete ich, wie die Koboldkönigin uns ihren linken Arm entgegenstreckte. »Packt sie!«, schrie sie ihren Untertanen zu. Und die ließen sich nicht zweimal bitten. Mit spitzen Schreien jagten sie uns entgegen.
Ich handelte wie ein Automat. Zunächst drückte ich Smith meine Desert Eagle in die Hand. »Geben Sie mir Deckung.«
Der mysteriöse Mann nickte und drückte sofort ab. Mit beiden Pistolen schoss er auf die herannahende Meute. Die Schnellsten unter ihnen hatten bereits die Hälfte des Weges hinter sich gelassen. Als Preis dafür erwischte es sie als Erste. Die Kugeln schleuderten sie zurück und damit ihren Artgenossen entgegen, die teils über sie stolperten, aber ihren Weg nach kurzer Verzögerung fortsetzten.
Währenddessen öffnete ich meinen Einsatzkoffer. Mit Kugeln kam ich hier nicht weit, also musste ich improvisieren. Neben der Flasche Wodka hatte ich nur ein paar Ersatzmagazine und eine Packung Zahnstocher dabei (wer hatte die bloß dort hineingelegt?). Ansonsten befand sich noch ein Feuerzeug in meiner Jackentasche. Wie hätte ich auch ahnen können, dass ich hier mitten in einen Koboldkrieg geraten würde? Eigentlich hatte ich den Einsatzkoffer nur mitgenommen, um dem (von Whisky abgesehen) Flüssigkeitsmangel in Glenrothes entgegentreten zu können.
Ich warf einen kurzen Blick auf die Meute der Kobolde. Einer von ihnen war den Kugeln entgangen und gefährlich nahe an mich herangekommen. Bevor er mich mit seinem Messer erwischen konnte, gab ich ihm einen saftigen Tritt, der ihn in hohem Bogen seiner Königin entgegenschleuderte.
Nach diesem Intermezzo griff ich nach der Wodkaflasche.
»Jetzt ist nun wirklich nicht die Zeit für einen Drink, Spider«, sagte Smith, während er erneut einige Schüsse abgab.
»Sehr witzig.« Tatsächlich ging es nun um Leben oder Tod. Der Wodka hatte mich auf eine Idee gebracht. Außer den Pistolen stand mir nur eine Waffe zur Verfügung – Feuer. Und um dieses zu potenzieren, gab es kaum etwas Besseres als feinsten Alkohol. Auch wenn es mir in der Seele wehtat, ich musste den Wodka opfern.
Die Kobolde – es mochten noch etwa zehn sein – hatten mich fast erreicht, als ich die Flasche der Königin entgegenschleuderte. Ich erlebte den Flug wie in Zeitlupe, sah Matras überraschtes Gesicht und jubelte innerlich auf, als die Flasche mit einem satten Klatschen auf ihrem Kopf landete, wo sie in tausend Stücke zerbrach. Der Alkohol verteilte sich über den gesamten Schädel, genau so, wie ich es haben wollte.
Aber für den zweiten Teil meines Plans war es nun zu spät. Die Kobolde hatten mich erreicht.
Der vordersten Kreatur gab ich einen Schlag gegen das Kinn, die sie zurück und gegen zwei Artgenossen schleuderte.
»Schießen Sie!«, schrie ich John Smith zu.
Mein Begleiter drückte ab, aber nur aus seiner Waffe flogen den Kobolden Kugeln entgegen. Das Magazin der Desert Eagle war offenbar leer. Geistesgegenwärtig warf er mir die Waffe zu.
Einen Meter vor mir zerplatze erneut eine hässliche Fratze. Dem nächsten Kobold zog ich meine Desert Eagle über den faltigen Schädel. Das Wesen fiel zu Boden, richtete sich aber sofort wieder auf.
Plötzlich schossen auch die Kobolde. Aber keine Kugeln, sondern kleine Pfeile, vermutlich mit Gift getränkt. Zwei von ihnen flogen über mich hinweg. Danach hörte ich einen erstickten Schrei und befürchtete das Schlimmste.
Doch dafür hatte ich keine Zeit. Ich griff mir ein Ersatzmagazin aus dem Einsatzkoffer und warf mich den Kobolden einfach entgegen. Noch im Flug lud ich meine Waffe nach.
Die kleinen Wichte waren einfach zu überrascht, um reagieren zu können. Mein Körper kam über sie wie ein Sturmwind. Einige wurden unter mir begraben, andere nach allen Seiten weggeschleudert.
Einer aber sprang über mich hinweg und John Smith entgegen. Der hockte apathisch auf dem Boden, hob aber noch einmal seine Pistole und schoss. Gleich mehrere Kugeln flogen dem Kobold entgegen. Eine traf direkt den Kopf, andere dagegen gingen fehl und wurden für mich zur Gefahr.
Plötzlich spürte ich einen heißen Stich an meinem linken Arm. Dort musste mich eine Kugel gestreift haben. Darum konnte ich mich aber nicht kümmern, denn die Kobolde griffen nun mich an.
Einer von ihnen stieß mir ein kleines Schwert entgegen. Ich parierte den Schlag mit meiner Pistole, verkantete sie und drückte ab. Die Kugel jagte durch das Kinn in den Kopf und ließ ihn zerplatzen.
Doch die anderen Kobolde waren schon heran und fielen über mich her. Einer von ihnen erwischte mich mit seinem Dolch an der linken Schulter. Ich packte ihn mit meiner freien Hand und schleuderte ihn einfach weg.
Gerade wollte ich mich schon um den nächsten Gegner kümmern, als ich sah, dass nun auch Matra in den Kampf eingreifen wollte. Mit donnernden Schritten lief sie mir entgegen.
Nun musste alles schnell gehen.
Vier Kobolde standen noch gegen mich. Ich sprang auf, gab einem einen heftigen Tritt und verpasste einem Zweiten eine Kugel. Damit hoffte ich, die kleine Gruppe aus dem Konzept zu bringen.
Eilig hetzte ich auf meinen Einsatzkoffer zu, riss die Zahnstocher hervor und ließ sofort meine Waffe fallen. Stattdessen zog ich mein Feuerzeug hervor und ließ die Flamme erscheinen.
Die Königin der Kobolde war nur noch wenige Meter von mir entfernt. Schon streckte sie mir ihre gewaltigen Pranken entgegen, um mich mit ihnen zerquetschen zu können.
Hastig zog ich einen Zahnstocher aus der Packung und blockierte damit das Rädchen des Feuerzeugs. So blieb die Flamme dauerhaft erhalten.
Mit einem gewaltigen Schrei schleuderte ich das Feuerzeug dem Kopf der Koboldkönigin entgegen. Aus dieser Entfernung war er gar nicht zu verfehlen. Bevor ihre Pranken mich erreichen konnten, warf ich mich nach hinten und sah gleichzeitig, wie das Feuerzeug ihren riesigen Schädel traf.
Eine gewaltige Stichflamme hüllte augenblicklich den Kopf dieser uralten Kreatur ein. Matra schrie schmerzerfüllt auf und torkelte brennend zurück.
Geschafft, dachte ich, doch ich hatte die drei letzten Kobolde vergessen. Einer sprang mir in den Rücken, die anderen beiden erschienen vor mir und streckten mir ihre Dolche entgegen. Offensichtlich sollte mich die Kreatur in meinem Rücken in die Klingen ihrer Artgenossen treiben.
Stattdessen erhob ich meine Desert Eagle und schoss auf die beiden Dolchträger. In dieser Lage konnte ich nicht genau zielen und drückte mehrmals ab. Zwei Kugeln flogen durch ein Loch, das sich im Unterboden gebildet hatte, eine dritte traf den rechts von mir stehenden Kobold mitten in die Brust. Mit einem klagenden Laut brach er zusammen.
Dem Zweiten verpasste ich zwei Kugeln direkt ins Gesicht.
Blieb nur noch die lästige Kreatur, die sich an meiner Jacke festgeklammert hatte. Bevor sie noch auf die Idee kam, meinen Rücken in einen Schweizer Käse zu verwandeln, riss ich sie mit der linken Hand von meiner Jacke und schleuderte sie wütend über meinen Kopf hinweg. Aber statt auf dem Boden aufzuprallen, fiel der letzte Kobold durch das Loch. Ob der Aufprall ihn dort nun vernichtet hatte oder nicht, war mir in dem Moment egal.
Ich wandte mich wieder Matra zu. Die Koboldkönigin schrie fürchterlich, während ihr Kopf in den Flammen förmlich dahinschmolz. Das Leuchten der Augen schwand dahin, die Gesichtskonturen lösten sich auf, bis der Schädel nur noch aus einer schlammartigen Pampe bestand.
Das hielt auch eine mehr als tausend Jahre alte Königin der Kobolde nicht aus. Führerlos brach der Torso zusammen.
Ich atmete tief durch und wischte mir den Schweiß von der Stirn. Dann fiel mir wieder John Smith ein, der von einigen dieser Giftpfeile getroffen worden war. Langsam lief ich zu ihm.
Er lag flach auf dem Boden und bewegte sich nicht mehr. Ich fühlte nach seinem Puls. Zwar nur schwach, aber er war noch vorhanden.
Plötzlich riss er seinen rechten Arm hoch, packte mich am Jackett und zog mich zu ihm hinunter.
»Ich … ich sterbe …«, flüsterte er.
»Das steht noch nicht fest«, versuchte ich ihn aufzubauen, obwohl ich innerlich eher das Gegenteil vermutete.
»Doch, ich … ich werde ihnen alles … s-sagen. Hören Sie zu …!«
»Ja, ich höre zu, Mr. Smith.«
»Mein N-N-Name ist …«. Seine Aussprache wurde immer undeutlicher. Ich musste mich bis über seinen Mund beugen, um noch etwas verstehen zu können. »S … Stanley Cooper. Ich h-atte den Auf-f-ftrag, Sie zu töten. Schon in San … Jose, bei d-der Zeitreise.«
Ich erinnerte mich. Damals hatte ich durch einen uralten Kühlschrank eine Zeitreise in den Wilden Westen gemacht und war dabei einer Bande gnadenloser Revolverhelden entgegen getreten. Bei meiner Rückkehr wäre ich fast in dem Kühlschrank gefangen geblieben.
»Ich handelte im A-Auftrag von … ich … kann n-nicht … bitte … House B-B-B- … Taco & Cheese!«
Ein seltsamer Moment, um sich mexikanisches Essen zu wünschen. Denn kurz darauf atmete er ein letztes Mal aus, bevor er keinen Ton mehr von sich gab. Er war tot.
Ich schloss ihm die Augen. Selbst wenn er den Auftrag gehabt hatte, mich umzubringen, diese letzte Ehre wollte ich ihm noch erweisen. Er hatte tapfer gekämpft und ironischerweise wäre ich ohne ihn wohl kaum lebend aus diesem Zug gekommen.
Allerdings, was er zuletzt gesagt hatte, ging mir nicht aus dem Kopf. House B … diesen Ausdruck hatte ich schon mal gehört. Nein, gelesen. In Louisiana, auf einem Stück Papier, das ein mysteriöser Mann hinterlassen hatte, der zuvor Commander Rathbone und seine Verrätertruppe erschossen und mir damit das Leben gerettet hatte. Die Nachricht bewahrte ich seitdem zu Hause in einem Safe auf.
Irgendetwas mit TCA-Headquater, House B hatte darauf gestanden, mit einer Raumangabe. Aber das Hauptquartier der TCA besaß kein House B. Doch warum hing dann neben seinem Eingang eine Plakette mit der Aufschrift House A? Es war und blieb ein Rätsel.
Bevor ich mich noch in meinen eigenen Gedankengängen verlaufen konnte, zog ich ein Etui hervor und steckte mir eine Zigarre in den Mund. Da fiel mir ein, dass ich ja gar kein Feuerzeug mehr besaß. Oder doch?
Nein – im Gang war keine Spur davon, und wo einmal Matras Körper gelegen hatte, befand sich nur noch ein großes Loch.
Plötzlich öffnete sich die Tür zum Steuerungsraum. Heraus trat – der Lokführer. Sein erster Blick galt mir, der zweite der großen Öffnung vor seinen Füßen. »Was ist denn hier passiert?«, fragte er entgeistert.
Ich zuckte nur mit den Schultern. »Haben Sie zufällig Feuer?«
Copyright © 2010 by Raphael Marques
Schreibe einen Kommentar