Jimmy Spider – Folge 23
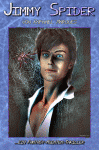 Jimmy Spider und die Suche nach der Mona Lisa
Jimmy Spider und die Suche nach der Mona Lisa
As sombras nannte man sie – die Schatten. Sie hatten keine Namen, keine Identitäten. Wer sie suchte, musste bestimmte Leute kennen, die wiederum jemanden kannten, der den Kontakt zu ihnen herstellte. In Brasilien waren sie eine Legende, in Frankreich nur ein böser Traum, aber es gab sie.
Wer gut bezahlte, und nur, wer gut bezahlte, bekam sie überhaupt zu sehen, für den taten sie alles. Mord, Raub, Entführungen, Folter – wenn das Geld stimmte, schlugen sie ohne die Spur eines Gewissens zu.
Wie in diesem Fall: Ein ihnen unbekannter Auftraggeber hatte ihnen befohlen, einen Einbruch zu verschleiern. Sie hatten ihn nicht selbst durchführen sollen, aber ihnen war mitgeteilt worden, dass ausländische Agenten kommen würden, um nach dem gestohlenen Objekt zu suchen. Mit einem Frachter aus Rio de Janeiro hatten sie es bis nach Frankreich geschafft und von ihrem Auftraggeber eine Wohnung in der Nähe des Tatortes erhalten. Dann begann die Vorbereitung. Einer von ihnen hatte sich als Säuberungskraft in das Museum geschlichen und es verwanzt. So hatten sie von den Spuren erfahren, die die Einbrecher zurückgelassen hatten.
Danach hatten sie sich aufgeteilt. Zwei von ihnen sollten das Video zerstören, die anderen drei suchten nach der Erde, die die Spurensicherung gefunden und mitgenommen hatte.
Auf ihrer Verfolgung spürten diese drei Männer, dass etwas nicht stimmte. Die sombras hatten allesamt einen heiligen Schwur geleistet, jeder riskierte sein Leben für den anderen, und jeder von ihnen konnte aus irgendeinem Grund spüren, wenn einem anderen etwas zustieß. Und auch hier spürten sie es … den Tod. Zwei ihrer Kameraden starben.
Die Überlebenden schworen blutige Rache. Und nun war ihre Zeit gekommen. Versteckt in einer Hauseinfahrt lauerten sie, schwer bewaffnet, und beobachteten den gegenüberliegenden, unscheinbaren Betonbau. In seinem Inneren befand sich das kriminaltechnische Labor des französischen Geheimdienstes.
Einer von ihnen hielt ein scheinbar harmloses Gerät in der Hand. Für den Laien wirkte es wie eine Fernbedienung. In Wirklichkeit aber waren sie damit in der Lage, Funkfrequenzen zu stören. Und sobald dieses Gerät eingeschaltet war, würden die sombras zuschlagen – brutal und gnadenlos …
***
Man konnte nicht unbedingt behaupten, dass ich besonders viel Ahnung von dem hatte, was Professor Nicolas LaCroix, Biologie-Experte und damit Beauftragter des französischen Geheimdienstes in Sachen Spurenanalyse, von sich gab. Zellstruktur, mikrobiologischer Nonsens und Fachchinesisch zum Thema Humus und Blütenpflanzen. Eben genau mein Lieblingsthema.
Während er uns (Tanja Berner, Dave Logger und mir) so einiges über eben jene wichtigen Dinge des Lebens erzählte und Dave unauffällig in eine britische Tageszeitung lugte, wanderten meine Gedanken zurück zu den letzten Ereignissen.
Da fiel mir zunächst mein linker Arm ein, der der Flugbahn einer Kugel im Weg gestanden hatte und den nun ein hübscher weißer Verband zierte. Zum Glück war es ein glatter Durchschuss gewesen, sonst hätte ich mich noch von den Franzosen beschneiden lassen müssen.
Außerdem hatten wir drei TCA-Kollegen verloren, getötet von zwei Mitgliedern der sombras, von denen ich dank der unendlichen Weisheit der TCA-Datenbank zumindest wusste, dass es sich um eine ziemlich geheimnisvolle brasilianische Killertruppe handelte. Eine Information, die mir weder weiterhalf noch mir etwas sagte, dass ich mir nicht auch so schon hätte zusammenreimen können.
Jedenfalls hatte es für die Mitglieder der TCA wieder einmal einiges zu tun gegeben. Mein Chef, Albert Scarfe und Damien Arias hatten dem französischen Geheimdienst einiges zu erklären gehabt, ebenso der Pariser Polizei, da bei der Schießerei neben dem Museum der Maserati des Sohnes des örtlichen Bürgermeisters zu Schrott geschossen worden war. Es traf doch immer wieder die Ärmsten der Armen.
Dave Logger, Tanja Berner und ich befanden uns dagegen in einem Labor des französischen Geheimdienstes und ließen uns von Professor LaCroix erklären, was wir mit einem Haufen Erde, den wir in dem Museum gefunden hatten, anfangen konnten.
»… und dies alles habe ich anhand Ihrer Erde herausfinden können, meine Damen und Herren.«
»Und was war das noch gleich?«, fragte ich ob meiner stetigen Geistesabwesenheit.
Während Dave Logger nur mit den Schultern zuckte und in der Zeitung blätterte, verdrehte Tanja Berner die Augen. LaCroix sah uns fassungslos an.
Der Mann war um die sechzig, hatte etwas Altersfett angesetzt, das aber zumindest in seinem Gesicht durch einen schlohweißen Vollbart verdeckt wurde. Natürlich trug er den unvermeidbaren weißen Kittel, eine weiße Hose sowie – Überraschung – weiße Schuhe. Und da sage noch einer, Paris wäre eine Stadt der Mode.
Dem Professor schien sein Outfit aber nichts auszumachen, dafür aber eher unsere Reaktion auf seinen ausladenden Vortrag. »Haben Sie mir überhaupt zugehört?«
Ich versuchte ihn zu trösten. »Ähm … ja. Aber sagen Sie es uns doch bitte noch mal in der Kurzfassung.«
LaCroix kniff die Augen zusammen, als ob er so meine Gedanken lesen wollte, aber irgendwie schien seine innere Kristallkugel heute nicht so recht funktionieren zu wollen.
»Nun gut, also für Sie noch mal in der Kurzfassung …«
***
»Ähm, Alain?«
»Ja, Gilles?«
»Hast du …«
»Ja?«
»Na du weißt schon …«
»Nein.«
»Hast du nicht …?«
»Was denn, Gilles?«
»Also hast du doch …«
»Ja …«
»Du hast es also?«
»Was hasse ich, Gilles?«
»Nein, ich meine, ob du es hast.«
»Gilles, sag es mir jetzt endlich oder halt die Klappe!«
»Na du weißt schon …«
»Nun sag es schon, bevor ich dir eigenhändig den Mund zuklebe.«
»Na, dieses Zeug.«
»Was für Zeug? Und sag jetzt bloß nicht Na du weißt schon.«
»Na du … äh, ich meine, wie soll ich es sagen …«
»Am besten, du lässt es sein und hältst einfach den Mund.«
»Nein, ich brauche es. Ich meine, wie soll ich es sagen … diese weißen Engelchen.«
»Sag mal Gilles, bist du betrunken?«
»Nein, noch nicht … was ich meine ist, nun ja, diese weißen Heilsbringer.«
»Du bist betrunken.«
»Nein, nein, Alain. Ich meine, hast du was von dem Mehl?«
»Mehl?«
»Ja, genau.«
»Du fragst mich tatsächlich hier, bei der Arbeit, ob ich Mehl habe?«
»Ja. Jetzt hast du es verstanden.«
»Geh dir doch einfach welches kaufen. In fünfzig Metern links ist ein Supermarkt. Und bring dabei ein paar Alka Seltzer mit.«
»Die haben aber nicht dieses Mehl. Da hab ich schon gefragt.«
»Was für ein Mehl willst du denn? Tiermehl?«
»Nein … du weißt schon, dieses Mehl, das einem so schöne Träume bringt.«
»Du meinst Koks?«
»Jaaaa!«
»Warum sagst du das nicht gleich, anstatt mir irgendetwas von Engeln und Mehl vorzuzwitschern.«
»Na ja, immerhin stehen wir hier im Eingang des Labors unseres Geheimdienstes und halten Wache. Es könnte ja jemand zuhören.«
Alain Ducasse schlug die Hände vor sein Gesicht. Warum hatte man ihn nur mit so einem Volltrottel als Partner bestraft? Immerhin konnte er aber so seinem geheimen Hobby, nämlich den Drogendealer zu spielen, frönen. Sein alter Freund Rashid brachte ihm hin und wieder Kokain vorbei, das er von seinen Partnern heimlich geklaut hatte. Bei den meist völlig überarbeiteten Geheimdienstlern hatte diese kühle Brise eingeschlagen wie eine Bombe. Mittlerweile verdiente Alain mit dieser Methode mehr pro Monat als mit seinem tatsächlichen Job. Dieser Job beinhaltete allerdings nur, mit einem Gewehr im Eingangsbereich eines Labors Wache zu halten und aufzupassen, dass hier kein Obdachloser ein Plätzchen für einsame Nächte suchte. So ein Fall hatte seinen Vorgängern von einer privaten Sicherheitsfirma den Job gekostet.
Die Monotonie, die einen dabei befiel, war erdrückend. Herumstehen, sitzen, essen, trinken, herumstehen, Meldung machen, herumste… Jetzt fiel es ihm wieder ein – er musste ja Meldung machen! Seine Kollegen oben in der Sicherheitszentrale machten sich bestimmt schon ihre Gedanken, ob Alain nicht schon ein Schippchen von seiner weißen Köstlichkeit probiert hatte.
Er zog sein Funkgerät, drückte einen Kopf und sprach seine Kollegen an. »Ducasse an Zentrale.« Stille. Merkwürdig …
Er versuchte es erneut. Nichts. Das Funkgerät war tot.
»Wie sieht es denn nun aus, hast du was von …«
»Ja, ja, später. Probier mal dein Funkgerät aus!«
»Warum, ich …«
»Tu es einfach, sonst bekommst du nichts.«
»Okay, okay, ganz ruhig, Alain.« Gilles Montagne zog sein Funkgerät und setzte ebenfalls einen Funkspruch ab. »Landhase an Bau, bitte kommen!«
Alain verdrehte die Augen. Gilles hatte ein besonderes Faible für lächerliche Funksprüche. Aber auch das half nichts. Das Gerät war tot.
»Was zur Hölle …«
Bevor Gilles weiterfluchen konnte, erhielten die beiden Wachleute Gesellschaft. Vor ihnen im Gang erschienen drei ganz in schwarz gekleidete Männer.
Alain Ducasse schwante Böses. Sofort erhob er sein Maschinengewehr, aber es war zu spät.
Woher die drei Männer plötzlich ihre Waffen gezogen hatten, wusste er nicht, dafür hörte er das leise Plopp, plopp, plopp. Plötzlich wurde er zurückgeworfen. Seine Brust schien vor Schmerzen zu zerreißen.
Das Letzte, was er sah, bevor die ewige Schwärze ihren Mantel über ihn legte, war sein Partner Gilles, der neben ihm tot zu Boden fiel.
***
»… Ihre Erde enthält Spuren einer Pflanze, die nur in einem kleinen, entlegenen Bereich Louisianas vorkommt.«
»Was für ein ungeheurer Zufall«, sagte ich mit einem leicht sarkastischen Unterton.
»In der Wissenschaft gibt es keine Zufälle, Monsieur Spider. Aber zurück zu der Pflanze: Ich habe Spuren des Edelgoldfarnes gefunden.«
»Nie gehört«, nuschelte Dave Logger, immer noch in seine Zeitung vertieft. Mittlerweile hatte er sich auf einen Tisch gesetzt und blätterte ungeniert von Seite zu Seite.
»Das hätte mich auch sehr gewundert. Diese Pflanze existiert offiziell nicht. Die CIA hat den Edelgoldfarn 1979 künstlich erschaffen, um mit seinem Saft eine Art Wahrheitsserum zu brauen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber viel scheint man damit nicht erreicht zu haben, denn 1991 setzte man die einzigen beiden noch existierenden Farne in einem Wald etwa 150 Meilen westlich von Baton Rouge mitten in einem Wald in den Sümpfen aus und überließ sie sich selbst. Ich drucke ihnen gerade noch eine genaue Karte der Gegend aus.
Offenbar haben die von Ihnen gesuchten Leute dort einen der Farne zertreten. Was für Banausen …«
»Also könnte es sein«, folgerte ich, »dass unsere Kandidaten für den Zufallspreis des Monats genau aus dieser Gegend kommen.«
»Könnte man meinen, aber eigentlich ist dort nichts, außer Sumpf, Wald und Alligatoren. Zumindest meinen Informationen nach.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Es ist unsere einzige Spur.«
Mein Blick wanderte zu Tanja Berner. Ich lächelte sie an. »Sieht aus, als würden wir bald einen kleinen Sumpfspaziergang machen.«
»Wie romantisch«, antwortete sie, offensichtlich wenig begeistert.
Wie konnte ich dieser Frau nur begreiflich machen, was für ein Sturkopf sie war?
***
Die schwarzen Gestalten schlichen durch die Gänge wie Geister, die man aus der Hölle entlassen hatte. Wo sie erschienen, brachten sie den Tod, und wer das Pech hatte, ihnen zufällig über den Weg zu laufen, konnte mit seinem Leben abschließen.
Nach den beiden Wachleuten hatten sie noch drei junge Laboranten getötet und ihre Leichen in einer Abstellkammer versteckt. Vor ihrem Tod hatten sie einen der Geheimdienst-Mitarbeiter, eine spanisch-stämmige junge Frau, gezwungen, ihnen den Aufenthaltsort ihrer Zielpersonen zu verraten. Ein Stockwerk tiefer mussten sie.
Sie erreichten einen Aufzug und stiegen ein.
Bald schon würde ihr Auftrag erfüllt sein. Alle Spuren verwischt und ihre Kameraden gerächt. Schon sehr bald …
***
Für uns schien die Arbeit hier beendet zu sein. Wir warteten lediglich noch auf den Ausdruck der Landkarte.
Was würde sie uns bringen? Einen Mittagsplausch mit ein paar Alligatoren, die Suche nach einer Pflanze, die es eigentlich gar nicht gab, ein im Sumpf versunkenes UFO – oder vielleicht doch eine Spur zu den beiden Dieben, ergo zu Sterling und seinem Partner, wenn sie es denn wirklich waren? Bisher deutete alles darauf hin, aber wer kann schon wissen, was die Zukunft bringt?
Ein Ping riss mich aus meinen Gedankengängen. Das gleiche Geräusch war erklungen, als wir mit dem Aufzug diese Etage erreicht hatten. Wir erhielten also Besuch. Aber von wem? Sekunden später erhielt ich die Antwort. Drei in schwarze Anzüge gehüllte südländisch wirkende Männer tauchten wie aus dem Nichts in dem weiträumigen Labor auf und legten mit ihren mit Schalldämpfern ausgestatteten Maschinenpistolen auf uns an. Die sombras hatten uns also gefunden, bevor wir sie finden konnten.
Mehr als ein »Scheiße!« brachte ich nicht heraus, bevor ich Dave gegen die Brust stieß und dieser kopfüber mit der Zeitung in der Hand nach hinten kippte, während ich mich gleichzeitig fallen ließ und meine Desert Eagle zog.
Während meines Falls sirrten schon die ersten Kugeln über mich hinweg. Dave (er eher unfreiwillig), Tanja und ich waren rechtzeitig in Deckung gegangen, aber der Professor wurde von der Garbe voll erwischt. Gleich mehrere Kugeln trafen seinen Kopf, auch den Computer, der in einem wahren Funkenregen zersprang.
Etwa zehn Meter vor mir sah ich zwei schwarze dünne Säulen. Die Beine eines Angreifers. Ich schoss einfach auf sie.
Einige Kugeln gingen fehl, aber zwei trafen das rechte Schienbein.
Schreiend brach der Mann in die Knie, schoss aber einfach weiter, unter den Tischen durch. Ich rollte mich einige Meter zur Seite. So schlugen die Kugeln nur in die Fliesen und schwirrten unter weiteren Tischen hindurch.
Dorthin, wo Dave Logger lag, schoss es mir durch den Kopf. Ich drehte ihn zur Seite, aber dort, wo ich ihn vermutet hatte, befand sich Dave schon nicht mehr.
Trotzdem schoss der Killer weiter. Tischbeine zerbarsten, ein Tisch brach zusammen, und ich versuchte wieder auf den Mann anzulegen. Aber auch er war plötzlich verschwunden.
Vorsichtig richtete ich mich auf. Das Labor war zwar sehr weitläufig und in mehrere Gänge zwischen den Labortischen unterteilt, aber die Sicht war dennoch nicht völlig frei, weil die Decke von einigen Säulen gehalten wurde. Außerdem war der Raum mit einem Gang zu einem weiteren Labor verbunden.
Keiner der Angreifer war zu sehen, aber plötzlich hörte ich einen erstickten Schrei. Etwa zehn Meter vor mir fiel jemand über einen der Tische. An der Jacke erkannte ich, dass es Dave Logger war.
Ohne weiter nachzudenken rannte ich zu ihm, die Waffe im Anschlag.
Zwischen den Tischen erschien eine weitere Gestalt. Einer der Killer, der sich geduckt Daves leblosem Körper näherte.
Als er mich erkannte, war es für ihn schon zu spät. Ich schoss ihm eine Kugel direkt zwischen die Augen. Wie vom Blitz getroffen brach er zusammen.
Ich duckte mich wieder, lief zu Dave Logger und zog ihn von dem Tisch zurück auf den Boden. Eigentlich rechnete ich schon damit, meinen Freund tot vor mir liegen zu sehen, als sich ein verzerrtes Grinsen auf sein Gesicht legte. »Es ist nur die Schulter, Jimmy. Alles … halb so schlimm.«
Mein Blick wanderte über seinen Körper. Tatsächlich, der Killer hatte nur seine Schulter erwischt.
»Beim nächsten Mal gibst du bitte ein Zeichen, dass du nicht tot bist, klar?«
»Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Mit den Pobacken winken, oder was?«
»Zum Beispiel.«
Dave winkte mit schmerzverzerrtem Gesicht ab. »Das klären wir später. Jetzt schnapp dir erst mal diese Typen.«
»Nichts leichter als das.« Ich sah mich vorsichtig um. Niemand war zu sehen, auch keine Schüsse erklangen. »Sag mal, Dave, hast du Tanja irgendwo gesehen?«
»Sie hat einen der Killer verfolgt, ich glaube in den Gang zu dem anderen Labor.«
»Danke.« Ich gab ihm noch einen aufmunternden Klaps auf den Bauch, bevor ich mich auf den Weg zu dem Gang machte. Dabei orientierte ich mich zunächst nach links, weil ich dort irgendwo den von mir angeschossenen Schatten vermutete.
Als ich an der Raumwand angekommen war, entdeckte ich eine deutliche Blutspur. Offenbar hatte ich den Kerl ziemlich hart erwischt. Ich folgte ihr bis zu einer der Säulen, an der sie im Nichts endete. Hatte der Killer sich hier tatsächlich in einen Schatten aufgelöst, oder …?
Ich brachte den Gedanken nicht zu Ende, denn plötzlich spürte ich kalten Stahl in meinem Nacken. »Erwischt!«, sagte der Killer in kaum zu verstehendem Englisch.
Ich erstarrte. Der Schatten hatte mich tatsächlich ausgetrickst. Er war einfach über den Tisch gesprungen und hatte sich hinter der Säule versteckt. Keine schlechte Idee, sie hätte von mir stammen können. Zu dumm, dass ich sie wohl kaum mehr abkupfern könnte.
Dann drückte er ab. Ein Schuss erklang, ein zweiter und noch ein dritter. So schwer war es doch nun wirklich nicht, mich aus der Entfernung zu treffen, oder hatte der Killer zwei linke Hände?
Als ich schließlich hörte, wie hinter mir etwas auf den Boden fiel, wurde mir klar, dass der Typ wohl heute nicht mehr treffen würde.
Vorsichtig drehte ich mich um. Schwer auf einen der Tische gestützt stand einige Meter von mir entfernt Dave Logger, die rechte Schulter blutüberströmt und in der ausgestreckten linken Hand seine Pistole haltend, und zwinkerte mir zu, bevor er wieder zusammenbrach.
Das kostete mich wieder mal eine Flasche teuren schottischen Whisky. Jedes Mal, wenn er mir oder ich ihm in der Vergangenheit in letzter Sekunde das Leben gerettet hatte, wurde diese milde Gabe fällig. In diesem Fall war ich allerdings zu jeder Spende bereit.
Mein Blick glitt zu Boden. Dort lag der tote Schatten mit drei blutigen Kugellöchern in seinem Rücken. Ich fühlte nach seinem Puls. Nichts. Der Mann war tot.
Als ich mich wieder aufrichtete, wanderten meine Gedanken zurück zu Tanja Berner. Zu lange schon hatte ich nichts mehr von ihr gehört.
Mit erhobener Pistole lief ich in den Gang hinein. Niemand war dort zu sehen, kein einziges Geräusch zu hören. Mir schwante Böses, aber den Gedanken verdrängte ich lieber.
Als ich das andere Labor erreichte, erhielt ich sofort einen bleiernen Empfang. Eine Kugel huschte nur Zentimeter an meinem linken Ohr vorbei, eine zweite streifte es leicht (warum traf es eigentlich immer meine linke Seite?), bevor ich mich zu Boden warf.
Hinter einer der Säulen sah ich einen Waffenarm hervorlugen. Dort musste sich der letzte der Schatten verschanzt halten. Aber wo war Tanja Berner?
»Hallo, Jimmy.«
Ich zuckte zusammen. Einen Meter links von mir hockte meine Schweizer Kollegin an ein Waschbecken gelehnt und lächelte mich etwas schief an. Ich kroch zu ihr.
Ich atmete tief durch. »Alles klar bei dir? Bist du verletzt?«
»Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht?«
»Wie kommst du nur darauf?«, sagte ich ironisch. »Ich frage nur wegen der Versicherung.«
»Der Ver…, ach, vergiss es! Nein, ich hocke hier nur, weil mir die Kugeln ausgegangen sind. Mein Freund hinter der Säule weiß das aber zum Glück nicht. Aber er ist schlau, er wagt sich auch nicht aus seinem Versteck hervor. Erst als du gekommen bist, hat er sich wieder geregt.«
»Also müssen wir ihn irgendwie dazu bringen, hinter der Säule hervorzukommen.«
»Ja … wo steckt eigentlich Dave?«, fragte sie leicht besorgt.
»Keine Sorge, dem geht’s gut. Er hält nur einen kleinen Mittagsschlaf.«
»Er … nein, ich frag lieber nicht mehr.«
Sie gab mir zum Glück etwas Zeit, um nachzudenken. Für solche Fälle gab es immer ein paar Tricks, und ich erinnerte mich, dass mir mein Vater mal einen solchen beigebracht hatte (wenigstens ein guter Grund, ihn als Vater zu haben).
Ich griff in die Innentasche meiner Jacke und zog eine meiner Zigarren hervor.
Meine Schweizer Kollegin sah mich ungläubig an. »Du willst doch jetzt nicht etwa rauchen?«
»Pssst!«, antwortete ich nur.
Dann sprach ich unseren Gegner hinter der Säule direkt an. »Meu amigo …«
»Ich bin nicht dein Freund, du Bastard«, erklang die Stimme des Killers in fließendem Englisch. Offenbar hatte ich es mit dem gebildetsten der Truppe zu tun. Das vereinfachte die Sache natürlich und ihm blieb mein Versuch erspart, ihn auf Portugiesisch übers Ohr zu hauen.
»Wie auch immer…« Ich zog mit meiner linken Hand ein Feuerzeug hervor. »Sie denken vielleicht, das wäre eine Pattsituation, aber da irren Sie sich. Für solche Gelegenheiten habe ich immer eine Stange Dynamit dabei.«
»Sie wollen mich reinlegen!«
Entweder ich hatte es mit einem Genie zu tun, oder er hatte einfach nur Angst. Ich tippte auf Letzteres.
»So, meinen Sie? Dann sehen Sie mal her.« Ich zündete die Zigarre an, nahm einen tiefen Zug und paffte den Rauch nach oben. Danach gab ich ein Pfffff von mir, um das Geräusch einer brennenden Lunte zu imitieren. Schließlich warf ich die Zigarre mit den Worten »Viel Vergnügen damit!« auf die Säule zu.
»Merde!«, schrie der Killer, bevor er sich aus der sicheren Deckung in den Gang warf. Gleichzeitig hatte ich mich aufgerichtet und zielte mit der Desert Eagle auf ihn.
Entgeistert sah er mich an.
»Reingelegt!«, entgegnete ich ihm grinsend. »Und jetzt weg mit der Waffe. Geben Sie auf!«
Der Schatten hatte alle Chancen verspielt. Wenn er jetzt seine MP hob, würde ich ihn locker mit meinen Kugeln niederstrecken können.
Aber der Mann gab einfach nicht auf. Vielleicht war es auch seine Art, im Angesicht der sicheren Niederlage Selbstmord zu begehen. »Niemals!«, schrie er und riss die Waffe hoch.
Bevor er auf mich anlegen konnte, drückte ich zwei Mal ab. Beide Kugeln hieben in seine ungeschützte Brust und warfen ihn zu Boden.
Mit der Pistole im Anschlag kam ich langsam auf ihn zu. Dabei erinnerte ich mich an die Szene gestern in dem Haus neben dem Museum. Genau dieselbe Szene hatte sich dort abgespielt. Erst mit den letzten Worten des sterbenden Scharfschützen hatte ich von den Schatten erfahren, und nun hoffte ich, durch die letzten Worte des vor mir liegenden Killers mehr über seine Auftraggeber zu erfahren. War es Sterling? Oder jemand ganz anderes?
Wenige Augenblicke später fiel meine Hoffnung wie ein Kartenhaus zusammen. Der letzte Schatten war tot. Eine meiner Kugeln musste sein Herz getroffen haben.
Ich atmete noch einmal tief durch, bevor ich mich wieder Tanja Berner zuwandte.
Die Schweizerin sah mich ungläubig an. »Wo hast du denn den Trick her?«
»Von meinem Vater.«
»Sir Gerald Spider hat dir solche Tricks beigebracht? Und ich dachte immer, dein Vater und du, ihr kämt nicht miteinander klar und …«
Ich sah sie nicht gerade freundlich an. Das war ein Thema, über das ich nur sehr ungern sprach, und Tanja verstand mich offenbar, denn sie hakte nicht weiter nach.
Gemeinsam gingen wir zurück in das Hauptlabor. Dort hatte sich inzwischen Dave Logger erneut aufgerafft und wankte uns entgegen. »Na, alles erledigt?«, fragte er, bevor er meiner Partnerin förmlich in die Arme fiel. Während sie mit diesem Schwertransport beschäftigt war, begab ich mich zur Leiche von Professor LaCroix. Der Mann schien von allem nicht viel mitbekommen zu haben – nicht nur, weil er gleich zu Beginn gestorben war – denn sein Gesicht zeigte einen völlig normalen Ausdruck.
Ausdruck … da war doch noch was. Tatsächlich, neben dem zerstörten PC und vor dem im Druckerhimmel befindlichen Drucker fand ich den Ausdruck einer Gebietskarte.
Ein leichtes Lächeln legte sich auf mein Gesicht.
Eine Spur blieb uns also doch noch. Und dieses Mal würde ich nichts dem Zufall überlassen, um die Mona Lisa zurückzuholen und womöglich endlich Raymond Sterling aus dem Verkehr zu ziehen …
Copyright © 2010 by Raphael Marques
Schreibe einen Kommentar