Catherine Parr Band 1 – Zweites Buch – Kapitel 4
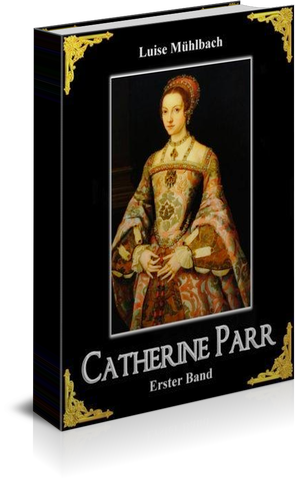 Luise Mühlbach
Luise Mühlbach
Catherine Parr
Zweites Buch
Historischer Roman, M. Simion, Berlin 1851
IV. Der König langweilt sich
König Heinrich war allein in seinem Arbeitszimmer. Er hatte einige Stunden damit verbracht, an diesem frommen Erbauungsbuch zu schreiben, das er seinen Untertanen statt der Bibel zur Lektüre empfehlen wollte, da er als Oberhaupt der Kirche die entsprechende Autorität besaß.
Doch der Oberpriester der englischen Kirche, der erhabene König von Gottes Gnaden, spürte, dass trotz dieser beiden großen und erhabenen Würden ein drittes Wesen in ihm wohnte: ein armes, schwächliches Menschenkind, das trotz der Erhabenheit des Priesters und der Größe des Königs Hunger und Langeweile, Ermattung und Überdruss empfinden konnte wie jeder andere Sterbliche auch.
Er legte die Feder nieder und überblickte mit unendlichem Behagen die vollgeschriebenen Blätter. Sie sollten seinem Volk einen neuen Beweis seiner väterlichen Liebe und Fürsorge liefern und ihm die Überzeugung geben, dass Heinrich VIII. nicht nur der edelste und tugendhafteste, sondern auch der weiseste König sei.
Doch selbst diese Betrachtung vermochte den König heute nicht zu erheitern – vielleicht, weil er sie schon zu häufig angestellt hatte. Das Alleinsein ängstigte und beunruhigte ihn. Es gab so viele heimliche und verborgene Stimmen in seiner Brust, deren Flüstern er sich fürchtete und die er daher immer zu übertönen suchte. Es gab so viele Erinnerungen an Blut, die immer wieder auftauchten, so oft er auch mit neuem Blut versucht hatte, sie zu löschen. Diese Erinnerungen scheute der König, obwohl er den Anschein gab, niemals zu bereuen und niemals Unruhe zu empfinden.
Er schlug mit hastiger Hand an die goldene Klingel neben ihm und sein Antlitz erhellte sich, als er sofort die Tür sich öffnen sah und Graf Douglas auf der Schwelle derselben erschien.
»Oh, endlich!«, sagte der Lord, der den Ausdruck in Heinrichs Zügen sehr wohl verstanden hatte. »Endlich lässt der König sich herab, sein Volk zu begnadigen!«
»Ich begnadigen?«, fragte der König erstaunt. »Und wie mache ich das?«
»Indem Eure Majestät endlich ausruht von dieser Anstrengung und ein wenig an Eure so kostbare und notwendige Gesundheit denkt! Indem Ihr Euch erinnert, Sire, dass das Wohl Englands einzig und allein in dem Wohl seines Königs beruht und dass Ihr gesund sein und bleiben müsst, damit auch Euer Volk gesund bleibt!«
Der König lächelte zufrieden. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, an den Worten des Grafen zu zweifeln. Er fand es ganz natürlich, dass das Wohl seines Volkes in seiner Person ruhte, aber es war immer doch eine stolze und schöne Melodie, und er liebte es, sich diese von seinen Höflingen wiederholen zu lassen.
Der König lächelte, wie gesagt, aber es lag etwas Ungewöhnliches in diesem Lächeln, das dem Grafen nicht entging.
»Er befindet sich in dem Zustand einer hungrigen Anakonda«, sagte Graf Douglas zu sich selbst. »Er lauert auf Beute und wird erst wieder heiter und wohlgemut sein, wenn er Menschenfleisch und Blut gekostet hat.« Ah, glücklicherweise haben wir davon Vorrat! Wir werden dem König also geben, was des Königs ist. Aber wir müssen vorsichtig sein und besonnen zu Werke gehen!«
Er näherte sich dem König und drückte ihm einen Kuss auf die Hand.
»Ich küsse diese Hand«, sagte er, »die heute die Quelle gewesen ist, durch welche die Weisheit des Kopfes auf dieses gottgesegnete Papier ausgeströmt ist. Ich küsse dieses Papier, das dem glücklichen England das reine und unverfälschte Wort Gottes verkündigen und erläutern wird. Dennoch sage ich: Es ist genug, mein König. Erinnert Euch daran, dass Ihr nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Mensch seid.«
»Ja, und zwar ein schwacher und hinfälliger!«, seufzte der König, während er mühsam versuchte aufzustehen und sich dabei so energisch auf den Arm des Grafen lehnte, dass dieser unter der ungeheuren Last fast zusammenbrach.
»Hinfällig?«, sagte Graf Douglas vorwurfsvoll. »Eure Majestät bewegt sich heute so leicht und frei wie ein Jüngling. Es bedurfte nicht einmal meines Armes, um Euch aufzurichten!«
»Nichtsdestotrotz werden wir alt!«, sagte der König, der sich langweilte und heute ungewöhnlich empfindsam und schwermütig war.
»Alt!«, wiederholte Graf Douglas. »Alt mit diesen feuersprühenden Augen, dieser erhabenen Stirn, diesem ganzen edlen Antlitz? Nein, Majestät. Die Könige haben das mit den Göttern gemein, sie altern niemals!«
»Und darin gleichen sie auf ein Haar den Papageien!«, sagte John Heywood, der gerade das Zimmer betrat. »Ich besitze einen Papagei, den mein Urgroßvater von seinem Urgroßvater erbte. Dieser war Friseur von Heinrich dem Vierten und der Papagei singt heute noch mit eben solcher Geläufigkeit wie vor hundert Jahren: ›Es lebe der König, es lebe dieses erhabene Musterbild von Tugend, Anmut, Schönheit und Barmherzigkeit, es lebe der König!‹ Das hat er vor hundert Jahren geschrien und wiederholt für Heinrich den Fünften, den Sechsten, den Siebten und den Achten. Und wunderbar, die Könige wechselten, aber das Loblied passte immer und war immer die reine Wahrheit! Genau wie das eure, Mylord von Douglas! Ihr könnt euch darauf verlassen, Majestät, dass er die Wahrheit sagt, denn er ist ein naher Verwandter meines Papageis. Er nennt ihn immer ‚mein Vetter‘ und hat ihm das unsterbliche Loblied auf die Könige gelehrt.«
Der König lachte, während Graf Douglas John Heywood einen gehässigen, stechenden Blick zuwarf.
»Er ist ein übermütiger Kobold!«, sagte der König. »Nicht wahr, Douglas?«
»Er ist ein Narr!«, entgegnete dieser achselzuckend.
»Richtig, und deshalb habe ich Euch vorhin die Wahrheit gesagt. Denn Ihr wisst, Narren und Kinder sagen die Wahrheit. Und ich bin just deshalb ein Narr geworden, damit der König, den Ihr alle belügt, doch irgendein Geschöpf außer seinem Spiegel um sich hat, das ihm die Wahrheit sagt.«
»Nun, und welche Wahrheit willst du mir heute auftischen?«
»Das ist aufgetischt, Majestät! Legt also Eure Königskrone und Eure Oberpriesterschaft ein wenig beiseite und entschließt Euch, für einige Zeit ein fleischfressendes Tier zu sein. Es ist sehr leicht, ein König zu werden! Man hat dazu nichts weiter nötig, als unter einem Thronhimmel von einer Königin geboren zu werden. Aber es ist sehr schwer, ein Mensch zu sein, der gut verdaut! Dazu braucht man einen gesunden Magen und ein unbeschwertes Gewissen. Kommt, König Heinrich, und lasst uns sehen, ob Ihr nicht nur ein König, sondern auch ein Mensch mit einem guten Magen seid!«
Mit einem lustigen Lachen nahm er den Arm des Königs und geleitete ihn mit dem Grafen in den Speisesaal.
Der König, der ein außerordentlicher Esser war, winkte schweigend seinem Hofstaat, an der Tafel Platz zu nehmen, nachdem er sich selbst auf den vergoldeten Sessel niedergelassen hatte.
Mit einer ernsten und feierlichen Miene empfing er sodann aus den Händen des Oberzeremonienmeisters die elfenbeinerne Tafel, auf welcher das heutige Dinner verzeichnet war. Bei jeder dieser auserlesenen und seltenen Speisen, zu deren Herbeischaffung täglich eine ganze Armee von Kurieren und Postwagen eingesetzt wurde, welche diese Seltenheiten aus den entferntesten Enden der Welt herbeischaffen mussten, machte der König eine beifällige Kopfbewegung, die jedes Mal das Gesicht des Oberzeremonienmeisters zum Strahlen brachte. Da waren Vogelnester, die mit einem eigens dafür gebauten Schnellsegler aus Ostindien geholt worden waren, da waren Hähne aus Kalkutta und Trüffeln aus Languedoc, die der dichterische König Franz I. von Frankreich gestern als besonderen Liebesgruß an seinen königlichen Bruder in England geschickt hatte. Da war der moussierende Wein aus der Champagne und der feurige Wein von der Insel Zypern, den die Republik Venedig dem König als Zeichen der Verehrung geschickt hatte. Da waren auch diese schweren Rheinweine, die wie flüssiges Gold aussahen und den Duft eines ganzen Blumenbouquets verströmten. Mit ihnen hofften die norddeutschen protestantischen Fürsten, den König, den sie gern an die Spitze ihrer Ligue stellen wollten, zu berauschen. Außerdem gab es diese riesigen Pasteten mit Rebhühnern, die der Herzog von Burgund geschickt hatte, sowie die herrlichen Südfrüchte von der spanischen Küste, mit denen Kaiser Karl der Fünfte den Tisch des Königs von England versorgte. Denn man wusste sehr wohl, dass man, um den König von England geneigt zu machen, ihn erst satt machen musste.
dass man zuerst seinen Gaumen kitzeln müsse, um alsdann seinen Kopf oder sein Herz zu gewinnen.
Doch heute schienen all diese Dinge nicht zu genügen, um dem König dieses selige Behagen zu bereiten, das man sonst bei ihm gewohnt war, wenn er an der Tafel saß. Er lächelte schwermütig über John Heywoods Scherze und beißende Epigramme. Und obwohl er selbst über obszöne und zweideutige Witze übersprudelte, die seinen Hof laut jubeln und lachen machten, blieb der König selbst dabei ganz ernst und eine Wolke lagerte auf seiner Stirn. Der Grund war, dass ihm dieser Chor der Lacher nicht genügte, dass er die Frauen vermisste, deren verschämtes Erröten und sittiges Augenniederschlagen ihn zu immer kühneren und gewagteren Scherzen anfeuerten. Der König bedurfte zur Erheiterung seiner Gemüter durchaus der Gegenwart von Frauen. Er bedurfte ihrer, wie der Jäger der Rehe bedarf, um des Vergnügens der Jagd teilhaftig werden zu können. Dieses Vergnügen besteht darin, die Wehrlosen zu töten und den Unschuldigen und Friedfertigen den Krieg zu erklären.
Für König Heinrich waren die Frauen in der Tat nichts weiter als das Wild, das er hetzte und umhertrieb, solange er Gefallen an ihrer Schönheit und ihrem Geist fand. Wenn er schließlich von der Jagd ermüdet war, tötete er es!
Graf Douglas, der schlaue Höfling und unermüdliche Forscher in der Seele des Königs, erriet das Missbehagen Heinrichs sehr wohl und verstand den geheimen Sinn seines Stirnrunzelns und Seufzens. Er hatte sehr darauf gehofft und war fest entschlossen, seinen Vorteil daraus zu ziehen – zugunsten seiner Tochter und zum Schaden der Königin.
»Majestät«, sagte er, »ich bin gerade dabei, einen Hochverräter aus mir zu machen und meinen König eines Unrechts anzuklagen.«
Der König richtete seine blitzenden Augen auf ihn und legte die von Brillantringen funkelnde Hand um den mit Rheinwein gefüllten goldenen Pokal.
»Eines Unrechts, mich, Euren König?«, fragte er mit schwerer Zunge.
»Ja, eines Unrechts, insofern als Ihr für mich der sichtbare Stellvertreter Gottes auf Erden seid. Ich würde Gott beschuldigen, wenn er uns eines Tages den Glanz der Sonne, die Pracht und den Duft seiner Blumen entzöge. Denn da wir Menschen gewohnt sind, diese Herrlichkeiten zu genießen, haben wir gewissermaßen ein Anrecht darauf gewonnen. Ich beschuldige also Euch, weil Ihr uns die verkörperten Blumen und die fleischgewordenen Sonnen entzogen habt, weil Ihr so grausam gewesen seid, Sire, die Königin nach Epping Forest zu senden.«
»Nicht doch, die Königin wollte reiten«, sagte Heinrich missmutig. »Das Frühlingswetter reizte sie, und da ich leider nicht die Eigenschaft der Allgegenwärtigkeit besitze, musste ich mich entschließen, ihre Nähe zu entbehren. Es gibt kein Pferd mehr, welches den König von England zu tragen vermöchte!«
»Doch, den Pegasus, Sire, und Ihr wisst ihn meisterhaft zu lenken! Aber wie, Majestät, die Königin wollte reiten, obwohl sie dadurch Ihre Gegenwart entbehren musste? Sie wollte reiten, obwohl dieser Spazierritt zugleich eine Trennung von Euch war? Oh, wie kalt und egoistisch sind doch die Herzen der Frauen! Wäre ich ein Weib, würde ich mich niemals von Ihrer Seite trennen. Ich würde kein größeres Glück begehren, als neben Ihnen zu sein und dieser hohen und erhabenen Weisheit zu lauschen, die von Ihren gottbegeisterten Lippen strömt. Wäre ich ein Weib …«
»Graf, ich finde, dass Ihr Wunsch vollkommen erfüllt ist«, sagte John Heywood ernst. »Ihr macht durchaus den Eindruck eines alten Weibes!«
Alle lachten. Aber der König lachte nicht. Er blieb ernst und sah düster vor sich hin.
»Es ist wahr«, murmelte er, »sie schien sehr freudig erregt über diesen Spaziergang, und ihre Augen leuchteten mit einem Feuer, wie ich es selten bei ihr gesehen habe. Es muss also eine besondere Bewandtnis mit diesem Spazierritt haben! Wer begleitete die Königin?«
»Prinzessin Elisabeth!«, sagte John Heywood, der alles gehört und den Pfeil des Grafen sehr wohl gesehen hatte. »Prinzessin Elisabeth, ihre treue und geliebte Freundin, die niemals von ihrer Seite weicht! Außerdem ihre Hofdamen, die wie der Drache im Märchen die schöne Prinzessin bewachen!«
»Wer befindet sich sonst im Gefolge der Königin?«, fragte Heinrich finster.
»Der Oberstallmeister, Graf von Sudley«, sagte Douglas.
»Das war eine höchst überflüssige Bemerkung«, unterbrach ihn John Heywood. »Es versteht sich von selbst, dass der Oberstallmeister die Königin begleitet. Es ist ebenso sehr sein Amt, wie es das Eure ist, das Lied Eures Vetters, meines Papageis, zu singen.«
»Er hat recht! Thomas Seymour muss sie begleiten«, sagte der König hastig. »Und ich will es auch. Thomas Seymour ist ein treuer Diener, und er hat das von seiner Schwester Jane, meiner vielgeliebten und in Gott ruhenden Königin, geerbt: Dass er seinem König in unerschütterlicher Liebe zugetan ist!«
Die Zeit ist noch nicht gekommen, in der man die Seymours angreifen kann, dachte der Graf. Der König ist ihnen noch gewogen, er wird also auch ihren Feinden feindlich gesinnt sein. Beginnen wir also unseren Angriff gegen Henry Howard, das heißt, gegen die Königin.
»Wer begleitete die Königin außerdem?«, fragte Heinrich der Achte, während er in einem Zug den goldenen Becher leerte, als wolle er damit das Feuer kühlen, das bereits in ihm aufzulodern begann. Doch statt ihn zu kühlen, erhitzte ihn dieser feurige Rheinwein nur noch mehr. Er jagte das Feuer, welches in seinem eifersüchtigen Herzen entzündet worden war, in hellen Flammen zu seinem Haupt empor und ließ sein Gehirn wie sein Herz erglühen.
»Wer sie außerdem noch begleitete?«, fragte Graf Douglas leichthin. »Nun, ich denke, der Oberkammerherr Graf von Surrey.«
Der König zog die Stirn in finstere Falten. Der Löwe hatte seine Beute gewittert!
»Der Oberkammerherr ist nicht im Gefolge der Königin!«, sagte John Heywood ernst.
»Nicht?«, rief Graf Douglas. »Der arme Graf! Das wird ihn sehr traurig machen.«
»Und weshalb meint Ihr, dass ihn das traurig machen wird?«, fragte der König mit einer Stimme, die dem fernen Rollen des Donners glich.
»Weil Graf Surrey es gewohnt ist, im Sonnenschein der königlichen Gnade zu leben, Sire. Er gleicht jener Blume, welche ihr Haupt immer der Sonne zuwendet und von dieser Lebenskraft, Farbe und Glanz empfängt.«
»Möge er sich in Acht nehmen, dass die Sonne ihn nicht verbrennt!«, murmelte der König.
»Graf«, sagte John Heywood, »du musst dir eine Brille aufsetzen, um besser sehen zu können. Ihr habt dieses Mal die Sonne mit einem ihrer Trabanten verwechselt. Graf Surrey ist ein viel zu kluger Mann, um so töricht zu sein und sich, indem er in die Sonne blickt, die Augen zu verblenden und das Gehirn auszudörren. Er begnügt sich damit, einen dieser Planeten, die die Sonne umkreisen, anzubeten.«
»Was will der Narr damit sagen?«, fragte Graf Douglas verächtlich.
»Der Weise will Euch damit zu verstehen geben«, erwiderte John Heywood, jedes Wort scharf betonend, »dass Ihr dieses Mal Eure Tochter mit der Königin verwechselt habt und dass es Euch ergangen ist wie so manchem großen Sterndeuter: Ihr habt einen Planeten für eine Sonne gehalten!«
Graf Douglas warf einen finsteren, gehässigen Blick auf John Heywood, den dieser mit einem ebenso durchdringenden und zürnenden erwiderte.
Ihre Blicke stießen aufeinander und beide lasen in diesen Augen all den Hass und die Erbitterung, die in ihren Seelen gärten. Beide wussten, dass sie sich von dieser Stunde an eine gefährliche und glühende Feindschaft geschworen hatten.
Der König hatte nichts von dieser stummen, aber so bedeutungsreichen Szene bemerkt. Er blickte finster vor sich nieder und die Wetterwolken auf seiner Stirn zogen sich immer düsterer zusammen.
Mit einer heftigen Bewegung erhob er sich von seinem Sessel und bedurfte dieses Mal keiner helfenden Hand, um sich aufzurichten. Der Zorn war der mächtige Hebel, der ihn emporschnellen ließ.
Die Hofherren erhoben sich schweigend von ihren Sitzen. Außer John Heywood bemerkte niemand diesen Blick des Einverständnisses, den Graf Douglas mit Gardiner, dem Bischof von Winchester, und mit Wriothesly, dem Lordkanzler, wechselte.
»Ach, warum ist Cranmer nicht hier!«, sagte John Heywood zu sich selbst. »Ich sehe die drei Tigerkatzen schleichen. Es gibt also irgendwo eine Beute zu verschlingen! Nun, ich werde jedenfalls meine Ohren weit genug offen halten, um ihr Gebrüll hören zu können.«
»Die Tafel ist aufgehoben, meine Herren!«, sagte der König hastig, und die Hofkavaliere und diensttuenden Kammerherren zogen sich schweigend in den Vorsaal zurück.
Nur Graf Douglas, Gardiner und Wriothesly blieben im Saal. John Heywood schlich leise in das Kabinett des Königs und verbarg sich dort hinter der goldbrokatenen Portiere, die die Tür verdeckte, welche vom Arbeitszimmer des Königs in den äußeren Vorsaal führte.
»Meine Herren«, sagte der König, »folgt mir in mein Kabinett. Da wir uns langweilen, wird es am geratensten sein, uns zu zerstreuen, indem wir uns mit dem Wohl unserer geliebten Untertanen beschäftigen und über ihr Glück und das, was zu ihrem Heil gereicht, beraten. Folgt mir also, wir wollen eine Großratssitzung halten!«
Das Antlitz des Königs war fürchterlich anzusehen. Seine Augen blitzten in einem tückischen Feuer und um seinen Mund spielte jenes eigentümliche, grausame Lächeln, das wie die Blüte dieses zerschmetternden Zornes, der in seiner Brust loderte, nur dann auf den Lippen des Königs erschien, wenn er im Begriff war, ein Todesurteil zu unterzeichnen.
Die Gewitterwolke war bis zum Zerplatzen gefüllt und bereit, ihre zermalmenden Kräfte loszulassen. Es bedurfte also nur eines Gegenstandes, den man vernichten wollte, um sie zum Platzen zu bringen!
»Graf Douglas, Euren Arm!«, sagte der König. Während er sich auf ihn stützte und sich langsam dem Kabinett zuwandte, an dessen Eingang der Lordkanzler und der Erzbischof von Winchester auf ihn warteten, fragte er leise: »Ihr sagt, dass Henry Howard es wagt, sich immer in die Nähe der Königin zu drängen?«
»Sire, ich sagte das nicht! Ich meinte nur, dass er stets in ihrer Nähe zu sehen ist.«
»Oh, Sie meinen, dass sie ihn vielleicht dazu ermächtigt!«, sagte der König zähneknirschend.
»Sire, ich halte die Königin für eine edle und pflichtgetreue Gemahlin.
Ich würde auch geneigt sein, Euch den Kopf vor die Füße zu legen, wenn Ihr es nicht täten!«, sagte der König, in dessen Antlitz der erste Blitz der sich entladenden Zorneswolke aufzuflammen begann.
»Mein Kopf gehört dem König!«, sagte Graf Douglas ehrfurchtsvoll. »Möge er damit tun, was er will!«
»Aber Howard! Meint Ihr also, dass Howard die Königin liebt?«
»Ja, Sire, das wage ich zu behaupten.«
»Verdammt noch mal, ich werde diese Schlange unter meine Füße treten, wie ich es mit seiner Schwester getan habe!«, rief Heinrich wütend.
»Die Howards sind ein ehrgeiziges, gefährliches und heuchlerisches Geschlecht. Ein Geschlecht, das niemals vergisst, dass eine Tochter ihres Hauses auf Eurem Thron gesessen hat!«
»Ich werde es ihnen vergessen machen«, knirschte der König. »Ich werde diese stolzen und hochmütigen Gedanken mit ihrem eigenen Blut aus ihren Gehirnen fortwaschen! Sie haben also nicht genug an dem Beispiel ihrer Schwester gesehen, wie ich die Untreue zu bestrafen weiß! Es bedarf also für dieses übermütige Geschlecht noch eines neuen Beispiels. Nun gut, sie sollen es haben! Gib mir nur ein Mittel in die Hand, Douglas, nur einen kleinen Hebel, mit dem ich diese Howards aufhängen kann, und ich sage dir, ich werde sie daran auf das Schafott hinaufziehen! Gib mir Beweise für diese freventliche Liebe des Grafen, und ich verspreche dir, dir zu bewilligen, was du immer fordern magst!«
»Sire, ich werde diese Beweise liefern.«
»Wann?«
»In vier Tagen, Sire! Beim großen Wettkampf der Dichter, den Ihr zum Geburtstagsfest der Königin befohlen habt!«
»Ich danke dir, Douglas, ich danke dir«, sagte der König fast freudig. »Du wirst mich in vier Tagen von diesem lästigen Geschlecht der Howards befreit haben!«
»Sire, aber was, wenn ich diese Beweise, die Sie von mir fordern, nicht erbringen kann, ohne auch die Königin zu kompromittieren? Wenn ich, indem ich die Schuld des Grafen Surrey beweise, zugleich so unglücklich sein müsste, noch eine andere Person anzuklagen?«
Der König, der gerade die Tür seines Kabinetts überschreiten wollte, blieb stehen und sah dem Grafen starr in die Augen. Dann sagte er mit einem eigentümlichen, schauerlichen Ton: »Sie meinen die Königin? Nun, wenn sie schuldig ist, werde ich sie strafen! Gott hat mir sein Schwert in die Hand gelegt, damit ich es zu seiner Ehre und zum Schrecken der Menschen führe! Gerechtigkeit muss geübt werden, und wenn die Königin gesündigt hat, wird sie gestraft werden!«
Ende des ersten Bandes
Schreibe einen Kommentar