Der Spion Band 1 – Die Schlacht bei Jena – 6. Kapitel
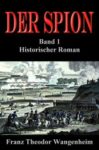 Franz Theodor Wangenheim
Franz Theodor Wangenheim
Der Spion
Band 1 – Die Schlacht bei Jena
Historischer Roman
Verlag von C. P. Melzer, Leipzig 1840
6. Kapitel
Im Haus des Hauptmanns von Wallen sah es feierlich genug aus, um auf etwas Außerordentliches zu schließen. Und so war es auch; denn der heutige Tag war zur formellen Verlobung der schönen Luise von Wallen und des Soldaten Wilhelm Weiß bestimmt. Nur seine beiden Kameraden, Schwarz und Wolfgang, sollten Zeugen bei dieser Feierlichkeit sein. Der Hauptmann wanderte schon vom frühen Morgen an im Haus hin und her. Alles wollte er ordnen und leider vermehrte er nur die Unordnung, denn was er anrührte, Gläser, Tassen, Tische und Stühle, er stellte es nicht anders als in Reihe und Glied wie eine Kompanie auf. Das Schlimmste bei der Sache war, dass er jetzt den braunen Hirsch nicht mehr besuchte. Zwar hatte Herr Dose nichts mehr zu befahren; jedoch war die Gesellschaft in seiner Weinstube dem Hauptmann nicht anständig und sein Verdruss über die Veröffentlichung der Geheimnisse des Kriegsministeriums wollte nicht verschwinden.
Obwohl der Herbst schon herangekommen war, so sah es in dem Gärtchen hinter des Hauptmanns Haus doch immer noch leidlich aus, zumal die Sonnenblumen auf den Rabatten dicht wie eine Grenadierkompanie im Parademarsch standen.
Sie waren des Hauptmanns Lieblinge, denn ihre Höhe zeichnete sie vor allen anderen Blumen aus. Als schritte man durch eine Allee, so standen sie zu beiden Seiten des kurzen Weges zu dem mit Schilfrohr gedeckten Gartenhäuschen, dessen Wände aus unbehauenen Eichenästen bestanden und ihm das Ansehen einer Einsiedelei in einer wildromantischen Gegend gaben. Höchst selten nur betrat der Hauptman dieses Asyl der Selbstbeschauung; nur in der letzten Zeit, da er dem braunen Hirsch so gram geworden war, hatte er das Gartenhäuschen seiner Aufmerksamkeit wert gefunden. Der Hauptmann beschäftigte sich eben, den gelben Sand in dem Weg zu dem Gartenhäuschen mit einem Rechen in Taschenformat zu kräuseln; aber auch hier entstanden nur Figuren für die Kriegswissenschaft; gerade Streifen, Karees, Schachtbrettformen und dergleichen mehr. Er schien das nicht zu bemerken, denn er summte einen Parademarsch aus dem Siebenjährigen Krieg vor sich hin. Aber in dem Gartenhäuschen waren die Frauen desto aufmerksamer bei der Anordnung eines knapp zureichenden Tisches und der dazu nötigen Dinge. Luise, wie anspruchslos sie auch gekleidet war, gewann ihrer Mutter das stumme Bekenntnis ab, dass sie keiner Schönheit in Berlin nachstände; und welch Wunder, dass bei der häuslichen Beschäftigung auch manches Wörtchen über Wilhelm fiel!
Die beiden Frauen sprachen mit solcher Begeisterung von ihm, dass ein Ungeweihter in Zweifel geraten musste, welche die Braut wäre.
Nun trat der Hauptmann zu ihnen ein; er rückte die Pelzmütze auf das linke Ohr, kraulte sich hinter dem rechten und stand wie eine Ordonnanz, den Rechen haltend, da er die Worte hervorbrachte: »Riekchen, mir ist etwas warm geworden; aber der Garten macht sich ausnehmend schön.«
»Einen Augenblick Geduld, lieber Mann«, entschuldigte sie sich, da sie eben eine Serviette knickte, »ich will sogleich sehen, was du Schönes gemacht hast!
»Für wen soll die Serviette sein?«
»Für Wilhelm.«
»Gib sie mir; ich kann einen Offiziershut legen, das ist eine gute Anspielung.« Er gab sich Mühe, die Figur herauszubringen. Ohne es zu wissen, sprach er für sich weiter: »Es kann nicht fehlen … jung, kräftig … hat Mut wie ein Löwe … schlägt eine gute Klinge … weiß die Feder zu führen … hat Geld … es kann nicht fehlen. Da, er ist fertig. Siehst du, ein Offiziershut!«
»Wahrhaftig!«
»Ja, ja, als wir noch junge Leutchen und bei irgendeinem Stabsoffizier auf einen leckeren Bissen geladen waren, da war dieses meine Passion. Es konnte mir dies auch keiner nachmachen. Der Wilhelm soll es aber aus dem Fundament lernen, denn der Wilhelm begreift sehr gut. Mutter, ich sage dir, die anderen beiden stehen gegen ihn wie die Sägeböcke! Was exerziert der Bursche gut; hätte nie gedacht, dass ein Bücherwurm ein so guter Soldat werden könnte. Der Prinz wird seine Freude an ihm haben! Der Prinz ist des großen Friedrichs Bruders Sohn; tapfer wie keiner, ein Löwe, sage ich dir! Nun, es wird wohl hart hergehen, aber der ist noch nicht Soldat, der mit dem Tode nicht um ein Auge gewürfelt. Luise«, wandte er sich befremdet zu der Tochter, welche sich an der Lehne eines Sessels hielt. »Luise, was sehe ich? Du weinst? Bist die Tochter des Hauptmanns Wallen und weinst, wenn für deinen Bräutigam der Weg zur Ruhm und Ehre sich öffnet? Bah! Bah Luise! Hatte das von dir nicht erwartet. «
»Lieber Wallen«, bat die Mutter, indem sie Luise in die Arme schloss. Aber er war damit nicht zur Ruhe zu bringen.
»Ei, was soll denn auch das Weinen? Soll ihm das Mädel das Herz weich machen? Wer weiß, ob er sich bei dem Prinzen nicht insinuiert, und eins, zwei, drei ist er Adjutant; da sagt denn der Prinz, er soll die Ordre durch den dichtesten Kugelregen tragen, links, rechts, hinten und vorn fallen die Leute wie die Fliegen, er stutzt, denkt an die Luise zurück und anstatt sich mit seinem Bild im Herzen getrost in das Mordgewühl zu stürzen, reißt er das Pferd zurück – nein, in Teufels Namen, der Junge ist zu brav, als dass ihm Luise mit ihren Tränen den frohen Kriegermut aus dem Herzen wasche!«
»Bitte, bitte, lieber Vater, vergeben Sie Ihrer Luise die augenblickliche Schwäche. Ich will stark sein, will ihm des Himmels besten Segen erflehen, wenn er von mir geht, und meine Liebe wird ihn schützend umschweben.«
»So mag ich’s leiden; siehst du, das klingt noch wie aus dem Mund der Braut eines preußischen Soldaten.«
»Und der liebevolle Vater im Himmel wird mein Flehen erhören; er wird mir den Geliebten erhalten …«
»Wenn die Hoffnung nicht wäre, meine Tochter, wie groß müsste die Verzweiflung sein!«
»Aber eine Bürgschaft! Bürgschaft für diesen schützenden Schild gegen Verzweiflung!«
»Luise?!« Der Hauptmann stand erschrocken. »Luise! Deine Wange glüht plötzlich und dein Auge irrt unstet!«
Die Mutter, aufgeschreckt von des Hauptmanns starrem Blick, von seinem Benehmen – denn der Rechen war seiner Hand entglitten und beide Arme
hingen kraftlos herab – erfasste der Tochter Hand und forschte in den lieben Zügen.
»Luise!«, rief sie beängstigt. »Was ist dir, mein Kind?! Eine furchtbare Ahnung dämmert auf in meiner Seele! Ist mir doch, als ob durch die heilige Stille der Nacht die verzehrende Glut auftaucht über den friedlichen Hütten frommer Menschen. Luise! Luise, du willst Bürgschaft für dein Hoffen? Von dem allliebenden Vater droben willst du Bürgschaft für deine Liebe?«
»Ich erkenne das, teure Mutter«, raffte sich Luise zusammen; aber das plötzlich zu Tode blasse Gesicht strafte die scheinbare Fassung Lügen.
»Es ist wahr, die Liebe kann uns leicht zur Sünde gegen Gott verleiten.«
In des Hauptmanns Kopf wirbelte es wunderbar durcheinander, doch dem alten Soldaten konnte nur auf wenige Augenblicke die Fassung fehlen und bald war er wieder entschlossen: »Friederike, geh ins Haus, empfange die Gäste! Es ist mein Ernst, dass du gehst!«
Wenn der Hauptmann in diesem diktatorischen Ton sprach, dann war unbedingtes Folgeleisten das Einzige, was ihn beruhigte. Mit schwerem Herzen entfernte sich die Mutter; denn das Wort des Mannes ist stets zu rau für wundes weibliches Gemüt. Der Hauptmann setzte sich nieder, sein Wink befahl der Tochter, ein Gleiches zu tun. Er räusperte sich einige Mal, legte dann beide Hände auf die Knie und sprach mit vielem Bedacht: »Wir sind allein. Es gibt Dinge, welche das Ohr eines Dritten scheuen und wäre es auch die Mutter. Sieh, meine Luise, ich bin alt, bin ein abgenutzter Stumpfen in dem großen Verein, welchen man Staat nennt, aber das Bewusstsein, redlich das meine getan zu haben, ist für mein altes Herz eine bessere Krücke als die vom stärksten Holz für den Lahmen. Weißt du auch, was es bedeutet, wenn ich sage, dass ich redlich das meine getan habe? Ich habe Gut und Blut, Leib und Leben für das bedrohte Vaterland eingesetzt. Was wäre ich, wenn ich das nicht getan hätte? Wallt dein jugendliches Herz nicht im verzeihlichen Stolz auf, wenn die Leute sagen, der alte von Wallen ist der Vater dieses Mädchens, der alte von Wallen hat unter des großen Friedrichs Fahnen den ganzen Siebenjährigen Krieg mitgeschlagen, das Mädchen ist die Tochter des alten Wallen. So sprechen die Leute, wenn von meiner Luise die Rede ist und sie setzen voraus, dass die Tochter eines solchen Vaters auch tugendhaft sei, ebenso gut wie ihr Vater ein würdiges Mitglied des Staates. Wer aber war es, der meiner Luise diesen Nimbus bereitet? Der Krieger, der bei Hochkirch lahm geschossen wurde. Nicht nur eine Mutter des Altertums konnte dem einzigen Sohn zurufen: mit dem Schild, oder auf ihm! Auch Preußen kann solche Mütter aufweisen, denn der ehrenvolle Tod auf dem Schlachtfeld erhebt sie selbst in der Achtung der Menschen, in der Achtung des Vaterlandes, für welches ihre Söhne das Herzblut hergegeben.«
»O, mein Gott!«
»Und du jammerst bei dem Gedanken schon, dass dein Bräutigam den Ehrentod sterben könne? Dachte immer, meine Luise empfände groß und edel; aber …«
»Vergebung, mein Vater, Vergebung, wenn in diesem Herzen der Kampf widerstrebender Gefühle noch nicht ausgeglichen! Aber, aber … ich will stark sein, groß und edel denken … man muss sich darin nur üben, mein Vater; Übung tut viel.«
»Mädchen!« Der Hauptmann lehnte sich zurück und hielt den Bart mit der hohlen Hand bedeckt. »Was sprichst du da! Weißt du auch, dass jedes deiner Worte wie ein Donnerschlag in meine Vaterherz fällt? Du willst groß und edel denken lernen? Und wann hätte meiner Luise Blick den ihres Vaters gefürchtet? Leibhaftiges Schuldbewusstsein spricht sich in diesem am Boden haftenden Auge, diesem Schmerzenszug um den Mund, diesem bangen Atmen aus! Fluch über meinen Wankelmut! Es taugt nicht! Es taugt nicht!«
So schnell wie es ihm die Jahre und der linke Fuß erlaubten, wollte der Hauptmann davon, aber Luise hielt ihn. Sie presste das plötzlich wieder hoch gerötete Gesicht an des Vaters Brust. Doch weder Wort noch Tränen erleichterten da beschwerte Herz.
»Das siehst du ein.« Der Hauptmann blickte mitleidig auf sie hernieder. »Aber es ist nun einmal nicht anders und ich schäme mich der Reue, denn sie verrät Schwäche, Luise.« Er zog sie sanft neben sich auf einen Stuhl. »Luise, ich will dir einmal etwas erzählen. Du kennst doch — nein halt — das hat Zeit. Dein Wilhelm berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Du kennst den Krieg nicht, du weißt nicht, wie man da kühn das Glück bei der Stirn erfasst. Also, ich sehe Wilhelm, hoch zu Ross, stattlich gerüstet, das Auge hell und leuchtend, nach drüben gerichtet, wo der Feind in großer Masse steht. Die ganzen langen Kolonnen hinunter läuft es blitzend und der Tod fliegt her und hin, kaum dass er seiner Arbeit Herr zu werden vermag. Der Feldherr, sei es der König eben, sieht mit hohem Ernst in das Kampfgefilde, erteilt Befehl auf Befehl, die Adjutanten auf flüchtigen Rossen tragen den Befehl mit Sturmeseile und plötzlich speit das Preußenheer Vernichtung in den Feind. Der schließt ein Karree nach dem anderen, nach allen vier Seiten hin zeigt es die langen Bajonette wie die Zähne des fletschenden Wolfs. Da dreht der König das ehrwürdige Haupt nach unserm Wilhelm und spricht mit Huld und doch dringend: ›Weiß, Sie suchen Gelegenheit, sich auszuzeichnen; da ist sie!‹ Und der König zeigt auf eines von den Karrees. Denkst wohl, es werde da viel gesprochen? Beileibe! Wie der Blitz zündet des Königs Wort in der Brust des jungen Kriegers. Mit einem Hurra und hoch geschwungenem Säbel jagt er an die Spitze des Reiterregiments und fort geht es, dass die Erde dröhnt unter dem vielfachen Hufschlag. Das Karree ist still wie das Grab, vielfach starren die Bajonette gegen die Brust der herandonnernden Rosse! Was tut es? ›Mir nach!‹, ruft Wilhelm den nächsten Kameraden zu und laut in seiner Brust, doch nur von Gott gehört, klingt es wie Siegeston Luise! Und über die Bajonette hinweg, trotz Kugel und Kolbenschlag, setzt das flinke Ross mit seinem Reiter, die treue Klinge zischt auf der Feinde Nacken …!«
»Vater! Vater! Wollust, wenn ich es denke…!«
»O, das ist noch nicht alles, Tochter! Der König ist Sieger. Alle Regimenter stehen unterm Gewehr, dem Himmel wird aus vieler Tausende Mund der laute Dank gezollt und es wird wieder still. Da ruft es denn vor dem einen Reiterregiment: ›Wilhelm Weiß!‹ Er reitet vor die Front, sein König erwartet ihn da, dankt ihm im Namen des Vaterlands für die bewiesene Tapferkeit, nimmt von der eigenen, edlen Brust den blitzenden Orden …!«
»Nicht weiter, mein Vater, nicht weiter!«, unterbrach ihn Luise, und es war Zeit, denn auch seine Stimme bebte vor Hochentzücken, da er das Bild hervorzauberte. Er fuhr mit dem Ärmel über die Augen, dann begann er ernst: »Du empfindest das, meine Luise und, Gottlob, dass du es empfindest. Nun ist mir nicht mehr bange, dass einst … was wollte ich doch sagen? Ja doch … es will nur nicht recht passen — Kennst du … Kennst du das Lied von der liebenden Leonore?… Du wirst blass?… Meine Luise«, schloss er sie in die Arme. »Geduld, Geduld, wenn das Herz auch bricht; mit Gott im Himmel hadere ich nicht! Mehr weiß ich nicht, mehr sage ich nicht! Jetzt suche deine Mutter.«
Der Hauptmann billigte der sich Entfernenden gedankenvoll nach; er war sehr verstimmt geworden. Die Entdeckung aber, dass Luise mit so großer Schwärmerei liebte, brachte ihn zu dem Entschluss, unter keiner Bedingung den Abschied unter vier Augen zu gewähren. »Man kennt das«, eiferte er vor sich hin, » da verschwören sich die jungen Leute hoch und heilig, sind halb von Sinnen und meinen steif und fest, die Liebe müsse über den Tod hinaus dauern. Auch mich regt es sonderbar an, wenn ich denke, dass eine französische Kugel – pah, das sind dumme Gedanken; nicht alle Kugeln treffen. Aber es sollte mir doch Leid tun, habe den jungen Menschen in der kurzen Zeit so lieb gewonnen, dass ich ihm das Mädchen lieber heute als morgen in die Arme legte, aber erst ins Feld, bewiesen muss werden, dass er das Herz auf dem rechten Fleck hat und dann – wie es Gott gefällt. Ja, wie es Gott gefällt! Dass der Junge nicht von Adel ist, das ist nicht seine Schuld, aber wenn er keine Courage hätte …? Dann aber noch einmal, wie kommt mir das in den Sinn? Nein, ich will nicht fluchen, will lieber beten, dass ihm der Himmel Mut verleihe: Lieber Gott, höre den alten Hauptmann von Wallen endlich einmal wieder. Ich komme selten zu dir. Es gibt so viele Leute, die dich täglich belästigen. Nimm dich des Wilhelm Weiß mit väterlicher Huld und Gnade an, gibt ihm Mut. Ist er für diese Gabe nicht empfänglich, so erspare mir die Schmach, dass er mein Eidam wird. Schicke, aus Mitleid für mich, ihm eine Kugel zum Herzen! Das soll mir ein zuverlässiges Zeichen sein. Fällt er unrühmlich, so war er mein Kind nicht wert. Fällt er, dass sein Ruhm ihn überlebt, so wollen wir ihn ehrlich bedauern und meine Luise soll ihm als Jungfrau folgen. Aber kommt er zurück, mit Ehren bedeckt zurück – na, du verstehst mich, Herr und Gott! Amen!«
Bei diesem sonderbar abgefassten Gebet hattet der Hauptmann doch die Hände gefaltet und die Pelzmütze steckte unter dem linken Arm. Kaum hatte er das Amen gesprochen, so eilten schon die Gäste herbei. Sie waren in nicht geringen Erstaunen, den Hauptmann in der andächtigen Stellung zu überraschen.
Die Gegenwart des geliebten Mannes verwischte in sehr kurzer Zeit die Trauer aus Luise Zügen. Sie wurde sogar heiterer, als man gewohnt war, sie zu sehen. Der Hauptmann blieb an diesem Tag stets der schärfste Beobachter und zuweilen war es ihm, als ob Luise den Frohsinn erkünstelte, um ihre wahres Empfinden zu verbergen. Wenn der Hauptmann, im Redefluss über Kriegsgeschichten, die jungen Soldaten im Blick hatte, Luise sich unbemerkte wähnte, dann suchte sie der teuren Mutter Hand. Der leise, innige Druck derselben, verstohlen zwar, ermutigte die Tochter mehr als alle Bilder, welche der Vater aufzustellen vermochten.
Die vier Männer, die jüngeren, waren ja schon von ihrer neuen Laufbahn exaltiert, wurden durch den Genuss des guten alten Rheinweines noch mehr belebt. Ehe man sich dessen versah, war der Hauptgegenstand des Familienfestes in den Hintergrund getreten. Der Veteran hatte das Wort und es drehte sich um Krieg.
»Sie werden noch nicht vergessen haben«, überzeugte er die drei, »dass der Braunschweiger sie einst mit so großer Verachtung behandelt hatte. Ihr habt vielleicht davon gelesen, doch was es in diesem Krieg bedeutet, das könnt ihr nicht wissen. Darum sage mir keiner, dass er zum Hohenloheʼschen Korps wolle, der Braunschweiger ist dem Fürsten gram – wegen des Rückzuges aus der Champagne, und ich kann es dem Alten nicht verdenken. Der Fürst widersprach ihm heftig im Kriegsrat, wollte durchaus eine Schlacht wagen, sich der Stadt Chalons mächtigen und was der Dinge mehr waren, die sich leichter im Kriegsrat sprechen als im Feld ausführen lassen, genug, der Braunschweiger drang durch, obwohl der Fürst selbst den König auf seiner Seite hatte. Preußen war durch diesen Rückzug gerettet. Aber der Groll zwischen den beiden Feldherren ist so tief ein gewurzelt seit jener Zeit, dass – nun ihr wisst meinen Bescheid. Zum Prinzen sollt ihr nun zwar morgen schon, wenn nicht schon früher …«
»Morgen?«, fragte es gedämpft von den Frauen her.
Das Wort zog die Aufmerksamkeit der Männer wieder von der kriegerischen Unterhaltung. Wilhelm dankte mit einem vielsagenden Blick für Luises Teilnahme und wie der Hauptmann ihn auch zu fesseln versuchte; der Soldat, welcher mit den ungezwungenen Wesen des neuen Standes auch die feine Sitte zu verbinden wusste, hatte bald Mittel gefunden, seinen Platz zu verlassen und ihn zwischen Mutter und Tochter einzunehmen. Wie dieses Manöver auch den Hauptmann überraschte, er fand für gut, es in einen Scherz zu verwandeln. In kurzer Zeit war der eigentliche Akt, welcher hier stattfinden sollte, beendet. Ein langer Kuss – er schien kein Ende nehmen zu wollen – war das Siegel auf den Pakt, der für Leben und Tod gelten sollte.
»Leben und Tod?«, fragte der Hauptmann. »Was soll das? Man muss den Teufel nicht an die Wand malen und mit jenen unheimlichen Gewalten, die über des Kriegers Haupt am nächsten schweben, nicht gewagtes Spiel treiben. Es ist noch nicht erwiesen, ob das Vermessene in dem Wort nicht von unerbittlichen Händen aufgefangen und vor den Thron jener dunklen Macht, dem mit Zufall und Vorsehung vereint das Wort straft, getragen wird. Ihr seid jung, habt dergleichen noch nicht selbst erfahren; doch hört die Geschichte aus meinem Soldatenleben und denkt derselben nach.
Kaum drei Wochen vor jener unglückseligen Nacht bei Hochkirch saßen wir in einem Bauernhaus und spielten. Das Würfeln war gang und gäbe zu jener Zeit. Wir waren unserer Zehn da im Quartier; es verlautete schon, dass der Feldzug für dieses Jahr bald als beendet anzusehen wäre, denn der Oktober nahte mit starken Schritten heran. Es war einer unter uns, der schon mehrmals Zehn geworfen hatte und stets im Verlust. Wie es zu gehen pflegt, so ging es auch hier; um ihn über den Verlust im Spiel zu trösten, schmeichelte man ihn mit dem Glück in der Liebe. Er aber wurde ernst und versetzte darauf: ›Freue sich, wer mag, dass es in die Winterquartiere geht. Ich habe so wenig Glück in der Liebe wie im Spiel.‹
Ein Wort gab das andere, die Würfel wurden vergessen, wir waren samt und sonders jung und – Liebesgeschichte blieben im Schwange. Die Reihe des Erzählens war mir. Ich wusste nichts – auf Ehre, Friederike, ich wusste nichts. Dicht neben mir saß Halm, der unglücklichen Spieler. Ich musste ihn erinnern, dass wir von ihm eine Erzählung begehrten, mit Recht begehren durfte, indem er die Ursache der nunmehrigen Unterhaltung wäre. Nach einigem Zögern gab er sich denn. ›Mein Unglück … begann er … ist die Zehn. Sie waltet grauenvoll durch mein ganzes Leben und was man auch von der Dreizehn sagen mag, sie ist mir niemals so furchtbar geworden, wie die sonst so gutmütige Zehn. Mein Vater wurde am 10. Oktober, also des zehnten Monats des Jahres 1710 geboren, meine Mutter zehn Jahre später, an demselben Tag und, sonderbar genug, beide um zehn Uhr abends. Ich bin der Jüngste von zehn Kindern und bis 19. Geburtstag herangekommen war, hatte mich noch kein Unglück betroffen. Da aber starb mein Vater. Sein Geburtstag war in der alten Hausbibel bemerkt, sein Todestag sollte dabei geschrieben werden; wie sehr waren wir erstaunt, da die beiden zusammentrafen! Von jener Zeit an fürchteten wir stets den Zehnten des Oktobermondes und mit Recht, denn er stellte sich so sonderbar ein, dass ich noch der Einzige bin, welcher von der zahlreichen Familie übrig geblieben ist.‹
Einige von uns schüttelt ungläubig den Kopf, andere sagten unverhohlen, dass Halm sich die Geschichte ausgedacht habe. Er aber versicherte mit solchem Ernst die Wahrheit, dass allen die Lust zum Widerspruch verging.
›Ihr seht selbst‹, fuhr er dann wieder fort, ›wie mich heute beim Spiel die Zehn verfolgte und ich möchte wetten, wenn ich die Würfel in die Hand nehme, dass ich wieder dieselbe Zahl treffe.‹
›Das ist nichts‹, rief ein anderer. ›Ich will werfen und du wettest. Hältst auf meinen Wurf!‹
›Ja, ja‹, mischte sich sogleich ein Dritter ein. ›Ich halte dagegen!‹
Die Sache ging vor sich. Halm zog sein Geldbeutelchen und mit ihm ein kleines Medaillon, welches ein weibliches Porträt in einem goldenen Rähmchen zeigte. Es war in der Tat die eigenste Erscheinung von der Welt, dass derjenigen, auf welchen Halm parierte, stets Zehn war und der mögliche unglückliche Spieler gab mit bitterem Triumph den letzten Rest aus seinen Geldbeutelchen her.«
»Heda! Wilhelm!«, rief der Hauptmann so laut und so plötzlich, dass der Liebende heftig erschrak. »Was hatte das zu bedeuten? Warum die drei Finger?«
»Ich … Ich gelobte meiner Braut, dass ich nur im Tode erst diesen feinen Goldreif, den freie Wahl und reine Liebe mir an den Finger gesteckt haben, lassen würde. Er ist unscheinbar für den Raub für die Raublust; vielleicht bleibt er mir auch dann noch.«
»Ei, so wollte ich …!« Der Hauptmann trank im großen Verdruss zwei Gläser Wein. »Da erzähle ich mit aller Mühe, und ich will meinen Kopf gegen eine Passkugel verwetten, wenn der Junge weiß, wo wir damals saßen!«
»Am Tisch, am Tisch!«, rief Wilhelm.
»Nun, ich will es dieses Mal gelten lassen. Doch wenn du ferner nicht aufpassen willst, so gehe ich mit Schwarz und Wolfgang ins Haus. Du sollst sehen, die Mutter begleitet mich und du magst hier in der kühlen aber Abendluft – ja wahrhaftig, meine Pelzmütze, Friederike, gib sie herüber.«
Wie der Hauptmann seine Drohung dem festen Vorsatz anpasste, beweist hinlänglich, dass er nicht mehr so recht taktfest war. Wolfgang und Schwarz, recht gut um den geheimen Wunsch des Freundes wissend, waren von diesem Augenblick an so emsig bemüht, des Hauptmanns Aufmerksamkeit von Wilhelm auf sich zu lenken, dass der gute Alte nicht wusste, wie er in die ominöse Geschichte Halmʼschen Zehn wieder hineingeraten war. Am Anfang haperte es mit der Fortsetzung; jedoch die Beschreibung des weiblichen Porträts auf dem Medaillon war so feurig, als wäre der Erzähler ein Verehrer jener himmlischen Auguste gewesen.
»Und dieses Bild«, rief der Hauptmann, »dieses Bild mit dem goldenen Rähmchen, Halms ganzer Reichtum außer seinem Degen und seinem Namen, sollte er gegen eine Handvoll Friedrichsdʼor setzen! Der gefühlvollere Teil der Gesellschaft opponierte sich dagegen, doch er, blass wie der Tod, sprach mit Eiseskälte: ›Es ist am 10. Oktober jüngst ein Jahr, das mir Auguste dieses Bild schenkte. Verliere ich es heute schon, so ist der Fluch der Zehn gelöst – ich wage es darauf hin.‹
Die Würfel klapperten im Becher, dahin rollten sie, Halm hatte gewonnen.
›Gelöst! Gelöst!, rief es durcheinander. ›Bruderherz, der Fluch der Zehn hat seine Kraft verloren!‹
Aber statt sich zu freuen, winkte Halm Schweigen. Er tat so feierlich, dass man ihn anhören musste. ›Liebe Freunde‹, erzählte er weiter, ›als mir Auguste das Bild reichte, sagte sie dabei: Freund, ich weiß denn nichts Besseres zu geben, als mich selbst. Nicht Eitelkeit ist es, die mich dazu bestimmte, auch wirst du mein ohne dieses Bild gedenken; aber es ist heute dein Unglückstag, hast nichts mehr zu verlieren auf dieser Welt als mich, die erst dein wurde, und dich. Das Letztere kannst du nicht, denn mit dem Ehrentod verliert sich der Ehrenmann nicht. Dieses Bild soll mir ein gutes Zeugnis sein, dass ich dich einst wieder liebend umfange. Ein Jahr sollst du es tragen und ist das vorüber und du und das Bild und ich, wir sind noch wie jetzt, dann sei es mir Bürge für eine glückliche Zukunft. Freunde‹, schloss Halm, indem er sich zum Aufbruch anschickte, ›der Zehnte des zehnten Monats ist noch nicht heran. Es will nicht von mir weichen, das Bild. Die unglücksehende Macht, der ich verfallen bin, fesselt es an mich, und sie wird den Trauerzoll unerbittlich fordern.‹
Es wagte keiner ihn zurückzuhalten. Der und jener schüttelte den Kopf; wir konnten uns eines gewissen Grauens nicht erwehren.«
»Horcht!«, unterbrach Wilhelm den Erzählenden. »Hört ihr nicht?« Er war plötzlich wie eine Leiche und sein Arm umfasste die Braut wie mit verzweifelter Kraft.
»Still! Still!«, rief der Hauptmann, »damit ich nur das Ende …!«
»Nein, nein; es ist Zeit!«, fuhr Wilhelm in die Höhe. Doch in demselben Augenblick beugte er sich über die bang atmende Braut und die blassen kalten Lippen der Liebenden begegneten einander, als ob es in den Eisbergen glühend daher leuchtet.
Eben hatte der Hauptmann den Tod des armen Halm am 10. Oktober erzählt, fügte noch hinzu, welches Unglück die Preußen am 14. Oktober bei dem Überfall bei Hochkirch ereilt hatte. Da rasselten die Trommeln den Generalsmarsch durch die nächsten Straßen. Der Hauptmann, als ob ihm ein elektrischer Funken durchzuckt hätte, stand kerzengerade vor den Liebenden. Einige Sekunden haftete sein Blick auf ihnen, dann suchte er vergeblich seine Rührung in den Worten Es muss geschieden sein zu verbergen.
Luise hing an des geliebten Mannes Hals.
»Treu dir bis in den Tod!«, schluchzte sie.
»Und darüber hinaus!«, hob Wilhelm die drei Finger nach oben, wenn es menschenmöglich!«
Die Mutter empfing die Tochter in ihre Arme. Wohltätig umhüllte das Unbewusstsein die Seele der verlassenen Braut. Noch einen Blick, noch einen Kuss! Eisernes Geschick, warum so karg mit dem Tropfen Süße vor so langen, so dauernden Schmerz?
Rasch ging es nun durch die Sonnenblumen. In der Mitte des Weges blieb der Hauptmann wie angewurzelt stehen.
»Klang das nicht gerade«, murmelte er, die Augen krass aufgerissen, »wie Mutter, Mutter, hin ist hin!« Er wollte zum Gartenhaus zurück, doch festen Schrittes setzte er seinen Weg fort. »Nein, erst dem Vaterland die hochherzigen Söhne und dann … dann.« Die letzten Worte sprach er wie mit leisem Weinen. »Dann zu der verzweifelten Braut zurück!«
Schreibe einen Kommentar