Addy der Rifleman – Der rote Hahn
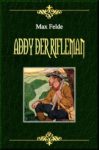 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Der rote Hahn
Fast ein Vierteljahr war ins Land gegangen. Auf den Farmen entlang dem Mohawk begann man wieder freier aufzuatmen.
Nun kannte man auch den Plan, welcher der englischen Invasion nach den Gebieten des Hudson und Mohawk zu Grunde gelegen hatte, bis ins Einzelne.
General Bourgoyne, der schon Ende Juli nach dem Süden aufgebrochen war, hatte die Absicht, sich mit dem von New York heranrückenden General Clinton zu vereinigen. Sie beide wollten dann nichts Geringeres bezwecken, als die Neu-England-Staaten von der unter Washington stehenden Freiheitsarmee und jede Verbindung mit dem Kongress abzuschneiden.
Aber es war, dank den treffsicheren Büchsen und sehnigen Fäusten der Milizen, doch anders gekommen.
Als im Mohawktal durch Addy die Nachricht bestätigt wurde, dass Bourgoyne den Marsch von St. Johns aus in der Tat angetreten habe und den Oberst St. Leger mit mehr als tausend Huronen unter Führung ihres Häuptlings Thayendanegeas auf das Mohawktal loslassen würde, da war es Herckheimer sofort klar, dass es zunächst auf den Fall des Forts Stanwix abgesehen sei. Dies musste unter allen Umständen vereitelt werden, denn mit der Einnahme dieses befestigten Punktes war der Weg für St. Leger bis hinab an die Mündung des Flusses so gut wie frei und das blühende Tal dann der Vernichtung preisgegeben.
Nun, der Leser weiß ja bereits, dass Herckheimer sich mit seiner Brigade sofort dem Feind entgegenwarf, um ihn nicht erst an den Mohawk gelangen zu lassen.
Das blutige Treffen, zu dem es dann bei Oriskany kam, aus dem Zusammenhang der Geschichte gerissen, kann ja keineswegs als ein großes kriegerisches Ereignis bezeichnet werden, doch waren die Folgen unter allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet unberechenbare. Hätte General Herckheimer nicht den Entschluss gefasst, den Feind aufzusuchen und wäre es ihm nicht gelungen, ihm eine entscheidende Niederlage beizubringen, würden weitaus überlegene Streitkräfte ins Mohawktal hereingebrochen sein. Und wer kann sagen, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wäre es St. Leger gelungen, bis an die Mündung des Flusses vorzudringen und dort den Milizen, die sich eben anschickten, den Bourgoyneschen Kolonnen entgegenzutreten, in die Seite zu fallen. Die tapferen Bauern vom Mohawk hatten also nicht allein für Haus und Hof gekämpft, ihre Frauen und Kinder vor dem Tomahawk und dem Skalpmesser bewahrt, sondern für das ganze Land geblutet und damit den Weg zur Begründung der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten nach besten Kräften geebnet.
Und noch einmal, wenige Wochen nach dem Treffen bei Oriskany, gab es im Mohawktal die größte Bestürzung.
Man erfuhr, dass Bourgoyne neben mehreren größeren Indianerhorden über 9000 Mann verfügte, mit denen er sich zunächst gegen das nördlich des Mohawk gelegene Fort Eduard wandte. Der amerikanische General Schuyler, der um jene Zeit dieses Fort besetzt hielt, vermochte der anrückenden Übermacht nicht zu widerstehen und zog sich über den Hudson nach Saratoga zurück, indem er zugleich alle auf dem Fluss vorhandenen Schiffe zerstörte und dem Feind auch sonst viele Hindernisse in den Weg legte.
Nichtsdestoweniger lag die Gefahr, dass feindliche Truppen, diesmal von Norden und Osten her ins Tal brechen würden, aufs Neue nahe und man beruhigte sich erst, als die Nachricht eintraf, dass die amerikanischen Milizen einem Teil der Bourgoyneschen Truppen in der Nähe von Bennigton eine empfindliche Niederlage beigebracht hatten.
Bourgoyne fand nämlich auf seinem Vormarsch so viele Schwierigkeiten vor, dass es um die Verproviantierung seiner Truppen bald recht herzlich schlecht stand. Da er wusste, dass die Amerikaner in Bennigton große Vorräte an Nahrungsmitteln und Kriegsmaterial gesammelt hatten, sandte er eine größere Kolonne seines Heeres unter dem Kommando des Obersten Baum dahin.
Mittlerweile hatten sich aber auch in diesem Distrikt einzelne Indianerhaufen sengend und mordend eingefunden und dadurch den zahlreichen Kolonisten die Büchse in die Hand gedrückt. Sie ließen Haus und Hof im Stich, fanden sich unter Oberst Stark zu einer wohlorganisierten, wohl an 13.000 Mann starken Miliztruppe zusammen. Diesen streitbaren Männern war es gelungen, den Engländern den schweren Schlag bei Bennigton beizubringen. Bourgoyne hatte an diesem Tag den Verlust von nahezu 700 Mann, darunter viele Offiziere, mehrere Geschütze und sonstige Kriegsbeute, zu beklagen.
Selbstverständlich hatten auch diese Kolonisten nicht versäumt, ehe sie Haus und Hof verließen, alle Lebensmittel und das vorhanden gewesene Vieh zu verstecken, zu vernichten oder unbrauchbar zu machen. Dadurch wuchsen für Bourgoyne die Schwierigkeiten.
Gleichwohl ging er über den Hudson und nach mehreren kleineren, aber heftigen Kämpfen kam es am 7. Oktober zur Entscheidungsschlacht, die mit einer derartigen Niederlage der Engländer endete, dass sie sich völlig erschöpft wieder auf Saratoga zurückzogen.
Aber die Amerikaner wollten das Eisen schmieden, solange es heiß war. Sie folgten Bourgoyne auf dem Fuß und setzten ihm unter der Führung des mittlerweile zur Unterstützung herbeigeeilten Generals Gates so hart zu, dass sich der englische Oberbefehlshaber endlich zur Kapitulation genötigt sah.
Nun atmete man im ganzen Nordosten der heutigen Vereinigten Staaten freier auf. Nun durfte man hoffen, dass die Kriegswirren ein Ende hatten, dass die drückende und darum verhasste englische Herrschaft so gut wie abgeschüttelt war.
Nun war man auch im Mohawktal wieder guten Mutes, zumal inzwischen die schlimmsten Wunden bereits vernarbt waren und die so sehr bedroht gewesene reiche Ernte glücklich in den Kornschobern lag. Voll Zuversicht zog der Farmer hinaus zur Wintersaat auf Felder und Äcker, die, kurz zuvor noch in allen Farben prangend, sich mittlerweile zu einem eintönigen Rostbraun gewandelt hatten. Nur oben auf den Höhen leuchteten die immer noch üppigen Laubgewölbe der Wälder in den buntesten, ja oft feurig roten Farbtönen. Aber auch das dichte Unterholz mit seinem wirren Blättergeranke zeugte davon, dass der Herbst voll hereingebrochen war, wandelte sich doch auch dieses bereits zum buntesten Farbenchaos und bot, wenn an heiteren Tagen der Sonne Strahlen sich darüber ergossen, in seinem Brennen und Leuchten ein Bild von zauberischer Schönheit dar.
Mitunter wurde das Wetter aber auch schon recht trübe und ein kühler Nordwind ging über die Höhen und Fluren. Dann wurde es oben im Wald lebendig in dem wirren Geäst. Die welken Blätter lösten sich und sanken wirbelnd zur Erde, als seien sie eins ums andere von einer unsichtbaren Hand vom mütterlichen Zweig gebrochen.
Aus einem engen Seitental, unweit Little Falls, sandte munteren Laufes ein Flüsschen seine Wasser zum Mohawk nieder.
Doch wenn man das entlegene Tal, das selten eines Farmers Fuß betrat, höher emporstieg, wurde der Lauf des Flusses, trotz des Wasserreichtums und des erheblichen Gefälles, mehr und mehr träge.
Hier fanden sich in dem oft zwanzig Meter breiten Flussbett quer im Halbbogen Dämme gezogen, die auf der Stromseite eine fast senkrecht abfallende, zwei bis drei Meter hohe Wand, stromauf aber eine Böschung bildeten.
Diese merkwürdigen, immer wiederkehrenden Bauwerke bestanden in der Hauptsache aus mehr oder weniger starkem, in den Grund des Flusses versenktem Knüppelholz, das durch Lehm und Erde zu einem festen Bollwerk verdichtet war.
Die Dämme trugen gewöhnlich am untersten Punkt des Halbrunds eine oder mehrere Einsenkungen, aus denen nur dünn und spärlich das obere Stauwasser abzulaufen vermochte.
Ober- wie unterhalb dieser Flussdurchquerungen ragten eine Menge wirr durcheinander liegender, backofenartiger Hügel aus dem Wasser empor, alle ebenso wie die Dämme aus abgeschälten Holzstücken, Erde, Lehm und Sand zusammengeschichtet.
Durch diese eigentümlichen, unverkennbar durch künstliches Zutun in den Fluss verstreuten Bauwerke wurde dieser zu einer förmlichen Kette von Stauwasserteichen umgebildet.
Es war an einem heiteren, klaren Nachmittag, die Sonne neigte sich schon stark dem Horizont zu, da tauchte an einem dieser Dämme, mitten im Fluse, ein kleiner dunkler Punkt auf, der sich geräuschlos, doch mit großer Schnelligkeit dem Ufer zu bewegte.
Dort erhob sich bedächtig ein dunkelhaariger, verhältnismäßig breiter Kopf mit stumpfer Schnauze und kleinen beweglichen, schwarzen Augen, dem langsam ein kurzer, dicker Hals, dann ein fast meterlanger, gedrungener Leib folgte.
Das wollhaarige Tier, den Schwanz noch im Wasser hängen lassend, sicherte eine Weile, erstieg dann mit seinen kräftigen Beinen vollends das Ufer und verschwand in dem hier unmittelbar bis an den Fluss heranreichenden Waldesdickicht.
Nun wurde es mit einem Mal im ganzen Fluss lebendig.
Da und dort erschienen wohl ein Dutzend dunkle Punkte, schossen ans Ufer, Tiere wurden sichtbar, ganz ebenso gestaltet wie das vorige, sicherten und stiegen ganz ebenso und mit der gleichen Vorsicht ans Land.
Kaum waren alle diese langgestreckten dunklen Tiergestalten einige Minuten im Wald verschwunden, als ein vielstimmiges, seltsam schnarrendes Getöse hörbar wurde, dem bald hier, bald dort, schnell aufeinander das jähe ächzende Krachen brechender Baumstämme folgte. Wieder über eine Weile erhob sich ein eigentümliches Geräusch, als ob mit emsiger Geschäftigkeit Zweig um Zweig von den Stämmen abgerissen, zernagt und zermürbt würde. Es nahm bald darauf wieder einen anderen Charakter an. Es schien, als ob unsichtbare Geister schwere Holzstücke vorbei an knisternden und knackenden Büschen und über das dürre Laubwerk am Boden zu schleifen bemüht seien.
Plötzlich zwei Schüsse, deren Knall hundertfältig in dem engen Tal widerhallte.
Lebhaftes Rascheln in dem dürren Laub entstand. Entlang dem Ufer klatschten schnell hintereinander jäh daherschießende dunkle Leiber in den Fluss; das Wasser rauschte auf, dann wurde es unter den Bäumen und über dem Fluss wieder einsam still.
»Hoiho – ein Prachtbursche«, ließ sich über eine kleine Weile eine sonore, männliche Stimme vernehmen, der sofort eine zweite antwortete: »Auch der meine is net übel!«
Addy und Franzl tauchten am Ufer des Flüsschens auf. Sie hatten hier auf dem Anstand gelegen und nun trat einer zu dem anderen, jeder einen feisten Biber in den Händen.
Die beiden Jäger betrachteten gegenseitig ihre Beute, junge, jedoch völlig ausgewachsene Exemplare, mit sehr schönen, weichhaarigen, glänzenden Fellen.
Als die beiden gegenseitig ihre Befriedigung geäußert hatten, gingen sie auf eine kleine Lichtung zurück, wo noch mehrere erlegte Biber zwischen einer Anzahl Fallen umherlagen.
Die Jäger warfen die Beute zum Übrigen und begannen, die Fanggeräte mit frischen Zweigen zu beködern, worauf sie dieselben schweigsam und unter aller Vorsicht größere und kleinere Strecken weit hinauf und hinab an den Fluss trugen und dem Wasser entlang an einer Reihe von Anstiegen aufstellten.
Darüber war mehr als eine Stunde vergangen und im Wald wurde es mittlerweile ziemlich dunkel.
Da ließ sich unten am Fluss ein schriller, eigentümlicher Pfiff vernehmen, worauf weiter oben ein zweiter in derselben Weise antwortete.
Kurz darauf fanden sich die beiden Jäger wie zuvor auf der Lichtung zusammen, wo jeder mit der Hälfte der erbeuteten Tiere sich bepackte. Sie schlugen dann auf einem schmalen, sonst kaum begangenen Weidmannspfad den Weg zum Mohawktal ein.
Schweigend wanderten sie dahin.
Der Boden war moosig und weich und die Schritte der beiden Wanderer daher kaum vernehmbar. Ab und zu nur streiften die Füße welke Blätter oder es berührten die Schultern leise knisternde Zweige.
So gingen sie fast schon eine Stunde.
Es war inzwischen stockfinster geworden, man sah kaum die Hand vor den Augen; nur der geübte und erfahrene Waldläufer vermochte unter diesen Umständen, des Zieles und des Weges sicher, hier vorwärts zu kommen.
Endlich lichteten sich über den beiden die Baumkronen, es wurde etwas heller. Man konnte nun wenigstens die allernächste Umgebung unterscheiden. In der Ferne, offenbar unten im Tal, wurden bereits einzelne Lichter sichtbar.
Die beiden Jäger waren im Begriff, aus dem Walde herauszutreten, als Addy plötzlich stehen blieb und seine rechte Hand auf des anderen Schulter legte.
Etwa zwanzig Schritte von ihnen senkte sich der Pfad mit einem Mal steil dem Tal zu.
Dort war die dunkle Silhouette einer menschlichen Gestalt sichtbar geworden, die, solange die beiden im Schatten der letzten Bäume beobachtend stehen blieben, ihren Standpunkt ebenso wenig veränderte.
Mit angehaltenem Atem lauschten sie.
Geraume Weile verhielt sich der Fremde untätig, plötzlich aber ließen sich leichte, hellklingende Schläge vernehmen; kleine Funken sprühten auf im nächtlichen Dunkel.
Der Mann dort schlug offenbar mit Stahl und Schwamm Feuer an, um sich seine Tabakpfeife zu entzünden.
Die beiden Jäger hatten also zweifellos einen Talbewohner vor sich. Was aber mochte diesen, zu so später Stunde noch hier oben an den Wald führen?
Die beiden traten vor und der andere, sie gewahrend, kam schnell einige Schritte näher, prallte aber schon in halber Entfernung wie erschrocken zurück und lief dann leichtfüßig von dannen.
Dieses kam den beiden so unerwartet, musste ihnen aber doch derart auffallen, dass sie wie auf Verabredung beide unwillkürlich ihre Beute abwarfen und dem Mann, der sie allem Anschein nach erkannt hatte, sich aber dennoch so sonderbar verhielt, nachsetzten. So sehr sie aber auch eine Strecke weit liefen, dann die ganze nähere Umgebung aufs Genaueste absuchten, der Ausreißer war und blieb verschwunden.
»Merkwürdig«, sagte Addy, nachdem sie sich entschlossen hatten, von der Suche abzulassen und zum Waldrand zurückzukehren, ihre dort abgelegte Bürde wieder aufzunehmen. »Wenn der Mensch gleich davongelaufen wäre, würde ich mich über ihn nicht wundern.«
»So aber«, stimmte Franzl bei, »sieht er uns, geht uns entgeg’n und erst als er merk’n mueß, dass er’s mit harmlos’n Leut’n z’ tun hat, lauft er davon. Möcht man nit akk’rat glaub’n, dass der Mensch a schlecht’s G’wiss’n hat?«
»Das möchte man allerdings glauben«, versetzte Addy, »und wenn mich mein Auge nicht ganz getäuscht hat …«
»… könnt’s der Fred g’wes’n sein«, ergänzte der andere.
»Nun, da haben wir’s – es kam Euch also auch so vor?«
»D’rauf schwör’n wullt’ i nit – ‘s is heunt verflixt dunk’l.«
»Aber Ihr gebt zu, der Mann hatte ganz des Freds schmale Figur, seinen Gang, beim Laufen die schlenkernden Armbewegungen – was kann der Bursche zu dieser späten Stunde hier oben zu suchen haben?«
Sie erwogen im Weiterschreiten noch lange diese Frage, ohne zu einer annehmbaren Schlussfolgerung zu gelangen und waren endlich in Little Falls angekommen, wo sie nach des Tages Strapazen, einer Erfrischung bedürftig, in das Gasthaus zur fröhlich Pfalz eintraten.
Hier saßen in dem Schankraum mehrere Farmer, welche die Eintretenden mit Hallo begrüßten und lebhaft interessiert deren Beute besichtigten.
Die beiden lehnten ihre Büchsen neben die Flinten der bereits Anwesenden und ließen sich Erfrischungen vorsetzen. Man trank ihnen zu und bald war das lebhafteste Gespräch im Gange, der Mann oben am Wald vergessen.
Addy oder Adam Hartmann, wie er eigentlich hieß, genoss im Kreise dieser Leute, das merkte man an allem, das größte Ansehen. Er war zwar keineswegs ein amüsanter Gesellschafter, seine Beteiligung an der Unterhaltung war sogar eine recht dürftige, er traf aber, wenn es galt, Rede und Antwort zu geben, stets den Nagel auf den Kopf. Und wie man in dem hier versammelten kleinen Kreis seiner Person die größte Aufmerksamkeit entgegenbrachte und seinem Urteil immer die größte Bedeutung beilegte, so war das im ganzen Tal der Fall. Er mochte auf seinen weiten Streifungen an die Tür irgendeiner Farm pochen, überall sah man ihn gern, überall behandelte man ihn mit der größten Achtung, überall bedurfte man seines Rates und brachte ihm die weiteste Gastfreundschaft entgegen.
Dieses sein Ansehen und seine Beliebtheit gründeten sich in der Hauptsache auf die vielen Verdienste, die er sich durch Umsicht, Unerschrockenheit und Tapferkeit unter diesen Leuten erworben hatte, ermangelte aber auch nicht gewisser materieller Gründe.
Man wusste, dass er ehedem unter allen Indianerstämmen oben an den Seen herumgekommen war, in manchem Wigwam übernachtet hatte, und dass er auf diese Weise die Sprachen der Roten, ihren Charakter, ihre Gebräuche und Sitten wie kaum ein anderer kannte.
Als er vor Jahren im Tal plötzlich auftauchte, hatte er daher anfänglich oftmals als Dolmetscher dienen müssen und war dann nach und nach durch die regen Handelsbeziehungen, die man mit den Rothäuten unterhielt, zu einem geradezu unentbehrlichen Ratgeber und Vermittler geworden.
Nur eine Eigenschaft gab es, die man an ihm lieber nicht gesehen hätte, und das war seine ungebundene, geradezu indianerhafte Lebensweise und seine Leidenschaft für die Jagd, die ihn nie lange an einem Platz litt.
Mit einer gewissen heimlichen Freude hatte man es daher im ganzen Tal begrüßt, als kurz nach dem Tod Herckheimers bekannt wurde, dass derselbe dem Adam Hartmann eine kleine, doch gut bestellte, unweit Little Falls gelegene Farm testamentarisch vermachte. Man erblickte darin eine letzte liebende Fürsorge des Generals für das Gemeinwohl, denn sie bezweckte offenbar nichts anderes, als den unsteten Jäger dem Tal zu erhalten und ihn durch diese Schenkung sesshaft zu machen.
Diesem Gegenstand galt die Frage eines sichtlich auf der Durchreise begriffenen Mannes, der sich mitten aus der Unterhaltung heraus ganz unvermittelt an Addy wandte und fragte: »Sagt, ist es wahr, was man sich von Farm zu Farm erzählt, dass Euch die Erbschaft keine Freude macht?«
Dem Jäger kam die Frage sichtlich recht ungelegen. Er würgte lange an den Worten, ehe er entgegnete: »Freude macht sie mir, das sei ganz ehrlich zugegeben, warum, weil sie aus der Hand eines Mannes kommt, den ich verehrte wie den eigenen Vater.«
»Und weil die Erbschaft zugleich eine Ehrung für Euch selber ist«, warf ein anderer der Männer ein.
»Lasst es Euch gesagt sein«, entgegnete Addy, »dass ich nicht wüsste, womit ich eine solche Ehrung verdient hätte. Die Dienste, die ich gelegentlich dem verstorbenen General und dem einen oder anderen Farmer leistete, die wollen nicht berechnet sein; und wenn ich ab und zu den Roten gegenüber fest auf den Füßen stand, so galt es doch in erster Linie meiner eigenen Haut.«
»Das ist Eure Meinung und wir alle wissen, dass es Eure ehrliche Meinung ist; das ändert aber nicht, dass man darüber den ganzen Mohawk entlang doch etwas anders denkt.«
»Nun wohl, ich kann den Menschen das Denken nicht verbieten«, entgegnete Addy und setzte, sichtlich jedes Wort sich abringend, hinzu: »Zudem hat die Geschichte noch einen bösen Haken.«
»Die Erbschaft?«
»Ja, die Erbschaft.«
»Das wäre?«, fragten mehrere der Männer fast zugleich.
»Herckheimer war Witwer, er hatte zwar keine Kinder, zahlreich aber sind seine Verwandten.«
»Ihr wollt doch nicht damit sagen«, rief einer der Farmer, »dass die Euch die Erbschaft neiden?«
»Das will ich damit allerdings nicht gesagt haben«, gab der Jäger stockend zu, »doch immerhin – genau so viel wie Herckheimer mir zugedacht hat, entgeht den anderen.«
»Man sollte es nicht glauben«, warf der an den Tisch herantretende dicke Wirt geräuschvoll ein, »dass ein Mann wie Ihr, in jeder Hinsicht durchgesotten und durchgebraten, in solchen Dingen weich wie eine Pflaume ist. Was kann es sein, wenn die Herckheimersche Sippe statt mit 1900 Acker, jetzt mit deren 1650 zufrieden sein muss?«
»Die Herckheimerschen sind jetzt alle im stattlichsten Besitz«, erwiderte Addy, »wer könnte das leugnen; aber doch ist einer, der bei der Teilung gar zu schlecht weggekommen ist.«
»Etwa der Fred?«
»Ja gewiss, der Fred – nach meiner Meinung durfte er mehr erwarten.«
»Diesem Wicht das Wort zu reden«, wandte sich ein großer, schnauzbärtiger Mann polternd an Addy, »habt Ihr wahrlich die allerwenigste Veranlassung.«
»Hat er wieder einmal irgendwo seinen Schnabel gewetzt?«, fragte der Jäger.
»Und das nicht übel«, bestätigte der andere. »Er kann den Fußtritt, oben bei Oriskany und das, was Ihr, Adam, ihm damals angetan habt, nicht vergessen. Es soll, behauptete er, Euch und dem Franzl noch teuer zu stehen kommen.«
Sowohl Addy als auch Franzl lachten belustigt und beide schickten sich zu einem Einwand an, aber da fragte schon der auf der Durchreise befindliche Farmer in der Fuhrmannsjacke, der dem Gespräch diese Richtung überhaupt gegeben hatte: »Erlaubt, wer ist der junge Mann eigentlich, von dem man sehr viel Übles, aber niemals Gutes hört? Wie kam der Herckheimer zu diesem Menschen?«
»Das kann ich Euch sagen«, erwiderte Addy, als alle anderen schwiegen. »Herckheimer war im Jahre 1758 Leutnant der Miliz und verteidigte, als damals die Franzosen und Roten es auf die German Flats abgesehen hatten, durch mehr als anderthalb Jahre das unweit davon liegende Fort.«
»Dasselbe Fort«, warf einer der Farmer ein, »das, wie wir ja alle wissen, seither seinen Namen führt.«
»Ganz richtig. Als er dann nach der langen Belagerung endlich Luft bekam, unternahm er manche Streife durch das umliegende Gebiet und tief hinein in die Wälder, den Roten das Wiederkommen zu verleiden. Eines Tages nun, als er eines ihrer Lager überrumpelte und gewaltig unter ihnen aufräumte, da fiel ihm eine weiße Frau, wie es hieß, eine Engländerin, mit einem kleinen Kind in die Hände.«
»Das war jener Fred?«
»Allerdings, das war jener Fred. Die Mutter des Kindes hatte von den Rothäuten schon manche Folterqual erdulden müssen, war sterbenskrank und machte nicht mehr lange.«
»Wer der Vater des Kindes war, das weiß man nicht?«
»Das erfuhr man nie. Kurzum, die sterbende Frau bat den damaligen Leutnant flehentlich, sich ihres Kleinen anzunehmen, und er versprach ihr, für das Kind zu sorgen. Herckheimer, obwohl zu jener Zeit Junggeselle, hat auch redlich Wort gehalten. Er nahm das Kind zunächst mit sich ins Fort und gab es der Frau eines Unteroffiziers in Pflege. Als er bald darauf heiratete und ohne Kinder blieb, da nahm er es zu sich ins Haus.«
»So ist es. Herckheimer hat an dem Racker sehr edel gehandelt. Das Kleine schien auch prächtig zu gedeihen und sowohl er sowohl als auch seine Frau hatten ihre große Freude an ihm.«
»Ganz richtig. Als der Bengel dann aber über die zehn Jahre hinaus war, da zeigte er allmählich sehr schlimme Eigenschaften: Der Junge zitterte vor jeder ungewöhnlichen Erscheinung, blieb ohne jede Energie, verhielt sich gegen seine Kameraden bösartig, war heimtückisch und wusste den Alten gelegentlich gar frech zu belügen. Als weder Ermahnungen noch Prügel fruchteten, wurde es dem Herckheimer zu bunt und er übergab ihn in Albany einem Zuchtmeister.«
»Diese Zucht scheint aber nicht besonders angeschlagen zu haben?«
»Darüber besteht kein Zweifel. Sie hat schon darum nicht recht angeschlagen, weil der Zufall wollte, dass jener Zuchtmeister noch eine Anzahl andere Zöglinge hatte, durchaus Söhne von Engländern oder doch mindestens Loyalisten.«
»Dadurch hatte er politische Ansichten kennen gelernt, die denen des Generals, der doch ein überzeugter und begeisterter Anhänger der Befreiungssache war, direkt entgegenstanden.«
»Das hat der Fred und unangenehm genug war bei des jungen Mannes Rückkehr des Pflegvaters Überraschung.«
»Das gab natürlich eine Entfremdung.«
»Nun, der Riss war ja ohnehin schon da. Herckheimer hat sich aber, soviel man weiß, gleichwohl immer noch redliche Mühe gegeben, dem Fred den Kopf wieder rein zu fegen.«
»Und Ihr glaubt, es ist ihm gelungen?«
»Es scheint so, oder aber der Fred wäre ein vollendeter Heuchler und Duckmäuser.«
»Eine verschlossene, finstere Natur, das ist er.«
»Na ja, vielleicht ist das die Schuld jenes Zuchtmeisters. Ich fürchte, jene Dressur war keine allzu glückliche; sie war vielleicht eine viel zu strenge.«
»So viel ist richtig: Pfeift der Haselstock gar zu oft, erreicht man nicht selten das genaue Gegenteil von dem, was man erreichen will. Man treibt die Jugend gleichsam mit Hieben auf Abwege.«
»Ihr könnt recht haben. Was den Herckheimer aber am meisten an dem jungen Mann verdrossen hat, ist, dass er sich neben allen anderen wenig schätzenswerten Eigenschaften immer mehr als ein erbärmlicher Feigling entpuppte.«
»Na ja, das war es, was der tapfere Alte am wenigsten vertragen konnte.«
»Und das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein, dass er den jungen Menschen, je mehr er heraufwuchs, immer weniger leiden mochte.«
»Na, dann ist es aller Ehren wert, dass er ihm überhaupt ein Legat hinterlassen hat!«
»Ich gebe es zu und jedem anderen jungen Mann würde es reichen, um sich damit einen Besitz zu erringen. Beim Fred aber ist nicht entfernt daran zu denken, mangelt ihm doch auch der haushälterische Sinn und die rechte Freude zur Arbeit. Ich bin überzeugt, er wird das Geld binnen kurzer Zeit zwecklos vergeudet haben. Was ihm allein hätte nützen können, wäre eine unveräußerliche Farm, die, durch den rechten Mann bewirtschaftet, ihm eine auskömmliche Rente hätte abwerfen können.«
»Und nun wollt Ihr, Addy, ihm schnell die Eure überlassen?«, fragte etwas spöttisch der dicke Wirt.
»Das nicht; allein schon deshalb nicht, weil es gegen den Willen des Erblassers wäre. Aber ich sage ungescheut, dass mir der Fred gerade darum, weil er schlecht geraten ist, recht leid tut. Läge der Fall anders und wüsste ich ihn durch Überlassung der Farm auf den rechten Weg zu bringen, wahrlich, ich besänne mich keinen Augenblick.«
»Demnach scheint Euch also doch blutwenig an dem Besitztum zu liegen und womöglich werdet Ihr es gar nicht antreten?«
»Das, was Herckheimer mit der Schenkung beabsichtigte, verstehe ich wohl, aber eben darum sei es mir erlaubt, zu sagen, dass sie höchst überflüssig war. Denn wenn ich ihm an seinem Totenbett versprochen habe, im Tal meinen dauernden Wohnsitz zu nehmen, so bedurfte das nicht erst einer materiellen Stütze – ich betrachte mein gegebenes Versprechen als einen heiligen Schwur und unverbrüchlich werde ich ihn halten.«
»Brav von Euch!«, riefen die Farmer, hoben ihre Becher und tranken Addy zu.
Dieser stieß mit den anderen an, nahm einen kräftigen Schluck und sagte dann: »Auch die Farm werde ich behalten, wenngleich ich die Fallenstellerei und die Jagd nicht aufgebe.«
»Wie aber wollt Ihr Zeit finden, das Stück Land zu bewirtschaften?«
»Das werde ich überhaupt nicht, sondern mir nur eine Stube ausbedingen, alles andere aber und das Bewirtschaften einem anderen überlassen.«
»Also die Farm verpachten – habt Ihr schon einen Pächter?«
»Nicht nur einen Pächter, sondern, wie ich mit allem Grund vermute, auch schon eine Pächterin.«
Franzl, der sich an der ganzen Unterhaltung nicht beteiligt, sondern sich darauf beschränkt hatte, auf einer mächtigen Maultrommel, die er zwischen den Lippen hielt, ganz leise ab und zu einige Akkorde zu flöten, ließ nun auf dem Instrument einen lustigen Dudler los, schob es dann über sein linkes Ohr, langte nach einer neben ihm an der Wand hängenden Gitarre und hob in unverfälschtem Älplerdialekt zu singen an:
Was braucht denn a Jager?
A Jager braucht nix
Als an Beut’l voll Pulva
Und a Blei und a Büchs’.
Kennt ‘n Punkt auf da Scheib’n,
Hat Aug’n wie a Luchs
Und, die Rot’n, die wiss’n’s,
Das Pirsch’n vom Fuchs.
Er halt nix vom Reichsein,
Er halt nix aufs Geld,
Sein sicheres Büchserl
Is ihm all’s auf da Welt.
»Bravo!«, zollte Addy dem Sänger lauten Beifall, »mir ganz aus der Seele gesungen. Der Franzl«, fügte er dann, still in sich hineinlachend, hinzu, »er kennt ihn gut, den Punkt auf der Scheibe«, indem der Jäger sich in bezeichnender Weise selbst auf die Brust deutete.
»Das konnte man sich eigentlich an den Fingern abzählen«, bemerkte beipflichtend der polternde Schnauzbart, »dass Ihr das Jagen nicht lassen werdet und wahrlich, es lässt sich verstehen, wenn ein Mann wie Ihr nicht mit einem Mal die Büchse in die Ecke stellen will – genug, dass Ihr entschlossen seid, das Herumzigeunern auf ein bescheidenes Maß zurückzuführen.«
»Und wer ist denn der Mann, dem Ihr die Farm übergeben werdet, wenn man danach fragen darf?«
Stumm deutete Addy auf Franzl, der, als alle Blicke sich auf ihn richteten, den wortlosen Hinweis des Jägers mit Kopfnicken bestätigte.
Mit Freuderufen und mit Glückwünschen wurde diese Neuigkeit begrüßt.
»Wo aber bleibt die Pächterin? Ihr, Franzl, seid doch unbeweibt?«
»Da gibt es am Ende gar eine Hochzeit?«
Da Franzl die Antwort schuldig blieb, sondern nur geheimnisvoll vor sich hinlächelte, sah man fragend auf Addy.
Der Jäger bemerkte das wohl, sah wiederum fragend auf seinen Pächter und sagte zögernd: »Ich weiß nicht, ob ich aus der Schule schwatzen darf …?«
Franzl nickte lächelnd zu.
»Nun, dann sei es nicht länger verschwiegen«, hob Addy an. »Ihr wisst ja, dass Philippine, Herckheimers Haushälterin, jetzt ihrer seitherigen Aufgabe los und ledig ist …«
»Das Binche?«, schrien die Farmer wie aus einem Munde.
»Ja, das Binche«, bestätigte Addy, und Franzl schlug auf der Maultrommel, so laut es auf seinem geliebten Leibinstrument zuwege zu bringen war, einen melodiösen Rassler. Dann langte er wieder nach der Gitarre, oder vielmehr nach der »Zupfgeig’n«, wie er dieses Instrument mit Vorliebe nannte, schlug einige Akkorde und begann wieder zu singen:
I g’steh’s enk, ihr Leut’ln,
Das »Binche« g’hört mein,
Und wann i das sag’,
So werd’s aa so sein.
Und ‘s »Binche« is sauba,
Is liab und net stolz,
Mag d’ Dirnd’ln net leid’n,
So steif wie a Holz.
Hat tiefblaue Aug’n,
Die steh’n ihr guat an,
Wann i Blauveigerln sieh,
Denk’ i alleweil d’ran.
Hat schneeweiße Zahnerln,
Da lacht’s, wann’s mi sieht.
Und sie kunnt’ mi aa beiß’n,
Das tut’s aber nit.
Beifällig nahmen die Männer die Schnadahüpfeln des Älplers hin und ließen dann die frisch gefüllten Becher auf das Wohl des neuen Pächters und der zukünftigen Pächterin hell zusammenklingen.
In die beste Laune versetzt, blieben die Farmer noch geraume Weile zusammen, trieben allerlei Kurzweil und tranken dabei zur Freude des Wirts und zur Ehrung des Tagesereignisses auf gute Pfälzer Art als noch ‘n Schoppe.
Endlich aber langten die Männer nach den Büchsen und brachen auf, den Heimweg zu den verschiedenen Farmen anzutreten.
Gemächlich schlenderten sie in kurzer Entfernung von dem gastlichen Blockhaus dahin, als Addy plötzlich stehen blieb und durch Zuruf auch die anderen dazu veranlasste.
»Täusche ich mich – oder ist dort drüben nicht eine ganz eigentümliche Helle?«, fragte er und deutete mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger in das Dunkel der Nacht.
Mehrere bestätigten dies, andere stellten es wieder in Abrede.
Plötzlich schlug in der bezeichneten Richtung eine Feuerlohe auf, verbreitete weit um sich einen hellen rötlichen Schein und jetzt gewahrte man deutlich eine große Rauchwolke vom dunklen Giebel eines Daches zum Himmel emporsteigen.
»Feuer!«, schrien die jetzt sehr erregt gewordenen Männer und berieten, wo dasselbe etwa sein könnte und wie sie am schnellsten an Ort und Stelle kämen.
Da kam Franzl, der sich in der Schenkstube des Blockhauses noch etwas verweilt hatte, herbei. Kaum ersah auch er, durch den lebhaften Meinungsaustausch der anderen darauf aufmerksam gemacht, das Feuer, als er bestürzt ausrief: »Adam – ‘s is unser Hütt’n!«
»Wahrlich«, ließ sich vom Blockhaus her die Stimme des Wirts vernehmen, »Adam, macht Euch auf die Beine, man hat Euch den roten Hahn aufs Dach gesetzt!«
Nun kam Bewegung in die Männer und sie liefen, wie auf Vereinbarung, sämtlich querfeldein über die Äcker der Brandstelle zu. Das Erdreich war hier frisch gepflügt, daher weich und schlüpfrig, sodass sie bis an die Knöchel einsanken. Bald aber gelangten sie auf einen ihnen allen bekannten Feldweg und kamen nun schneller vom Fleck.
Inzwischen war die Feuersäule zur Riesenlohe emporgewachsen, die weithin das Tal erleuchtete. Von allen Seiten kamen nun Männer und Frauen, oft nur notdürftig bekleidet, von den Nachbarfarmen herbeigeeilt, den von dem Brand Betroffenen hilfreich beizustehen.
Und immer höher schlugen die Flammen und darüber wogte, sich mächtig schiebend und dehnend, eine gewaltige Rauchsäule.
Es war kein Zweifel, auch die Kornschober der Farm, in denen noch ein reichlicher Teil der letzten Ernte aufbewahrt lag, mussten vom Feuer ergriffen sein.
Im Näherkommen hörten die Männer nun auch das Brüllen des Viehs, aber nicht auf der Brandstelle, sondern mehr im Hintergrund, weiter dem Wald zu.
»Männer, habt acht!«, schrie jetzt Addy. »Nichts übereilen! Fast will mich bedünken, wir haben es hier mit den Roten zu tun.«
»Und wann ‘s Knöd’l ‘n Guld’n kost«, schrie Franzl, »’s wird g’rettet, was zu rett’n is«, und sprang wie ein junges Füllen allen anderen voran.
Endlich waren sie an die brennenden Gebäude bis auf etwa zweihundert Schritte herangekommen. Immer mächtiger schlugen die Feuersäulen aus den Scheunen empor, weithin die Umgebung fast taghell erleuchtend, ein schaurig schönes Schauspiel.
Da tauchte eine Rothaut hinter den brennenden, Scheunen auf und sprang, als sie die daher eilenden Männer gewahrte, leichtfüßig der dahinter liegenden bewaldeten Höhe zu.
Nun war es klar: Man hatte es richtig mit einem räuberischen Überfall der Indianer zu tun. Mit derben Verwünschungen machten sich bei dieser Wahrnehmung die Farmer Luft.
»Lasst uns den Kopf beisammen behalten«, mahnte Addy, als einige der Bauern zornentbrannt auf die brennenden Gebäude losstürzen wollten. »Dort ist keine Rothaut! Lasst brennen! Es ist nichts mehr zu retten. Hört ihr das Vieh brüllen? Sie wollen es wegschleppen, die roten Schurken; dort oben im Wald haben wir sie zu suchen!«
Kaum fünfhundert Schritte von der Farm entfernt, wurde das Tal von einem nicht sehr hohen, aber ziemlich steil ansteigenden, oben bewaldeten Hügelgelände umsäumt. Obwohl viele der Männer, die dem Brandplatz zugeeilt waren, ihre Waffen zu Hause gelassen hatten, folgten sie doch alle sofort dem Gebot des Jägers.
In vollem Lauf bogen sie rechts ab und wo nur auf ihrem Wege an den Hecken und Umzäunungen ein derber Knüttel zu erhaschen war, nützten die Unbewaffneten die Gelegenheit und griffen wutentbrannt zu.
Noch befanden sie sich in dem Lichtkreis der brennenden Gebäude und dieses machte sich auch der Feind alsbald zu nutze.
Schnell nacheinander zuckten auf der Höhe kleine Feuergarben auf, Büchse um Büchse knallte und zischend fuhren die Kugeln über die Köpfe der Bauern.
Dies hielt die Farmer aber nicht ab, ihren Lauf fortzusetzen, nur nutzten sie nun auf die Mahnung des Jägers vorsichtig die bedeckteren Teile des Geländes.
Schuss um Schuss fiel unterdessen, doch die Indianer zielten in dem ungewissen Licht schlecht; die niedergesandten Kugeln blieben daher ohne Wirkung.
Endlich hatten die ersten Farmer den Fuß der Anhöhe erreicht und zwischen dem Buschwerk hindurch stiegen sie vorsichtig bergan.
Nun verstummte das Büchsenfeuer, umso lauter aber hörte man das Brüllen und Blöken der Tiere.
Entschlossen stiegen die Farmer aufwärts, als plötzlich über ihnen in den Büschen das Geräusch brechender Äste und Zweige sich vernehmen ließ; schwere Tritte stampften den Boden, dass die Erde weithin zu erbeben schien.
»Achtung!«, schrien die Männer.
Wild brüllend setzte ein Stier mit steilgestelltem Schwanz in gewaltigen Sprüngen zu Tal, dem fauchend und schnaubend mehrere schwere Ochsen, eine Anzahl Kühe, Schafe und einige Pferde folgten.
»Juh! Das Vieh hätt’ ma!«, jauchzte Franzl, als die Tiere in ihrem tollen Rasen an den Farmern vorüber und den Berghang hinab waren.
»Lasst uns aber dennoch nach dem Diebsgesindel sehen«, schrie Addy.
Rüstig erstiegen die Männer den Rest der Anhöhe. Oben angekommen, war aber vom Feind nichts wahrzunehmen. Die Farmer pirschten zwar bis an den Waldrand vor, traten auch an mehreren Stellen in die tiefe Dunkelheit unter den Bäumen ein, stießen aber hier weder auf einen Widerstand, noch ließ sich weit und breit der geringste Laut vernehmen.
Die Indianer, deren es verhältnismäßig nur wenige gewesen sein mochten, hatten bei der energischen Verfolgung wahrscheinlich die Unmöglichkeit eingesehen, das geraubte Vieh wegzuführen und, wohl wissend, dass die Bauern nicht mit sich spaßen ließen, es vorgezogen, Fersengeld zu geben.
Als die Farmer sich davon überzeugt hatten, ließen sie von der Verfolgung ab, denn tiefer in das Gehölz einzudringen, erschien bei der herrschenden Dunkelheit ebenso nutzlos wie gefahrbringend. Sie traten daher des Grolles voll den Rückweg an. Nun bot sich ihnen in der Tiefe bei den brennenden Gebäuden eine bewegte Szene dar.
Auf dem Brandplatz hatte das Feuer inzwischen an seiner Mächtigkeit erheblich eingebüßt. Die Dächer des Wohnhauses und der Scheuern waren verschwunden, sodass nur noch die rauchgeschwärzten Trümmer der Seitenwände emporragten und an ihnen leckten und züngelten die flackernden Feuerzungen. Noch aber waren die Flammen groß genug, dass eine weite Fläche rings um die brennenden Gebäude fast taghell erleuchtet wurde.
Hier jagten eine Anzahl erst später herbeigeeilter Farmer zu Fuß und zu Pferde hinter den Tieren her, die von der Anhöhe herab geradeswegs auf die brennenden Gebäude ihren Lauf genommen hatten und, so oft sie auch aus der unmittelbaren Nähe der Flammen vertrieben wurden, nach ihren Ställen suchend, immer wieder blindlings auf die brennenden Stallungen eindrangen.
Hätte es nicht an allem gemangelt, so wäre es den Männern sicherlich gelungen, die Tiere einzufangen und festzubinden. So aber waren weder Stricke noch Ketten vorhanden. Die unbändig gewordenen Tiere wussten sich immer wieder frei zu machen und die Jagd begann dann von Neuem.
Erst als Addy mit seinen Leuten herbeikam, gelang es mit vereinten Kräften und unter vielen Mühen, den wutschnaubenden Stier, die Ochsen, Kühe und Pferde zu bewältigen und aus dem Bereich des Brandplatzes wegzuführen.
An den Gebäuden gab es bald nichts mehr zu retten. Schon waren das Wohnhaus sowie die daneben liegenden Korn- und Heuschober fast bis auf den Grund niedergebrannt. Das Feuer hatte ganz nachgelassen, doch stieg aus dem glühenden Aschenhaufen, der von den massenhaft verbrannten Futter- und Getreidevorräten verblieben war, noch immer eine starke Rauchwolke zum nächtlichen Himmel auf.
Unweit der Brandruinen des Wohngebäudes saß auf einem umgestülpten Karren, die Ellbogen auf das Knie und das Kinn auf die Hände gestützt, düster auf die prasselnden und qualmenden Trümmer blickend, der Herckheimersche Dienstmann, der die Farm bislang bewirtschaftet und verwaltet hatte.
Addy gewahrte den Mann und ging zu ihm hin. »Es konnte allem Anschein nach nichts gerettet werden?«, fragte er ihn.
»Nichts!«, gab jener heiseren Tones zur Antwort.
»Alles verloren – meine Ersparnis, meine Waffen!«
»Auch gar nichts von Eurem persönlichen Besitz?«
»Alles verloren – meine Ersparnis, meine Waffen, meine Kleider!«
»Das ist bitter«, bemerkte der Jäger, setzte nach einigem Überlegen aber tröstend hinzu: »Lasst Euch raten, Mann, den Kopf deswegen nicht hängen zu lassen. Ihr wisst, dass die Farm jetzt mein ist und dass ich ihren Besitz demnächst antreten werde.«
»Was kann das mir nützen?«, entgegnete etwas unwirsch der andere.
»Ihr sollt entschädigt werden – wir haben jetzt im Herbst und den Winter über Zeit genug, die Hütten wieder aufzubauen. Wenn Ihr mir dabei helfen wollt, soll mir es lieb sein. Ich dagegen will dafür sorgen, dass Ihr keinen Verlust zu beklagen habt.«
»Herr, das wäre Almosen!«
»Was fällt Euch ein – mir will es ganz scheinen, als wäre es kein blinder Zufall, dass sich die roten Schufte just meine Farm für ihre Zerstörungslust ausgesucht haben. Der Brand galt sehr wahrscheinlich meiner Person und Ihr sollt darunter nicht leiden. Übrigens wollen wir diese Sache für heute ruhen lassen, wir können ja ein andermal darüber reden. Sagt lieber, wie das alles gekommen ist.«
»Da fragt Ihr wahrlich zu viel – ich kann höchstens sagen, wie es mir erging.«
»Erzählt uns das!«
Der Großknecht würgte ein wenig in der Kehle, begann dann aber zu berichten: »Es wird etwa drei Stunden nach Einbruch der Dunkelheit gewesen sein, die beiden Knechte schliefen schon und auch die Kathrin lag längst zu Bett. Ich sah im Haus noch nach dem Rechten und schickte mich eben an, gleichfalls die Nachtruhe aufzusuchen, als es mir mit einem Mal wie Rauch in die Nase stieg. Ich witterte sogleich Unheil und durchstöberte alle Winkel und Ecken. Als ich im Wohnhaus nichts entdecken konnte, sah ich nach den Scheunen und Ställen.«
»Von dort wird wohl der Rauch gekommen sein?«
»Ja, da wirbelte er schon empor von den Firsten. Zum Glück hatte ich den Fensterladen der Wohnstube nicht geöffnet, sondern sah vorsichtshalber durch ein Schussloch. Gleich darauf polterte es gar gewaltig gegen den Fensterladen. Ich langte nach der Büchse und schlug Lärm, aber die Kathrin im oberen Giebelraum, die war nicht zu erwecken. Dagegen wurde es jetzt im Stall, wo die Knechte schliefen, lebendig. Geschrei scholl herüber, das Vieh wurde laut und ich wusste jetzt sattsam, woran ich war.«
»Ihr habt die Roten an der Arbeit gesehen?«
»Das nicht, aber ich fühlte förmlich, dass so etwas vor sich ging. Ich schüttete sofort Pulver auf die Pfanne und gedachte denen draußen das Einsteigen mächtig zu versalzen. Als ich inzwischen aber gewahr wurde, dass vor dem Fenster wirklich mindestens ein halbes Dutzend roter Teufel standen, besann ich mich eines anderen. Schnell stellte ich das Licht in die hinterste Ecke der zweiten Stube und schloss die Tür so weit, dass nur ein kleiner Lichtschimmer durchdrang. Ich aber stellte mich hinter eine Truhe neben dem Fensterladen. Gleich darauf krachte der Flügel in Stücke und wie die wilden Tiere brachen die Roten einer um den anderen in die Stube. Sie schossen eine Weile im Dunkeln umher, gewahrten dann den Lichtschein und stürzten heulend zu dem zweiten Raum. Darauf aber hatte ich meinen Plan gebaut, darauf hatte ich nur gewartet. Schnell erhob ich mich, war mit einem Satz durch das Fenster und lief nun, was die Beine vermochten.«
»Recht so«, riefen einige der inzwischen herzugetretenen Farmer, welche den größten Teil der Schilderung noch mit angehört hatten. »Auf diese Weise habt Ihr Euch ganz klüglich aus der Schlinge gezogen. Es blieb Euch füglich nichts anderes übrig.«
»Was sollte ich machen?«, fragte der inzwischen ganz munter und gesprächig gewordene Großknecht. »Am liebsten, das dürft Ihr mir wohl glauben, hätte ich die ganze Sippschaft über den Haufen geschossen. Aber, sagt selbst, was ist einer gegen sechs? Es konnte mir schlecht ergehen, denn wie viele befanden sich noch im Stall und in den Kornschobern!«
»Habt ganz recht getan, Christian«, bestätigte ein Mann mit einem derben Knüttel über der Schulter, »und Ihr könnt noch obendrein von Glück sagen.«
»Und wo blieb die Dienstmagd, wo blieben Eure beiden Knechte?«, fragte Addy.
Christian zuckte die Achseln. Seine Augen umdüsterten sich und blieben fragend an dem qualmenden Trümmerhaufen haften.
Da ließen sich jenseits der Brandruine laute Rufe vernehmen.
Die Farmer umspannten fester die Schäfte ihrer Büchsen und liefen zu der anderen Seite.
Hier stand an einem schmalen, der Bewässerung dienenden Graben ein Menschenhaufen beisammen, der sich in derben Verwünschungen erging und mit einem menschlichen Körper zu schaffen machte, der anscheinend aus dem Graben gezogen wurde und nun bewegungslos am Uferrande lag. Da das mittlerweile dem Erlöschen nahe Feuer bis zu dieser Stelle nur noch wenig Licht verbreitete, war es hier ziemlich dunkel. Schon aber eilte ein junger Bursche mit einem brennenden Holzscheit vom Brandplatz herüber und nun entrollte sich im flackernd rötlichen Schein dieser Leuchte ein grausiger Anblick.
Blutüberströmt lag da eine junge weibliche Gestalt, die Hände krampfhaft ineinander gerungen, das Antlitz schmerzverzerrt, der obere Teil des Kopfes ledig der Haupthaare.
»Kathrin!«, hauchte mehr als das er es sagte, der mittlerweile ebenfalls herbeigeeilte Großknecht, und dieser Mann, der dem Tode so oft schon ins Angesicht geblickt haben mochte, bedeckte die Augen mit seinen schwieligen Fäusten.
Der Anblick des unschuldigen Opfers indianischer Grausamkeit ließ nun selbst die lautesten Farmer verstummen. Finster und scheu sahen sie nieder auf die vor ihnen liegende jugendliche Gestalt, die, noch so jung, in der Blüte ihrer Jugend dem unbarmherzigen Skalpmesser verfallen musste.
Schreibe einen Kommentar