Addy der Rifleman – Die deutschen Fäuste bei Oriskany
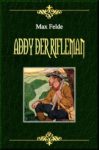 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Die deutschen Fäuste bei Oriskany
Mehrere Wochen waren vergangen; man schrieb den 6. August.
An diesem Tage befand sich Addy, der Jäger, auf einem schmalen Waldpfad des benachbarten Indianergebietes, wenige Meilen nur südöstlich des Forts Stanwix, welches zum Schutz der kolonisierten Gebiete vor Jahren schon errichtet worden war.
Dieser Pfad war ohne allen Zweifel nur durch den Wechsel des Wildes gebildet worden und führte in der Richtung von West nach Ost, also in fast gerader Linie auf die am Mohawk River liegenden deutschen Ansiedlungen.
Addy musste es wohl sehr eilig haben oder diesen Waldpfad in allen Einzelheiten genau kennen, denn er stapfte trotz der Dunkelheit, die hier unter den Riesenbäumen des Urwaldes herrschte, und trotz der vielen Hindernisse, die sich ihm in den Weg legten, flott weiter.
Plötzlich hielt er an und betrachtete aufmerksam das Ästchen eines Strauches, das sichtlich erst vor kurzer Zeit geknickt und zu einer Art Drudenfuß geflochten worden war.
Ein leiser Ruf, halb der Überraschung, halb des Unmutes, dann bog der Jäger rechts ab und kroch eine Strecke weit durch das dichte Unterholz.
Schon nach kurzer Zeit gelangte er auf eine kleine Lichtung, die von dem Blätterdach einer einzeln stehenden riesigen Ulme beschattet wurde.
Addy trat hin zu dem Baum, erfasste ein aus demselben vorstehendes totes Aststück und hob mit einem einzigen Ruck ein fast meterhohes Stück Rinde aus dem untersten Teil des Stammes; der Baum war hier zum größten Teil hohl. In dem Hohlraum, der nun im vollen Licht vor den Augen des Jägers offen lag, lehnte eine Jagdflinte, daneben ein indianischer Munitionsbeutel.
Der Jäger musterte noch eine kleine Weile den Raum, und als er allem nach sonst nichts Besonderes zu entdecken vermochte, legte er das Rindenstück wieder vor. Es passte mit seinem dichten Flechtenüberzug so genau auf den Stamm, dass selbst das geübteste Waldläuferauge ein solches Versteck hier nicht vermuten konnte.
Addy ging zurück an den Saum der Lichtung und warf sich hier im dichten Unterholz sichtlich etwas missmutig auf die Erde nieder. Aufmerksam und doch mit einer gewissen Unruhe musterte er die Umgebung. Das Astzeichen auf dem Wildpfad und hier das Vorhandensein der Jagdflinte hatten offenbar ihren Eindruck auf den Jäger nicht verfehlt; und doch schien die Unterbrechung, die sein Marsch dadurch hatte erleiden müssen, ganz und gar nicht nach seinem Geschmack zu sein.
Über eine Viertelstunde mochte er so dagelegen haben, als ein leises Knistern jenseits der Lichtung seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Gleich darauf tauchte die hohe Gestalt des Flinken Bibers zwischen den Büschen auf.
»Nun, da bist du ja, Oneida«, rief Addy gedämpften Tones, indem er sich schnell erhob. »Ich muss dir sagen, dass mir der Aufenthalt, zu dem du mich durch dein Zeichen gezwungen hast, nicht gerade erwünscht war.«
»Mein weißer Bruder wird eine andere Meinung haben, wenn er erfahren wird, warum Flinker Biber den Zweig geknickt hat.«
»Dass etwas Besonderes vorgeht, sehe ich daraus, dass du die Flinte abgelegt und dafür den Bogen eingetauscht hast. Jetzt sage mir aber vor allem, wie sieht es aus unten am Mohawk? Sind die Boten alle eingetroffen und bist du selbst auch bei unserem Häuptling gewesen?«
»Boten alle eintrafen; der Häuptling der weißen Krieger alle Nachrichten erhalten.«
»Nun, das beruhigt mich einigermaßen.«
»Er wissen, dass General Bourgoyne den Oberst St. Leger nach Fort Stanwix senden.«
»Er kennt also den Plan der Englishmen, das Fort zu nehmen; dass dann St. Leger über das Mohawktal herfallen soll, um sich unten an der Mündung des Flusses wieder mit Bourgoyne zu vereinigen?«
»Mein weißer Bruder mag ruhig sein; der Häuptling der Mohawk-Krieger all das wissen. Er bereits seinen Gegenplan fassen. Er alle seine Krieger zusammenrufen; er bereits marschieren nach Stanwix.«
»Ei, das sind ja wunderbare Neuigkeiten – er wäre bereits auf dem Marsche? Und nach Stanwix? Da sieht man, was sich alles begeben kann, wenn man einige Wochen seinem Wigwam fern geblieben ist!«
»Wo Addy gewesen, dass weiße Krieger vom Mohawk schon lange nach ihm rufen?«
»Wo ich so lange war? Nun, du weißt, mein roter Freund, dass man draußen in den Wäldern, zumal in diesen kriegerischen Zeiten allerlei Abenteuer erleben kann. Und ich habe eines erlebt, das nicht von Pappe war. Ich wurde dadurch leider gezwungen, einen sehr weiten Umweg zu machen. Doch davon später. Sprich: Warum marschiert General Herckheimer mit seinen Bauern nach dem Fort?«
»Er zählen seine Krieger, er haben nur wenig über tausend.«
»Aber das ist doch schon ein anständig großes Häufchen!«
»Oberst St. Leger haben ebenso viele weiße Krieger und über tausend Inschen.«
»Das sind allerdings erheblich mehr Köpfe. Doch vergiss nicht, Oneida, dass zwei deutsche Bauernfäuste mindestens für vier Huronen zählen!«
»Deutsche Krieger gute Krieger, Huronen schlechte, aber kluge Krieger.«
»Ich verstehe dich, Oneida. Du willst damit sagen, dass dieses Gesindel die große Tapferkeit, die ihm mangelt, durch Verschlagenheit und Hinterlist zu ersetzen weiß, und ich muss billig zugeben, Oneida, dass man damit rechnen muss.«
»Der Häuptling der Mohawk-Krieger auch rechnen, er rechnen sehr gut.«
»Wie, Oneida, wie rechnet er?«
»Er sagen, wenn weiße Krieger vom Mohawk allein kämpfen gegen Englishmen und Inschen, dann sind es ihrer zu wenige; um erschlagen zu werden, sind es ihrer zu viele.«
»Das hast du sehr schön gesagt, Oneida. Du musst aber deutlicher sprechen, wenn ich dich verstehen soll.«
Statt jeder Antwort nahm die Rothaut zwei auf der Erde liegende Zweige auf und sagte: »Wenn beide Stäbe zusammen, dann ihnen nichts anhaben, aber einzeln jeden leicht brechen.«
»Das ist schon wesentlich verständlicher. Aber sage mir, wenn unsere Krieger unten am Mohawk den einen Zweig darstellen, was soll der andere Ast bedeuten?«
»Das sehr einfach. Der Häuptling der weißen Krieger lassen Inschen nicht erst in das Mohawktal. Er lassen zweihundert Krieger zurück am Fluss, er gehen mit den anderen nach Stanwix; dort Oberst Gansevoort, er haben sechshundert Krieger; beide Häuptlinge dort zusammentreffen und zusammen kämpfen gegen Inschen und St. Leger.«
»Nun verstehe ich dich, Oneida, und ich muss zugeben, unser General rechnet nicht übel, zumal im Tal die meisten Früchte noch auf den Feldern stehen, und die braucht man sich durch die Mokassins der roten Leute nicht zertrampeln zu lassen. Nun verstehe ich auch, dass du mich in der wohlmeinendsten Absicht hier abgefasst hast, und ich danke dir. Nun brauche ich nicht erst den weiten Weg an den Mohawk hinabzusteigen, sondern kann in Gemächlichkeit warten, bis unsere Krieger hier vorüberkommen. Wann glaubst du, dass dies sein wird?«
»Können heute noch kommen; müssen schon sehr bald da sein.«
»Umso besser, umso besser, denn Geduldsproben, das weißt du, Oneida, die waren, wenn es nicht sein musste, nie meine Sache. Übrigens ließe sich die Zeit wohl auch ausfüllen damit, sich irgendein probates Mittel gegen den knurrenden Magen zu verschaffen.«
»Mein weißer Bruder hat Hunger?«
»Natürlich habe ich Hunger. Zudem gewahre ich, dass auch dein Proviantbeutel schlaff ist wie eine nasse Windfahne; das kann ich nicht länger mitansehen.«
»Dann kommen«, sagte einfach der Oneida.
Er prüfte mit nassem Finger den Wind und schlug sich dann seitwärts in die Büsche. Addy folgte.
Die beiden Männer krochen geraume Weile geräuschlos durch das dichte Unterholz und näherten sich wieder dem Wildpfad. Sie ließen denselben zu ihrer Linken, schlichen sich aber ziemlich dicht an demselben hin.
»Ich schlage vor, wir gehen vor bis an das Flüsschen.«
Der Oneida nickte stumm.
Noch eine Weile ging es geradeaus, dann hörte man Wasserrauschen.
Der Boden senkte sich mit einem Mal stark.
Die beiden Männer krochen vor bis an den von Buschwerk dicht bestandenen Abhang und schoben hier das Gezweig sachte etwas beiseite.
Unten kam das Flüsschen zum Vorschein. Es bildete hier einen kleinen Katarakt, unmittelbar darunter einen ziemlich großen Tümpel.
Befriedigt nickte Addy mit dem Kopf.
Aus dem Tümpel ragte das Geweih und die Nase eines Hirsches empor. Der Tag war heiß; das Tier hatte sich, offenbar um der Verfolgung durch die Mücken zu entgehen, in das Wasser geflüchtet.
Schon hob Addy die Doppelbüchse, doch da legte sich die Faust des Oneida auf dessen Schulter.
»Lassen das Schießholz; nicht wissen, wer im Wald!«
Der Oneida zeigte auf seinen Bogen, schon lag der Pfeil bereit zum Schuss.
Das Wild unten musste unterdessen einen Laut erhascht haben. Plötzlich war es aufgefahren; es hatte damit den schlanken gelbroten Leib völlig freigegeben und sicherte nun ängstlich in der Richtung der beiden Jäger.
Da schnellte auch schon der Pfeil des Indianers vom Bogen. Das Tier unten im Wasser machte einen Riesensatz, gewann noch das Ufer, brach aber dort zusammen.
»Das hast du gut gemacht, Oneida, das hast du sehr gut gemacht«, lobte der Jäger.
»Besser, nicht Donnerbüchse; nicht wissen, wer im Wald.«
»Auch in dieser Beziehung magst du recht haben, Oneida; Vorsicht ist unter allen Umständen immer das Beste.«
Die beiden Jäger liefen nun hinab an das Flüsschen. Der Oneida zog dem erbeuteten Wild den Pfeil aus dem Leib, reinigte ihn und übergab ihn wieder seinem Köcher. Dann zog er sein Messer und begann dem Hirsch kunstgerecht eine Keule auszulösen.
Addy, der untätig daneben stand, langte, so hoch er fassen konnte, nach einem unmittelbar neben ihm stehenden armdicken Baumstämmchen, bog es zur Erde nieder und setzte sich auf den so geschaffenen Sitz.
»Es ist eine Freude, dir zuzusehen, Oneida; auch diese Arbeit verstehst du vortrefflich; ich muss gestehen, viel besser als ich.«
Der Oneida machte eine abwehrende Gebärde.
»Mein weißer Bruder immer Lob spenden; das nicht gut. Erzählen jetzt lieber Abenteuer.«
»Von welchem Abenteuer? Ah, richtig, ich hatte ja ganz vergessen! Du willst von dem Abenteuer hören, das mich auf dem Rückweg so lange hingehalten hat. Nun wohl, ich will es dir kurz erzählen. Als ich nämlich meine Kaufleute oben am See glücklich abgeliefert hatte, nahm ich meinen Weg in der Richtung über Boonville. Du weißt, man gelangt dabei an den Black River, und das schien mir besonders günstig, denn man kann entlang dieses Gewässers am leichtesten und sichersten nach dem Fort Stanwix gelangen. Zudem wusste ich auf diesem Wege einige Fallensteller, die mit den verschiedenen Storekeepers im Osten just in dieser Zeit immer mehr oder weniger in Verbindung stehen. Wir hatten über den Vormarsch der Englishmen bereits genug in Erfahrung gebracht, aber ich konnte von diesen Leuten immerhin noch einige bemerkenswerte Einzelheiten mitgeteilt erhalten. Gut also – eines Tages traf ich auf eine Hütte, und der Besitzer derselben, früher ein braver Biberfänger, hatte zu meiner Verwunderung nun selber eine Bar eingerichtet. Als dieser Mann nämlich eines Tages den Fuß brach, quacksalberte er so lange an sich herum, dass eine vollkommene Steifheit des Beines zurückblieb. Da es mit dem Fallenstellen nun nichts mehr war, wollte er versuchen, ob er sich nicht mit seiner Bar und durch einigen Handel mit Fellen durchzubringen vermochte. Natürlich wollte ich dem beklagenswerten Mann einige Geldstücke zukommen lassen und ließ für uns beide eine gute Flasche Genever vorfahren. Als wir dann in der besten Unterhaltung standen, betrat ein himmellanger Hurone die Hütte, der nicht genug an seinem Kriegsputz, sondern auch noch ein Dutzend weißer Skalpe am Bändel hatte. Du weißt, Oneida, dass ich gegen diese Unsitte, solange nicht mein eigener Skalp in Betracht kommt, blutwenig einzuwenden habe. Als der rote Mann dann aber seinen Tabakbeutel hervorzog, an dem neben dem gewöhnlichen Flitter auch ein getrocknetes Kinderhändchen zur angeblichen Verzierung angebracht war, da stieg mir ein faustdicker Knäuel auf im Hals.«
»Da mein weißer Bruder einen großen Zorn bekommen?«
»Ja, da packte mich der Zorn und der genossene Genever tat das Übrige. Ich sagte dem aufgeblähten Menschen auf den Kopf zu, dass der Mord eines Kindes eine gemeine, eines anständigen Kriegers höchst unwürdige Schandtat sei. Ich forderte ihn auf, die Kinderhand sofort zu entfernen, widrigenfalls ich ihm, wie gebührlich, den Kopf waschen würde. Der Mensch hatte aber die Frechheit, mich noch obendrein zu verhöhnen, sodass mir zuletzt die Galle vollends überlief. Ich packte den Kerl, um ihn nach Gebühr durchzudreschen, doch der Mensch hatte seinen nackten Oberleib dermaßen mit Fett und Öl eingesalbt, dass meine Hände ihn nicht in der wünschenswerten Weise zu fassen bekamen. Gleichwohl mochte er die Kraft meiner Fäuste verspürt haben, denn er gab Fersengeld, lief wie besessen aus der Hütte und schwang sich auf sein Pony, das draußen vor dem Eingang angebunden stand. Im Davonreiten streckte er mir mit nicht misszuverstehender Gebärde just jenen Körperteil zu, mit dem er als anständiger Mensch besser mit dem Rücken des Pferdes in Berührung geblieben wäre. Nun war aber auch das letzte Fädchen meiner Geduld abgerissen. Ich nahm meine Büchse und jagte ihm just auf jene Fläche, die er mir so unverschämt als Zielscheibe darbot, eine Kugel in den roten Leib.«
Der Oneida, sonst ruhig und würdig, lachte, dass ihm die hellen Tränen über die Backen liefen.
»Das gut, das sehr gut«, sagte er ein ums andere Mal, sich mit dem Handrücken die feuchten Wangen wischend.
»Findest du? Das freut mich, denn auch ich fand, dass das die gerechteste Strafe für den unverschämten Menschen war. Leider sollte die Sache aber noch ein für mich sehr unangenehmes Nachspiel haben.«
»Nun Huronen kommen?«
»Natürlich waren noch weitere Huronen in der Nähe, die, als sie den Knall meiner Flinte vernommen hatten, wie die Pilze aus der Erde schossen. Mit dem Genever war es vorbei. Ich musste mich schleunigst auf die Beine machen.«
»Nun große Jagd, den weißen Mann einzuholen.«
»Natürlich. Ein ganzes Rudel setzte hinter mir her, doch, wie du siehst, umsonst. Wer Addy, den Rifleman, fangen will, muss eine sehr gute Spürnase und vortreffliche lange Beine haben.«
»Addy einen großen Bogen nehmen?«
»Ich musste notgedrungen einen sehr großen Umweg machen. Als ich dann wieder einbog und mich Stanwix näherte, stieß ich bereits auf die Englishmen. Nun musste ich nochmals zurück und im großen Kreis um das Fort herum. Daher der unliebsame Zeitverlust.«
Der Oneida war mit seiner Arbeit fertig.
Addy erhob sich und ließ das Baumstämmchen, auf dem er gesessen hatte, sachte in seine ursprüngliche Lage zurückgleiten.
Jeder der Männer nahm dann ein Stück des ergatterten Wildbrets an sich, worauf sie den kleinen Abhang wieder hinaufstiegen.
Sie näherten sich so wieder dem Wildpfad und berieten währenddessen, wo sie hier wohl am besten und sichersten ein Feuer entzünden könnten.
Als sie dann den Pfad betreten hatten und schon geraume Weile auf demselben weitergewandert waren, zuckte der Indianer plötzlich zusammen, warf sich auf den Boden und legte sein eines Ohr auf die Erde.
»Hörst du etwas, Oneida?«, fragte leise der Weiße.
»Huronen!« flüsterte der rote Mann und erhob sich.
»Dann lass uns von dannen eilen, tiefer in den Wald hinein!«
»Hugh!«, erwiderte als Zeichen seines Einverständnisses der Flinke Biber und beide verschwanden geräuschlos in einer unmittelbar hinter ihnen liegenden Dickung.
Sie hatten noch keine zwanzig Schritte zurückgelegt, als sich das Geräusch flüchtiger menschlicher Tritte vernehmen ließ.
Bewegungslos blieben die beiden stehen und sahen durch das Strauchwerk hindurch etliche Rothäute den schmalen Pfad entlangjagen.
»Späher«, flüsterte der Oneida, als das Geräusch der Tritte verklungen war.
»Sie hatten Eile und daher keine Zeit, unsre Spuren wahrzunehmen«, sagte stilllachend der Jäger.
»Huronen blinde Hunde!«, entgegnete verächtlich der Rote.
»Du kannst recht haben. Ich finde indessen, Oneida, dass allein schon ihre Anwesenheit hier eine sehr bedenkliche Sache ist.«
»Sehr schlimm«, entgegnete die Rothaut. »Späher weit unten gewesen am Fluss, dort sehen weiße Krieger vom Mohawk, jetzt gehen und rufen Thayendanegeas.«
»Den Häuptling der Huronen? Der wäre so nahe schon hier, bei Stanwix? Das fehlte gerade noch!«, knurrte der andere. »Wäre es wahr, bekäme die Rechnung des Generals unter Umständen ein arges Loch. Wie denkst du darüber, Oneida?«
»Sehr schlimm«, entgegnete dieser wieder. »Nicht wissen, ob Huronen schon hier, aber sicher bald da sein. Huronen nichts wissen wollen vom Kampf gegen die Donnerbüchsen des Forts, sie viel mehr lieben den Krieg hinter den Bäumen des Waldes.«
»Wenn das wahr ist, was du vermutest, dann möge der Leibhaftige ihre Leiber mit gesottenen Flintenkugeln spicken«, schimpfte Addy.
»Mein weißer Bruder ebenso gut wissen wie Flinker Biber, dass Huronen gute Gründe haben müssen, wenn sie wie die Hirsche laufen.«
Addy antwortete nicht, sondern drang beschleunigten Schrittes tiefer in das Dickicht.
Befleißigte schon er sich, so unhörbar als möglich vorwärts zu kommen, völlig geräuschlos wie ein Schatten glitt trotz des dichten Unterholzes der Indianer neben ihm her.
Der Boden des Waldes stieg hier stark an und wurde zuletzt sehr steil. Leicht und gelenkig erkletterten die beiden die Anhöhe.
Oben angekommen, stieg der Indianer, ohne des anderen Einverständnis abzuwarten, an einer schlanken Ulme flink wie ein Eichhörnchen empor. Rasch folgte der andere. Im obersten Geäst des Baumes hatten sie nun völlig freie Aussicht weithin über die ganze Gegend.
Auf der einen Seite, in nordwestlicher Richtung, nur etwa drei englische Meilen entfernt, leuchteten auf unbedeutender Bodenerhöhung, beschienen vom Sonnenlicht, die Palisaden des Forts Stanwix herüber. Auf der entgegengesetzten Seite begrenzten die den oberen Lauf des Mohawk umschließenden grünen Höhenzüge den Horizont. Am Fuß der Höhe aber, auf welcher sich die beiden befanden, führte ein Waldweg in der Richtung auf Oriskany, der westlichsten Niederlassung des Mohawktales, der bis auf etliche englische Meilen weit mit dem Auge zu verfolgen war. Nur auf eine kurze Strecke verschwand er und dort zog er sich schluchtartig zwischen zwei eng zusammengerückten Höhen hindurch, die beide, die östliche wie die westliche, mit dichtem Wald bedeckt waren.
»Hugh!«, rief leise der Indianer und deutete nach Osten. »Dort der Häuptling der Krieger vom Mohawk.« Er zeigte auf eine graubraune in steter Bewegung befindliche Masse, die jenseits der Schlucht, etwa noch eine Meile von ihr entfernt, gleich einer dünnen Riesenschlange auf dem Waldweg einherzog.
Leuchtenden Auges ließ auch der Jäger seine Blicke eine Weile auf der Truppe ruhen. Plötzlich aber verfinsterten sich seine Züge. »Und was hältst du von der Rauchsäule, Oneida«, fragte er den Indianer, »die dort auf der Höhe nächst der Schlucht in die Luft emporsteigt?«
»Dort Huronen – das sehr schlimm!«
»Warum sollen nun gerade Huronen das Feuer entzündet haben?«
»Späher – Späher! Dort großes Feuer, auf den anderen Bergen brennen kleines Feuer, überall Feuer. Kleines Feuer rufen Thayendanegea zu großem Feuer. Sehr schlimm, wenn Mohawk-Krieger die Feuer auf den Bergen nicht bemerken!«
»Das könnte unter Umständen verhängnisvoll werden für die Truppe, vielleicht just in jener Schlucht.«
»Wenn dort Huronen hinter den Bäumen des Waldes, dann sehr schlimm um Sache der weißen Männer. Hugh!«, rief leise der Indianer und deutete nach Osten. »Dort der Häuptling der Krieger vom Mohawk.«
»Glaubst du«, fragte der Jäger, »dass ein Mensch imstande ist, dem General von hier aus entgegenzulaufen, ehe er mit seinen Kriegern in die Schlucht dort eintritt?«
»Weg sehr weit, sehr weit!«
»Da hast du wieder einmal unzweifelhaft recht, Oneida, und zudem dürfte mancher Hurone hindernd dazwischen stehen. Aber das alles soll mich nicht abhalten, wenigstens den Versuch zu unternehmen.«
»Sehr gut, wenn Addy den Häuptling der Mohawk-Krieger warnen. Mein weißer Bruder müssen aber sehr eilen.«
»Natürlich muss ich das und ich darf mit dem Aufbruch keine Sekunde mehr säumen. Gehab dich wohl, Rothaut. Lass dich bald wieder einmal sehen, hörst du?«
Der Indianer gab eine zustimmende Antwort, die der Weiße aber nicht mehr vernahm, denn er hatte sich bereits mit größter Schnelligkeit am Stamm niedergelassen. Von dort lief er mit der Eile eines gehetzten Wildes die dem Waldweg entgegengesetzt liegende Berglehne hinab und setzte, in der Niederung angelangt, seinen Lauf in der Richtung auf die Schlucht in größter Eile durch dick und dünn fort. Der Jäger wusste sich hier in verhältnismäßiger Sicherheit, lagen doch die auf den Höhen verstreuten Rauchsäulen alle jenseits des Waldweges.
Und weiter ging es.
Addy bemerkte mit Genugtuung, dass das Unterholz nach und nach dünner wurde; kam er doch jetzt schon leichter vorwärts. Bereits aber lief ihm der Schweiß von der Stirn, sein Atem begann zu keuchen.
Der Jäger glaubte noch während des Abstieges vom Baum bemerkt zu haben, dass die Spitze der Kolonne ihren Marsch unterbrochen hatte. Blieben die Truppen nur noch einige Zeit aus irgendeinem Grunde stehen, dann hoffte er, die zwei Meilen noch rechtzeitig hinter sich zu bringen. Gelang ihm dies aber nicht, dann freilich konnte es schlimm genug werden. Hoffentlich würde der Kommandant so klug sein, die beiden Höhen sorgfältig auskundschaften zu lassen, ehe er es wagte, mit seinen Leuten in die Schlucht einzutreten.
Und wenn der General dieses dennoch unterließ? Doch nein, eine solche Unvermeidlichkeit war diesem erprobten Kriegsmann denn doch nicht zuzutrauen.
Aber aufs Neue trieb das erhitzte Blut dem Jäger allerlei Befürchtungen ins Gehirn. Er vergrößerte seine Anstrengungen, seine Brust begann sich stürmisch zu heben und zu senken, sein Puls hämmerte gewaltig. Doch mit unverminderter Kraft strebte er vorwärts.
Schon musste er die Hälfte der Strecke hinter sich haben und nun kam er allgemach auf ein Gelände, wo ihm jeder Baum und jeder Strauch bekannt war. Da würde er noch leichter vorwärts kommen.
Viel kam aber nun darauf an, ob die Rothäute beide Höhen, von welchen die Schlucht gebildet wurde, besetzt hielten. War die östliche frei, und das musste sich bald zeigen, dann wollte er dicht an ihrem Fuß vorbei, andernfalls musste er einen großen Bogen schlagen.
Schon lag der nach dieser Seite mäßig abfallende Hügel auf Büchsenschussnähe vor ihm. Nun hielt er geduckt hinter einem Baumstamm.
Er sah scharf hinauf auf die Höhe, beobachtete im Flug jeden Baum, jeden Strauch, jede Erdfalte … nichts verriet auf dieser Seite die Anwesenheit eines Feindes.
Addy berechnete, wie lange er gelaufen war und ob dagegen die Kolonne, wenn sie etwa doch weitermarschiert sein sollte, den Eingang der Schlucht schon erreicht haben könne.
Seine Rechnung fiel ungünstig genug aus.
Dies trieb ihn aufs Neue zur äußersten Anstrengung. In wildem Lauf stürmte er vorwärts und erreichte kurz darauf den Fuß des Hügels.
Schon war er auch hier eine ziemliche Strecke vorgedrungen, als ihm plötzlich ein neuer Gedanke durch den Kopf schoss.
Wie, wenn er die Höhe erstieg und allein mit den Huronen anband, ob sie nun hüben oder drüben im Hinterhalt lagen? Nur wenige Schüsse über die Schlucht hinweg mussten den General warnen.
Schnell bog er ab und stieg die Anhöhe empor.
Schon hatte er die Hälfte derselben unter sich, ohne bisher auf einen Feind gestoßen zu sein, schon sagte er sich, dass sein Plan gelingen werde, als ihm plötzlich schwindlig und schwarz vor den Augen wurde.
Er hatte seinem Körper denn doch eine zu große Anstrengung zugemutet.
Er begann zu taumeln, seine Beine versagten mit einem Mal den Dienst. Schwer schlug seine Schulter gegen einen Baumstamm. Mit einem Schmerzenslaut sank er auf die Erde. Betäubt lag er eine Weile.
Endlich regten sich seine Lebensgeister wieder.
Auf die Knie sich emporraffend, setzte er das Zündhütchen auf den Piston seiner Büchse, um sie dann sofort blindlings abzufeuern.
Als sei der Knall derselben imstande, ein hundertfältiges Echo hervorzurufen, krachten in diesem Augenblicke schnell hintereinander unzählige Schüsse und gleich darauf ließ aus Hunderten von rauen Kehlen indianisches Kriegsgeschrei sich vernehmen.
Dies riss den Jäger aus seiner Betäubung vollends empor. So schnell es seine Erschöpfung gestattete, erstieg er den Rest der Anhöhe.
Oben angelangt, bot sich ihm ein grausiger Anblick dar.
Der größere Teil der kleinen Streitmacht hatte die Schlucht, deren morastiger Boden nur durch einen Prügeldamm einigermaßen gangbar gemacht war, bereits passiert und war schon im Begriff gewesen, auf dem Waldweg die jenseitige Talerweiterung hinaufzusteigen.
Der General, kenntlich an seinem Schimmel, musste unbegreiflicherweise allen voran die Schlucht durchritten haben.
In dem tiefsten Teil der Talsenkung, in der morastigen Schlucht, steckten die Gepäckwagen. Jenseits derselben befand sich etwa noch der vierte Teil der ganzen Streitmacht.
Dort war es, wo die Indianer zuerst aus dem Wald des westlichen Berghanges hervorgebrochen sein mussten, den bereits jenseits angelangten Truppen den Rückweg zu verlegen und zugleich die Verbindung der Nachhut mit dem Hauptkorps abzuschneiden.
Zahlreich lagen jenseits der Gepäckwagen stumme Zeugen umher, dass hier ein kurzer, aber wütender Kampf stattgefunden haben musste. Dem Ausgang der Talenge drängte sich ein dichter Menschenknäuel zu, aus dessen wildwogendem Gewirr verhältnismäßig nur wenige Bauernkittel zu unterscheiden waren.
Noch immer aber brachen ganze Horden fast nackter, teuflisch bemalter Wilden hinter den Bäumen des Abhanges hervor und stürzten sich mit gellendem Geheul auf ihre Opfer.
Mit düster glühenden Blicken, die blutlosen Lippen unmutsvoll aufeinanderpressend, sah der Jäger auf die grauenvolle Szene herab.
Er sagte sich, dass dort unten jegliche Hilfe umsonst sei, dass, wer nicht vermochte, durch die Flucht sich zu retten, unbarmherzig niedergemacht, dass diese ganze Nachhut aufgerieben würde.
Dann flogen seine Blicke hinüber zu dem Mann auf dem Schimmel, der mit kräftiger Stimme Befehle erteilte, die aber, da sie durch das Kampfgetöse und Kriegsgeheul vom anderen Ende her übertönt wurden, nur von einem kleinen Teil seiner Truppe und auch hier oben auf der Höhe nicht verstanden werden konnten.
Nun gewahrte der Jäger zu seinem Schrecken unmittelbar unter sich vereinzelte Männer plötzlich zur Erde sinken.
Er erkannte sofort, dass auch die Hauptkolonne angegriffen wurde, dass sie einem unsichtbaren Feind gegenüberstand, der es mit voller Berechnung unterließ, von der Büchse Gebrauch zu machen, vielmehr aus taktischen Gründen es vorzog, sich des geräuschlosen Pfeiles zu bedienen, der in der Hand des Wilden aber eine nicht minder mörderische Waffe ist.
Addy erriet unschwer, dass die Befehle des Generals nichts anderes bezweckten, als seine Leute zunächst so rasch wie möglich aus dem Hohlweg herauszuziehen und sie weiter oben, wo das Tal sich erweiterte, zu sammeln, um sie dort im Wald in eine der feindlichen Stellung gleichwertige Stellung zu bringen.
Dies erkennend trat der Jäger entschlossen hinter dem Baumstamm, den er sich zur Deckung erwählt hatte, hervor und sprang in weiten Sätzen die steile Berglehne zu Tal. Er eilte den hier haltenden Offizieren und Mannschaften entlang und rief ihnen zu, man möge trachten, so schnell wie möglich dem General nachzueilen, den oberen Ausgang der Schlucht zu gewinnen.
Schon sein Erscheinen bewirkte Wunder und benahm der Truppe einigermaßen die grenzenlose Verwirrung, in die sie durch den plötzlichen Überfall geraten war. Laute Freudenrufe schallten ihm entgegen und die einzelnen Unterbefehlshaber, die ihren Kopf vollständig verloren hatten, bemühten sich sofort, dem ergangenen Gebot gerecht zu werden.
Kaum aber hatte sich die Bewegung, die sich nun in der Kolonne geltend machte, erkennen lassen, als auch der bisher unsichtbare Feind seine Taktik änderte.
Plötzlich brachen, wie zuvor im untersten Teil der Schlucht, die Indianer gruppenweise aus ihren Verstecken hervor und stürzten sich mit gellendem Kriegsruf auf die Weißen.
Wohl an zehn Stellen entbrannte das erbittertste Handgemenge. Bald bildeten die Kämpfenden einen unentwirrbaren Menschenknäuel.
Die Bauern hatten indessen den ersten Schrecken, den das plötzliche Anstürmen und das geradezu teuflische Aussehen der bunt bemalten und fast nackten Rothäute auf sie ausübte, schnell überwunden und setzten nun dem Tomahawk ihr Messer oder den Kolben ihrer schweren Büchse entgegen.
Den kräftigen Widerstand, den die Indianer fanden, mochten sie wohl kaum erwartet haben.
Ihr markdurchdringendes Geheul ließ mit einem Mal nach, verstummte endlich ganz. Nunmehr vollzog sich der mörderische Kampf unter einer unheimlichen Stille.
Brust an Brust rangen die Gegner und wehe dem Schwächeren, demjenigen, der sich eine Blöße gab. Unbarmherzig senkte sich der kalte Stahl in seine Brust. Mit der Kraft und dem Mut des Löwen stürzte sich Addy in das dichteste Kampfgewühl.
Gleich zu Anfang hatte er einem riesigen Wilden gegenübergestanden und war geschickt dem Wurf des Tomahawk ausgewichen. Er sprang mit einem Riesensatz gegen die Rothaut an und streckte sie mit einem einzigen Faustschlag nieder.
Schnell bemächtigte sich der Jäger des Kriegsbeiles und dieses erwies sich in dessen Hand nun als eine furchtbare Waffe.
Aalglatt wusste er selbst im dichtesten Menschenhaufen den Waffen der Indianer auszuweichen, zugleich aber sauste die Spitze seines Beiles bald hier bald dort unbarmherzig auf ein Huronenhaupt nieder.
Vielen Kameraden, die in dem fürchterlichen Ringen bereits zu erlahmen drohten, rettete er auf solche Weise das Leben. Wo er in seiner umsichtigen und zugleich stürmischen Weise eingriff, da war der Kampf bald entschieden.
»Brav gemacht, Addy!«, scholl es durch die Reihen, als der Rest der Wilden, durch den ungeahnten heftigen Widerstand der Bauern eingeschüchtert, nach und nach auf der ganzen Strecke sich zurückzog und des Jägers Tomahawk, gleichsam als Finale der schauerlichen Blutarbeit, hoch im Bogen hinter einigen Rothäuten herfuhr.
Doch es sollte noch schlimmer kommen.
Wohl gelang es nun der Kolonne, die Schlucht zu verlassen und die obere Talerweiterung zu gewinnen, doch hier oben hatte sich unterdessen zwischen dem vordersten Teil der Kolonne und dem Feind ein Kampf entsponnen, der nicht minder mörderisch war.
Man befand sich hier offenbar der zum Glück etwas später eingetroffenen indianischen Hauptmacht gegenüber, die hinter den Stämmen des Urwalds hervor unablässig feuerte und mit unheimlicher Hartnäckigkeit von Baum zu Baum näher rückte.
General Herckheimer kämpfte in den vordersten Reihen und war darauf gefasst, dass es binnen kürzester Frist zum Handgemenge kommen werde. Er hatte längst erwogen, ob er nicht dem Feind mit einem entschlossenen kraftvollen Angriff zuvorkommen solle, doch die kleine Schar der Getreuen, die um ihn versammelt geblieben war, ließ das als ein allzu großes Wagnis erscheinen, zumal man die Stärke der Gegner auch nicht schätzungsweise zu übersehen vermochte.
Umso mehr gereichte es Herckheimer zur Genugtuung, als nun die in der Schlucht zurückgebliebenen Leute Zug um Zug auf dem Kampfplatz eintrafen.
Er erteilte sofort die geeigneten Befehle, die Streitmacht in der vorteilhaftesten Weise zu postieren, und war, um einem etwaigen Sturmlauf des Feindes kräftig zu begegnen, bemüht, sie angemessen zusammenzuschließen.
Derjenige, dem der verhältnismäßig glückliche Ausgang des Kampfes in der Schlucht in erster Linie zu danken war, Addy, verließ, um den Abzug der Kameraden zu decken, mit einigen der streitbarsten Männer als Letzter die Talenge.
Die verloren gewesene Ordnung war nun schnell wieder einigermaßen hergestellt, wusste doch der General durch Ruhe und Umsicht seine Leute zur höchsten Energie zu entflammen.
Er hatte Befehl gegeben, durch eine seitliche Schwenkung der Flügel die Flanken der Stellung zu decken, und hatte auch den Rücken der Stellung in geeigneter Weise sichern lassen.
Inzwischen waren aber die Rothäute wieder erheblich vorgerückt und schossen in der Entfernung von kaum noch dreißig Schritten.
Aber die Bauern waren unterdessen ruhiger geworden. Im Schutze von Bäumen stehend, teils flach auf dem Boden liegend, nahmen sie das Feuer des grimmen Feindes nun mit Kaltblütigkeit auf.
Wo irgendein federgeschmückter Kopf oder ein nackter braunroter Leib sich blicken ließ, da musste er seine Vorwitzigkeit empfindlich büßen.
Der General war wie immer auch nun wieder im vordersten Treffen. Bald da, bald dort Anordnungen treffend, feuerte er seine Leute zugleich zum hartnäckigsten Widerstand an. Es war ihm klar, hier gab es nur noch eine Rettung: Kampf und Widerstand bis zum Äußerstes.
Das feindliche Feuer wurde immer lebhafter, es nahm von Minute zu Minute zu. Der Kugel- und Pfeilregen wurde binnen kurzer Zeit so heftig, dass auch der General es für geraten hielt, hinter einem Baumstamm Schutz zu suchen.
Herckheimer war dadurch neben einen wenig kriegerisch aussehenden jungen Mann zu stehen gekommen und sagte demselben einige ermunternde Worte.
Im Begriff, sich von ihm wieder abzuwenden, tauchte hinter einem Busch plötzlich ein baumlanger Hurone auf, der mit wildem Kriegsruf und geschwungenem Tomahawk nach vorn stürmte, den frei dastehenden General erblickte und auf diesen losstürzte.
Der junge Mann, der neben Herckheimer hinter dem Baum am Boden kauerte, hielt die Büchse im Anschlag. »Schieß – gib es ihm!«, schrie der General dem jungen Menschen zu.
Ein Leichtes wäre es dem Schützen gewesen, den Wilden niederzuknallen. Statt aber das Gebot zu befolgen, stieß er einen Schreckensruf aus und machte sich feige davon.
Mindestens ein halbes Dutzend Büchsenläufe richtete sich auf den Indianer.
Der General gewahrte es und ein schmerzliches Lächeln umspielte seine Lippen.
Doch hier war keine Zeit zu verlieren, es galt zu handeln. Den Säbel zur Abwehr ausgelegt, erwartete Herckheimer festen Fußes den Wilden.
Dieser hielt in seinem Lauf an, das Kriegsbeil mit mächtigem Schwung zum Wurf erhoben.
Alles dies hatte sich in nur wenigen Sekunden abgespielt. Doch nun, in diesem kritischen Augenblick, richtete sich mindestens ein halbes Dutzend Büchsenläufe auf den Indianer. Von ebenso vielen Kugeln durchbohrt brach dieser, das Beil zur Erde fallen lassend, zusammen.
Ein vielstimmiges »Bravo« der Leute ringsum lohnte die befreiende Tat.
Dem jungen Schützen aber, dem der General vergeblich die Aufforderung zum Schießen zugerufen hatte, sollte eine sofortige Lektion für sein feiges Verhalten nicht erspart bleiben.
Wenige Schritte nur hinter ihm stand zur selben Zeit ein mittelgroßer, gedrungen gebauter Mann im grünen Jägerrock, hirschledernen Kniehosen und grünen Wadenstrümpfen. Auf seinem Kopf saß, keck auf das linke Ohr geschoben, ein kleines, verschossenes, graues Filzhütchen, von dem ein buschiger Gemsbart emporragte und eine grüne Troddel niederhing. Das ganze Aussehen des Mannes ließ schließen, dass er ein Kind der deutschen Alpen war.
Dieser hatte den Vorgang mit angesehen und sofort die Büchse gegen den Huronen erhoben, hatte aber, da der General zuletzt fast genau in derselben Linie stand, keinen sicheren Abschuss.
Sofort ließ der Mann die Mündung seiner Büchse sinken und war im Begriff, dem Bedrohten mit dem Messer in der Faust zu Hilfe zu eilen, als der Hurone bereits zur Erde sank.
In diesem Augenblick wollte der feige Ausreißer an diesem Mann vorbei, doch der erwischte den jungen Menschen flink am Rockkragen und drehte ihn mit einem einzigen gewaltigen Ruck so herum, dass er dicht vor ihn zu stehen kam.
»Feige Hundeseele, du!«, schrie der Grünrock. Ein Ausdruck von unbeschreiblicher Verachtung malte sich in seinen verwitterten Zügen. Unwillkürlich erhob er die Hand zum Faustschlag … der andere zuckte zusammen und streckte die Hände zur Abwehr vor. »Hundling«, knurrte der Grüne grimmig wieder, »sollt’ man dich net glei’ derschlag’n?« Er versetzte dem jungen Menschen in wachsender Entrüstung von der Seite her einen so derben Fußtritt, dass dieser zur Erde schlug und von der Wucht des Stoßes noch etliche Schritte weiter kollerte. Ohne sich nach dem Niedergestoßenen umzusehen, sprang der erzürnte Mann nach vorn.
Aber der Strafe für das feige Verhalten schien es für Fred, wie man den jungen Mann im Mohawktal ziemlich allgemein nannte, noch nicht genug zu sein.
Kaum hatte er sich nämlich mühsam aufgerappelt, als er plötzlich Addy gegenüberstand, der ihm breitbeinig den Weg vertrat.
Der Jäger war in dem Augenblick, als der Wilde auf den General zusprang, hinter den Bäumen hervorgetreten und hatte den Vorfall gerade noch mit angesehen.
»Lasst mich!«, schrie der Feigling, als auch Addy drohend die Faust erhob.
»Wahrlich, du hast das rechte Wort getroffen«, erwiderte der Jäger, plötzlich ganz gelassen werdend, und ließ den Arm langsam sinken. »Ich will dir nichts anhaben, denn dich zu berühren, das hieße meine Hand beschmutzen und dir, du feige Hundeseele, zu viel Ehre antun.«
Sprach’s und eilte weiter.
Rasch schlüpfte der junge Mensch hinter den nächsten Baumstamm. Aus den grünlichen, heimtückischen Augen folgte dem Jäger ein Blick voll Hass und Tücke.
Inzwischen hatte sich die Heftigkeit des Kampfes auf der ganzen Linie noch erheblich gesteigert. Die Büchsen knallten ununterbrochen.
Es lag über den Kämpfenden eine eigentümliche Schwüle. Allgemein fühlte man, dass es binnen Kurzem zu einem entscheidenden Schlag kommen müsse. Wohl forderten die wohlgezielten blauen Bohnen der Bauern unter ihren Gegnern viele Opfer, doch hielt das die Rothäute nicht ab, noch immer von Baum zu Baum vorzurücken oder flach in die Erdfalten gedrückt sich vorzuschleichen. Dadurch hatte sich das Feuergefecht bereits auf die Entfernung von zwanzig und fünfzehn Schritten verringert, ja oft standen sich die Gegner nur auf zehn oder noch weniger Schritte gegenüber.
Da erscholl des Herckheimers gewaltige Stimme. Er gebot, dass seine Leute untereinander mehr Fühlung behalten und so viel wie möglich trachten sollten, sich noch enger zusammenzuschließen.
Addy, der inzwischen den General begrüßt und sich ihm zur Verfügung gestellt hatte, rannte als sein freiwilliger Adjutant ungeachtet des heftigsten Kugel- und Pfeilregens unablässig die Reihen entlang, den entlegeneren Abteilungen die Befehle des Kommandierenden zu überbringen und da und dort selbständig einzugreifen, um die oft noch recht kriegsungewohnten jüngeren Leute auf Vorteile oder fehlerhafte Positionen aufmerksam zu machen. Längst war ihm der Hut vom Haupt geschossen und seine Stirn von einer blutgetränkten Binde umschlungen.
Da schien es mit einem Mal, als ob das Beispiel des Wilden, der es kurz zuvor auf den General abgesehen hatte, zur rechten Zeit aber noch niedergestreckt worden war, auf die Rothäute ansteckend gewirkt habe.
Addy befand sich um diese Zeit in der vordersten Schützenlinie, als dicht neben ihm ein Mann seine Büchse abschoss. Deutlich sah der Jäger drüben im Unterholz eine Rothaut zusammenbrechen, aber in demselben Augenblick erhob sich noch keine zehn Schritte weit, wie aus der Erde gewachsen, ein Hurone, setzte mit einem Sprung durch die Rauchwolke, die noch vor dem Schützen lag, und zerschmetterte dem Unglücklichen mit einem wuchtigen Hieb seines Tomahawks den Schädel.
Mit Gedankenschnelle legte Addy den Kolben seiner Büchse an die Wange, und auch dieser rote Krieger hatte zum letzten Mal sein Mordbeil geschwungen.
Aber nicht nur hier, auf der ganzen Gefechtslinie schienen die Indianer nun diese Taktik zu befolgen.
Hatte einer der Weißen hinter einem Baum hervor seine Büchse abgefeuert, lief ihm, ehe er Zeit fand, den Lauf wieder zu laden, plötzlich eine Rothaut entgegen. Wehe dem Schützen, wenn er sich der furchtbaren Waffe des Indianers nicht erwehren konnte.
Und es war erschreckend. Auf der ganzen Linie, wohin man blicken konnte, kam es nun zu solchen Einzelkämpfen; der Tomahawk wütete fürchterlich.
Aber dank der Einwirkung des tapferen, umsichtigen Jägers, der mit beispielloser Beweglichkeit bald hier, bald dort war und sofort erkannt hatte, dass ein wohlberechnetes System in dieser Kampfesart lag, begriffen die Bauern vom Mohawktal bald, wie sie dieser Kampfesweise des Feindes zu begegnen hatten. Nur noch mit dem Messer in der Faust oder zwischen den Zähnen feuerten sie ihre Büchsen ab, wichen dem anstürmenden Feind, der mitten in die zurückgebliebene Rauchwolke hineinsprang, geschickt aus und zahlten so ihre anfänglichen Verluste blutig heim.
Da machte sich plötzlich im Zentrum der Stellung eine besonders stürmische Bewegung geltend.
Ein Schimmel sprengte wie toll geworden zwischen den Bäumen umher und richtete durch sein ungebärdiges Umherschlagen unter den Schützen, die hier dicht gedrängt nebeneinander lagen, die größte Verwirrung an.
Es war des Generals Reitpferd. Das Tier hatte eine Kugel empfangen und raste in seinem Schmerz blindlings gegen die Urwaldstämme, bis es sich endlich die Stirn schwer verletzte und dann keuchend zusammenbrach.
Kaum hatten die Indianer den Vorgang wahrgenommen, als sie aufsprangen und mit verdoppelter Wucht hier vordrängten, unverkennbar in der Absicht, sich die augenblickliche Verwirrung nach besten Kräften zunutze zu machen.
Der General gewahrte zuerst die Gefahr und stürzte sich mit dem blanken Säbel in der Faust den Indianern entgegen. Die Warnrufe des tapferen Mannes brachten seine Leute schnell wieder zur Besinnung, ja das mutige Beispiel begeisterte sie dermaßen, dass sie sich mit Todesverachtung dem stürmenden Feind entgegenwarfen.
Ein fürchterliches Ringen entstand.
Wuchtig durchpfiff die Schneide der Kriegsbeile die Luft, aber ebenso nachdrücklich und hageldicht fielen die Hiebe der Büchsenkolben.
Mehrere Minuten lang wogte der Kampf hin und her, allgemach aber neigte sich das Zünglein der Waage zu Ungunsten der Rothäute, und sie mussten sich, wollten sie nicht völlig niedergeschlagen werden, in ihre Stellung zurückziehen.
Ein kurzer Stillstand trat an dieser Stelle nun ein, einer jener Augenblicke, in welchen Freund und Feind, bis zur Erschöpfung mitgenommen, nach Atem ringen, und die Büchsen schwiegen.
Da stieg plötzlich drüben, wo die Indianer im Holz verschwunden waren, eine einzelne kleine Rauchwolke auf, ein scharfer Knall folgte und fast gleichzeitig sank General Herckheimer auf das linke Bein.
Die nächststehenden Leute hatten das wohl bemerkt und liefen eilig herbei, dem Verwundeten hilfreich zur Seite zu stehen, doch der General winkte energisch ab, stützte sich auf die Schulter des Grünrocks, der gerade dicht neben ihm stand, und humpelte mit dessen Unterstützung etliche Schritte zurück.
Gegen einen alten Baumstamm gelehnt, gab Herckheimer, als sei nichts geschehen, mit lauter Stimme den Befehl, den Kampf, unbeirrt um seine Person, sofort wieder aufzunehmen.
Dieser einzelne Schuss war aber überhaupt das Signal zur Wiederaufnahme des Feuergefechts gewesen. Sofort entspann sich auf beiden Seiten wieder das lebhafteste Büchsenknallen. Trotzdem unterließen es die Leute der nächsten Umgebung des Generals nicht, ab und zu einen besorgten, forschenden Blick nach ihm hinüberzuwerfen. Bald hatte sich unter den Bauern die Kunde von der Verwundung des geliebten und verehrten Führers von Mund zu Mund weiter gesprochen. Von allen Seiten schickten die Unterbefehlshaber Boten, sich nach seinem Befinden zu erkundigen, die er aber sämtlich in seiner kurzen barschen Weise damit abfertigte, dass es sich nur um eine unbedeutende Schramme handle. Die Hauptleute sollten zusehen, dass sie sich die roten Teufel so weit wie möglich vom eigenen Halse hielten, das wäre viel wichtiger.
Auch Addy kam in seiner vorsichtigen Weise, die ihn nie verließ, herbeigesprungen, suchte Schutz hinter einem benachbarten Baum und knurrte von dorther den Verwundeten in einer Tonart an, die überraschen musste und nur unter der Voraussetzung einer gewissen Vertraulichkeit zwischen den beiden möglich sein konnte.
Der General lächelte gutmütig. »Wo bleibt«, fragte er, »der Respekt, den du dem Oberstkommandierenden schuldig bist?«
»Respekt?«, versetzte der Jäger. »Ihr wisst es wohl, dass ich es nie daran mangeln ließ.«
»Du hast mich eben jetzt in einer Weise angefahren, als wenn du der General und ich der Adam Hartmann wäre.«
»Soll man das nicht«, brauste der Jäger auf, »wenn Ihr Euch frei hinstellt, als schössen die Roten mit Preiselbeeren?«
»Du willst doch nicht, dass ich es etwa machen soll wie der Fred?«
»Für Witze ist Zeit und Gelegenheit schlecht gewählt«, entgegnete ernst der Jäger. »Ich will Euch etwas sagen. Ihr habt die heilige Pflicht, uns aus dieser unseligen Patsche herauszuhauen, ja noch mehr, zum Sieg zu führen. Da ist meine Meinung, dass der Mann, dem diese Aufgabe obliegt, nicht ins erste Treffen, sondern ein gutes Stück hinter die Front gehört. Und damit Punktum!«
»Und ich sage dir, dass du deine Weisheit für dich behalten sollst, denn wo ich hingehöre, das will und kann nur ich beurteilen.«
»Auch jetzt seid Ihr noch zu weit vorn«, versetzte der Jäger hartnäckig. Er wollte seinen Worten die Tat sogleich folgen lassen und schickte sich an, den General zu umfassen, um ihn weiter zurückzuführen.
Dieser aber drängte Addy unsanft von sich und gebot fast rau: »Lass das! Ich weiche keinen Schritt von hier – ich will dem Feind ins Gesicht sehen. Damit ebenfalls Punktum!«
Erst glitt es wie Unmut über des Jägers Züge, dann aber blickte er mit einem seltsamen Gemisch von Ärger, Liebe und bewunderndem Stolz zu dem stattlichen Mann auf. »Sagt, wie steht es eigentlich mit der Wunde?«, fragte der Jäger über eine Weile.
»Es ist nichts!«
»Das glaube, wer will!«
»Es ist nichts!«, verwies ihn noch einmal fast ärgerlich der General.
»Aber ich sehe doch das helle Blut aus Euren Hosen rinnen!«
»Dann sieh nach«, entschied nach einigem Bedenken Herckheimer. »Aber lass dir gesagt sein, gewahrst du mehr als eine Schramme, dann erzähle es nicht jedem, der es wissen will!«
Der Jäger zog sein Messer, schlitzte dem General ohne Weiteres von unten her die Pantalons auf und entdeckte, dass etwa sechs Zoll unter dem Knie eine Kugel in das Bein eingedrungen war, die den Knochen offenbar zerschmettert haben musste. Addy konnte nicht begreifen, wie der Verwundete so kaltblütig von einer Schramme sprechen und so standhaft auf dem anderen Fuß auszuhalten vermochte. Der Jäger hielt es für geraten, selbst dem General die Schwere der Verwundung zu verheimlichen, aber er bat ihn wieder mit eindringlichen Worten, eine bequemere und geschütztere Stellung aufzusuchen, doch Herckheimer wollte von diesem Ansinnen nichts wissen.
Vorn tobte der Kampf unterdessen in seiner ganzen Heftigkeit weiter. Mit seinen Glutaugen den Gang des Gefechtes beobachtend, teilte der Verwundete mit unverminderter Energie und kraftvoller Stimme nach rechts und links wieder eine Reihe von Befehlen aus.
Addy hatte inzwischen aus seiner Jagdtasche einen Leinwandfetzen hervorgezogen und machte sich daran, dem verwundeten Bein einen Verband umzulegen, der wenigstens das Blut stillen sollte. Doch der Jäger hatte dabei einen recht schweren Stand, denn ganz hingenommen von dem Gang des Kampfes stand der General nie still und zuckte nur dann zusammen, wenn er sich so weit vergaß, auch das lahmgeschossene Bein gebrauchen zu wollen.
Die Büchsen donnerten währenddessen unablässig. Wieder war eine große Anzahl Indianer in rascher Aufeinanderfolge ungestüm gegen die Schützen vorgesprungen, worauf sich, wie zuvor, wieder furchtbare Einzelkämpfe entwickelten.
So viele Opfer dieses Ringen von Mann zu Mann aber auch forderte, Herckheimer sah es mit freudiger Genugtuung, die braven Bauern hielten wacker stand. Fast heiteren Antlitzes zog er den Tabakbeutel hervor und stopfte mit Gemütsruhe seine kurze Pfeife. Als Addy mit seinem Samariterdienst fertig war, bat er diesen um Stahl und Schwamm.
Aber dieses letzte ungestüme Vorgehen der Rothäute war im Grunde nur eine Finte. Das scharfe und wachsame Auge Herckheimers hatte das noch rechtzeitig erkannt.
Während nämlich ein großer Teil der roten Leute in der vordersten Front kämpfte, zog sich die kleinere Hälfte auf dem Boden schleichend und kriechend langsam zurück und verschwand in den weiter hinten liegenden Dickungen.
Addy hatte inzwischen aus seiner Jagdtasche einen Leinwandfetzen hervorgezogen und machte sich daran, dem verwundeten Bein einen Verband umzulegen.
Herckheimer witterte darin eine neue Gefahr. Er sagte sich, dass die Indianer des heftigen Widerstandes, den sie in der Front fanden, müde seien, dass sie offenbar versuchen wollten, die Stellung zu umgehen. Kurze Zeit darauf sah man auch weiter hinten kleinere Abteilungen roter Leute auftauchen, die bald rechts, bald links auseinandereilten. Der General gab sofort die entsprechenden Befehle.
Als dann eine halbe Stunde später die Rothäute tatsächlich zu ganzen Haufen die Stellung von rückwärts anzugreifen begannen, fanden sie die Deutschen bereits so eng zusammengezogen, dass sie einen Kreis bildeten und so in enggeschlossenen Schützenketten dem grimmigen Feinde tapfer nach allen Seiten die Stirn darboten.
Als der Kampf diese Wendung genommen hatte, war es noch früh am Tage, kaum erst Mittag.
Bisher hatte die Sonne freundlich vom Himmel niedergeleuchtet, nun aber wurde es unter den mächtigen Kronen des ziemlich dichten Waldes mit einem Mal fast abendlich dunkel.
In der Hitze des Kampfes hatten es die wenigsten bemerkt, dass allmählich eine dunkle Regenwolke aus Ost heraufgezogen kam, die nun finster und drohend im Zenit stand. Schon fielen die ersten schweren Tropfen, und nach wenigen Minuten zeigte Jupiter Pluvius sein unfreundlichstes Gesicht. Der Regen goss in Strömen.
»Eine nette Bescherung«, sagte Herckheimer, an den Jäger gewendet, der sofort den Verschluss seines Pulverhorns untersuchte und das Schloss der Büchse sorgsam unter die Achselhöhle schob.
»Das ist es, General. Aber der Regen spielt den nackten Teufeln drüben mindestens ebenso übel mit wie uns, und wir haben eine Weile Ruhe.«
In der Tat erstarb das Büchsengeknatter und das Kriegsgeschrei der Wilden mit einem Mal fast ganz, goss es nun doch vom Himmel, dass man keine drei Schritte zu sehen vermochte.
»Wir wollen die Pause nutzen«, wendete der General über eine Weile sich wieder an den Jäger. »Nimm deine Augen in die Hand, mach schnell eine Runde und sieh zu, dass die Kompanieführer ihre Leute dazu anhalten, Pulver und Pfannen trocken zu halten. Sodann sollen sie sich für den Augenblick vorsehen, wenn der Tanz wieder losgeht. Ich lasse sie bitten, hinter jeden Baum nicht einen, sondern zwei Mann zu stellen – du verstehst: der eine schießt – springt die Rothaut dann an, hat der andere die Kugel noch im Lauf.«
»Dieser Plan ist gut, General, er soll den Roten übel genug bekommen!«
»Sag den Hauptleuten ferner, sie sollen sich um ebenso viel Raum, als durch die Doppelstellung der Leute erübrigt wird, noch dichter zusammenschließen, keine Lücke lassen! Sag ihnen, wenn sie danach fragen sollten, dass ich ganz munter bin!«
Im nächsten Augenblick war Addy verschwunden.
Herckheimer tat einige tiefe Züge aus seiner Pfeife und rief dann den hinter dem nächsten Baum stehenden Mann herbei. Es war der Grünrock.
»Na, Franzl«, redete der General den Mann an, »wie kommt es, dass du nicht ganz vorn bist?«
»Der Addy hat mir extra auf’trag’n, dass i um Euch bleib’n soll, und wie’n i sieh, könnt Ihr mi’ ja ganz gut brauchen.«
»Na, dann nimm meinem Schimmel dort den Sattel ab und bringe ihn hierher. Das lange Stillstehen macht mich müde.«
Der Mann gehorchte. Er brachte den Sattel, den er zu Füßen des Stammes auf das Moos legte und war dann dem Verwundeten behilflich, sich auf dem so geschaffenen Sitz niederzulassen. Das ging nun recht schwer und der Grünrock fragte: »G’steht’s – ‘s hat Enk fest ‘packt?«
»Ach was«, entgegnete Herckheimer, »ein ordentliches Pflaster drauf und die Geschichte wird sich schon wieder machen.«
Der General strafte aber seine Worte Lügen, denn er wurde nun mit einem Mal um einige Schatten bleicher. Schien er auch von großer Willensstärke und nicht minder großer Widerstandskraft zu sein, der starke Blutverlust hatte seinem Allgemeinbefinden ohne Zweifel doch hart zugesetzt. Er schauerte einige Mal merklich zusammen und dies entging nicht dem Grünrock. Zögernd zog dieser ein Schnapsfläschchen aus seiner Brusttasche und bot dem General zu trinken an. »Er is zwar net vom best’n«, sagte er, »aber er is a net schlecht, er macht schön warm – i denk, a Schluckl kunnt’ Enk bei dem Malefizreg’n net schad’n.«
Ohne Umstände langte der General zu. »Auf deine Gesundheit, Franzl«, entgegnete er und nahm einen artigen Schluck. »Wenn du wieder mal an meiner Farm vorüberkommst, dann bring deine größte Flasche mit. Ich will dir den Trunk von meinem Besten ersetzen – vorausgesetzt, dass uns die Roten überhaupt hier von der Stelle lassen.«
»Dös war net üb’l«, grollte der Grüne.
»Glaubst du, dass wir ihrer noch Herr werden?«
»Und ob! Hieb krieg’n’s – könnt’s Enk drauf verlass’n.«
Der General lächelte und legte zum Schutz gegen den Regen die Hand über den Kopf seiner brennenden Pfeife.
Es goss nun in Strömen.
Von dem dichten Blätterdach der Bäume und von den Hüten und Kleidern der Männer troff und rieselte das Wasser bereits in kleinen Bächlein.
Aber es dauerte nicht lange, da wurde es schon wieder etwas heller. In nicht allzu langer Zeit musste das Wetter vorüber sein.
Da kam Addy wieder herbei und meldete, dass die gegebenen Befehle sofort ausgeführt würden.
Der General ließ sich sodann von dem Jäger Bericht über den Gang des Gefechtes in der Schlucht erstatten.
Addy schilderte kurz und knapp die Vorgänge und konnte am Schluss die etwas unwirsche Bemerkung nicht unterdrücken, dass er sich nicht wenig gewundert habe, die Brigade überhaupt in die Schlucht eintreten zu sehen. Man hätte doch, meinte er, mindestens die beiderseitigen Höhen zuvor genau auskundschaften müssen.
»Da hast du ganz recht«, entgegnete der General, »und an dieser Unvorsichtigkeit bin leider ich schuld.«
»Ihr?«, fragte erstaunt der Jäger. »Dann muss ich schon sagen, dass ich das dem kriegserfahrenen General Herckheimer nicht zugetraut hätte.«
»Und doch ist dem so«, entgegnete dieser. »Es liegt das, möchte ich sagen, in meinem Charakter – du weißt, dass ich mir immer zunächst alles genau besehe und mir überlege, was für und wider zu sagen ist.«
»Dann musstet Ihr aber zweimal zu dem Schluss kommen, dass der Vormarsch ohne vorherige Sicherung im höchsten Grade gewagt war.«
»Das sagte ich mir auch, aber mein Bedenken und Erwägen gefiel den anderen nicht und ich kann es ihnen auch nicht übelnehmen, warum, weil mir diese solide Vernünftigkeit, das bedächtige Überlegen oft den Schein des Schwankenden gibt.«
»Dann habt Ihr Euch also überstimmen und drängen lassen?«
»Die Truppen, die zum größten Teil noch ungeübt sind, brannten vor Begierde, sich mit dem Feind zu messen und fanden an den neugebackenen Offizieren manchen Fürsprecher. Du weißt es vielleicht noch nicht, dass ich einen Boten nach Stanwix sandte, weil mein Plan war, zusammen mit dem Oberst Gansevoort dem Feind entgegenzutreten. Es schien mir das auch um deswillen geboten, weil die Besatzung des Forts zu schwach war, um sich einer überlegenen Macht gegenüber auf die Dauer zu halten. Als ich meine Bedenken gegen den weiteren Vormarsch geltend machte und darauf bestand, mit dem Vorrücken zu warten, bis von Stanwix das verabredete Signal gegeben sei, da warf man mir vieles vor, sogar Mangel an Entschiedenheit und Patriotismus.«
»Wer war es, der das wagte?«
»Allen voran Oberst Fischer, der die Nachhut führte.«
»Nun, dann hat er es schwer genug gebüßt«, bemerkte der Jäger.
»Ich fürchte es auch«, versetzte Herckheimer. »Nach deiner Schilderung kann von denen, die hinter den Gepäckwagen waren, kaum ein Mann mehr übrig sein.«
Stumm und mit dem Ausdruck tiefer Trauer im Antlitz sah der General vor sich nieder.
Langsam hob er dann wieder sein Haupt und fuhr wie im Selbstgespräch weiter: »Aber was nützte es, die Schreier hatten die Mehrzahl der Leute für sich und ich musste widerwillig und gegen meine Ansicht, nur um den Ungehorsam schon im Keim zu ersticken, den Befehl zum Vorrücken geben.«
Addy wollte sich zu einem Einwand anschicken, doch Herckheimer winkte energisch ab.
Der Himmel hatte sich inzwischen aufgeklärt und der Regen nachgelassen. Schon fielen wieder die ersten Schüsse.
Die Bauern standen oder lagen nun dicht gedrängt, kampfesmutig und entschlossener denn je; fühlte doch jeder die nahende Entscheidung.
Das Feuer der Indianer wurde mit jeder Minute lebhafter und die Bauern blieben die Antwort nicht schuldig.
Und wieder verfolgten die roten Krieger alsbald die Taktik, dass sie, sobald der Gegner den Lauf abgefeuert hatte, auf diesen mit erhobenem Kriegsbeil einsprangen.
Doch nun zeigte sich die Wirkung der Herckheimer’schen planmäßigen Anordnung.
Sobald der eine Schütze hinter dem Baum hervorgeschossen hatte, legte der zweite Mann an. Die heranspringende Rothaut, die sich ihres Opfers bereits sicher wähnte, musste ihren Wagemut schwer büßen.
Es kam infolgedessen nun nur selten mehr zu den wilden verzweifelten Einzelkämpfen. Die Rothäute fielen nun schon im Ansprung massenhaft, sodass das schmale Terrain, das zwischen den Gegnern lag, von Leichen und Verwundeten, die im letzten Todeskampf sich wanden, bald förmlich übersät war. Allmählich ließen in demselben Maß, wie die Bauern mit jedem niedergestreckten Feind an Zuversicht gewannen, die wütenden Angriffe der Indianer nach.
Schon fühlten sich die Deutschen als die Herren des Gefechtsfeldes und begannen bereits da und dort in laute Jubelrufe auszubrechen, als plötzlich im Norden der Stellung englische Uniformen sichtbar wurden, die das fast schon verstummt gewesene Feuer der Indianer mit verdoppeltem Nachdruck aufnahmen.
Sofort erkannten der General und seine Leute, dass sie es mit einer Abteilung des Johnson’schen Regiments Royal Greens zu tun hatten, von welchem sie wussten, dass eine große Anzahl der Mannschaften aus ehemaligen Bewohnern des Tals, ja sogar aus Verwandten und ehemaligen Freunden angeworben waren.
Zeigten die Bauern vom Mohawktal schon den grimmigen Rothäuten eisern die Stirn, so entbrannten sie beim Anblick der Grünröcke zur höchsten Wut. Der ehemalige, dann größtenteils ausgewanderte Nachbar hielt ja zur Sache der kanadischen Regierung. Er war ein Verräter. Sie verabscheuten und verfolgten ihn darum mit ihrem ganzen Hass.
Eine durch nichts mehr niederzuhaltende elementare Bewegung machte sich mit einem Mal in den Reihen der Farmer geltend. Das Zielen und Schießen dauerte ihnen viel zu lange.
Zornglühend sprangen sie hinter ihren Deckungen hervor, drehten die Büchsen herum und stürmten mit hochgeschwungenen Kolben auf die Royalisten los.
Schon die Wirkung des ersten Ansturmes war eine gewaltige. Die Grünröcke fielen massenweise, dann aber kam es zu einem erbitterten Handgemenge, in welchem die Bauern vom Mohawk mit ihren Büchsenkolben und Messern wie die Löwen kämpften.
Brust an Brust rangen die Gegner und nichts vermochte mehr den zornentbrannten Deutschen standzuhalten.
Mitgerissen und bald voran im dichtesten Kampfgewühl fochten Addy und Franzl.
Der Erstere stand unversehens einem feindlichen Offizier gegenüber, dessen hell gebietende Stimme anfeuernd und ermutigend selbst den gellen Schlachtruf der Indianer übertönte.
»Das ist, irre ich nicht, Oberst Cox«, fauchte Addy. »Und der hat mir jetzt gerade lange genug gebrüllt.«
Mit diesen Worten sprang der kühne Jäger auf den Offizier ein und erfasste ihn bei der Gurgel.
Mit fast übermenschlicher Kraft hob Addy den leichten Mann mit einem einzigen Ruck seiner eisernen Faust in die Höhe und schüttelte ihn so kräftig, als halte er nur ein kleines Kind in seinen Händen.
Da kam dem Obersten mit gezückter Waffe plötzlich ein zweiter Offizier von der Seite her zu Hilfe. Fast schien es, als ob es diesmal um den Jäger geschehen sei.
In diesem kritischen Augenblick tauchte aber plötzlich Franzl in dem wirren Menschenknäuel auf. Die Gefahr ersehend, in welcher Addy stand, schlug er mit einem einzigen wuchtigen Hieb seines Büchsenkolbens den Offizier nieder.
Inzwischen war der Kriegsruf der Indianer verstummt, das Gefecht nun außer allem Zweifel entschieden.
Noch aber kämpften vereinzelte dichtgedrängte Gruppen in schrecklichem Handgemenge einen fürchterlichen Kampf.
Da vernahm man plötzlich aus der Richtung des Forts Stanwix heftigen Kanonendonner. Der Rest der Engländer, der Mehrzahl ihrer Führer beraubt und fürchtend, auch im Rücken angegriffen zu werden, stob in wilder Flucht in die Tiefe des Waldes.
Nicht enden wollende Jubelrufe erhoben sich nun unter den tapferen deutschen Bauern von Tryon County, die sich nunmehr nach einem fast beispiellosen schweren Kampf als die Herren des Schlachtfeldes betrachten konnten.
Schreibe einen Kommentar