Der Spion – Kapitel 5
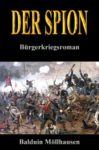 Balduin Möllhausen
Balduin Möllhausen
Der Spion
Roman aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, Suttgart 1893
Kapitel 5
Flucht aus dem elterlichen Haus
Und die Nacht kam und mit sich brachte sie tatsächlich Ruhe; aber es war eine Ruhe, hinter welcher Todesangst und Entsetzen den Atem hemmten, Völlerei und Trunksucht den Geist in Fesseln schlugen. Wie in früheren Tagen lag die bis jetzt noch vom Feuer verschont gebliebene Ansiedlung in ländlicher Stille da. Der Mond war längst aufgegangen. In gleicher Weise beleuchtete er Szenen unsäglichen Jammers, wie andere des Verbrechens.
Im Zelt des Bandenführers brannte Licht. Nach seiner ersten Zusammenkunft mit dem Ortsvorstand, die mit einer furchtbaren Drohung für den Fall endete, wenn innerhalb vierundzwanzig Stunden nicht eine bestimmte Geldsumme beschafft sein würde, hatte er einige seiner Offiziere zu sich berufen, die gleich ihm mit ihren Genüssen vorsichtig eine bestimmte Grenze nicht überschritten. Dort saßen sie zu fünft, zwischen sich eine ausgebreitete Decke, auf welcher unsaubere Karten im Spiel über den Besitz hoher Summen entschieden. Dazu ertönten Flüche, Verwünschungen und Hohngelächter, dass es oft den Eindruck erzeugte, als sollten auftauchende Streitfragen über das mein und dein durch Messer und Pistole entschieden werden. Kaum der vierte Teil der Bande befand sich im Lager, und von diesem hatte kaum die Hälfte in dem Schuppen und dem Bretterhäuschen Unterkunft gefunden. Der Rest lag im Freien.
Die aufgestellten Wachen kauerten auf der Erde und schliefen mit der Muskete zwischen den Knien. Was hätte man auch zu befürchten gehabt, nach dem Angst und Entsetzen die Einwohner der Ansiedlung in Banden schlugen, welche zu sprengen gleich bedeutend mit unabwendbarem Verderben gewesen wäre. Nur vereinzelte Mitglieder der gesetzlosen Horde, die mehr an Raub als an die Genüsse der Gegenwart dachten, hatten sich einen gewissen Grad der Nüchternheit bewahrt und ließen sich willig finden, mit der Muskete auf der Schulter die öden Straßen zu durchwandeln oder den Ort zu umkreisen.
Wie die mit bis zur Besinnungslosigkeit berauschten Mordbrennern angefüllte Schenke lag auch das Wohnhaus zwischen den beiden Fabrikgebäuden in lautloser Stille da. Man hätte es für ausgestorben halten können, wäre durch die beiden Vorderfenster von Lydias Zimmer nicht der Schein einer hell brennenden Lampe ins Freie herausgefallen, die hin und wieder vorüberschreitenden Mitglieder der Bande an den Befehl erinnernd, dass das Haus von keinem Unberufenen betreten werden dürfe. Mit ihrer ruhigen Flamme beleuchtete sie John Kay, der ungefähr eine Stunde nach Einbruch der Nacht sich auf dem Sofa lang ausgestreckt hatte, nach einem letzten tiefen Zug aus der Rumflasche in Betäubung gesunken war und mit unheimlich röchelndem Atem die Umgebung förmlich erzittern machte. In knabenhaft lustiger Laune zu harmlosem Unfug aufgelegt, hatte er einen mit Federn und Schleifen geschmückten Spitzenhut Lydias auf seinem zottigen Haupt regelrecht befestigt. Das wahrhaft grauenerregende und doch lächerliche Bild, welches er mit seinem braunrot angelaufenen, aufgedunsenen Gesicht bot, wurde durch eine blendend weiße Krause vervollständigt, die sich um seinen Stiernacken schlang. Durch seinen Vorgesetzten lebhaft aufgemuntert, war der ihm zur Bedienung überwiesene Mann seinem Beispiel gefolgt. Ihm gegenüber ruhte er auf einem bequemen Polsterstuhl, den Kopf hinten über gelehnt, die Füße weit von sich gestreckt und die Hände, deren eine noch ein leeres Glas hielt, fast bis zur Erde niederhängend. So atmete er schwer und geräuschvoll. Auch er hatte sich auf seine Art herausgeputzt und dazu eine dem Kleiderschrank entnommene, hellblau seidene Pelerine gewählt, die zerknittert um seine Schultern hing.
Zwischen beiden stand ein gedeckter Tisch mit Resten von Speisen, geleerten, halb vollen und noch nicht entkorkten Flaschen. Um dieselben herum lagen Tonpfeifen, Tabakasche, umgestürzte und zerbrochene Gläser. Das Tischtuch triefte unter dem von unsicheren Händen verschütteten Wein und Branntwein. Glasscherben bedeckten hier und da den Fußboden, wohin sie dem aufwartenden Dunkelhäutigen ein Glas oder eine Flasche nachgeschleudert hatten.
Nachdem John Kay sich zum Essen niedergelassen und seinen Diener als einen munteren Gesellen zur Beteiligung eingeladen hatte, war aus dem Mahl ein Gelage geworden, bei welchem beide sehr bald den Rangunterschied vergaßen. Lustige Schwänke flogen hinüber und herüber. Immer wieder ließen Herr und Diener ihre Gläser aneinanderklirren, dass die Scherben umherflogen. Der ewigen Brüderschaft galt es ja, wie der langen Dauer des prächtigen Guerillakrieges. Hatten die tollen Zecher aber anfänglich den Negrid mit Fußstößen und Faustschlägen angetrieben, so nannten sie ihn binnen kurzer Frist den lieblichsten süßen Raben, der je einen Durstigen gegen das Verschmachten schützte.
Und Nestor war tatsächlich unermüdlich in seinen Zuvorkommenheiten. Immer neue Flaschen, abwechselnd schweren Wein und streng duftenden Rum und Cognac, holte er aus dem Keller, wo sie, wer weiß, wie lange gelegen hatten, jede Einzelne mit ihrer Lebensgeschichte begleitend und deren Inhalt als das Köstlichste der Welt preisend. So viele Gläser auf dem Tisch standen, so viele füllte er bis zum Rand, um sie mit stillem Entzücken geleert zu sehen, bis endlich die blutunterlaufenen Augen der beiden Zecher die Entfernungen nicht mehr zu berechnen vermochten, und die unsteten Hände umstießen und verschütteten, was ihnen eben in den Weg kam.
Bei der von John Kay mit lallender Zunge vorgeschlagenen Verkleidung leistete der gute Nestor den Dienst einer gewandten Kammerfrau. Bald hier, bald dort zupfte und nestelte er an ihnen herum, während er den Einfall des Adjutanten als das Erstaunlichste pries, was je von einer sterblichen Menschenseele ersonnen worden war. Dazu aber lachte er so kindlich herzlich, dass ihm Erbsen große Tränen über die Ebenholzwangen rollten, und John Kay ihn zärtlich den feinsten schwarzen Gentleman nannte, der je verdiente, weiß angestrichen zu werden.
Aber auch die Schildwachen vergaß der gefällige Negrid nicht. Abwechselnd dem auf der Vorderseite des Hauses befindlichen Posten, welcher die zur Tür hinaufführenden Stufen zu seinem Sitz erkor, und dessen Kameraden, der es sich auf der Hofseite ebenso bequem gemacht hatte, trug er eine Flasche des stärksten Rums oder Cognacs zu. Und mit Dank wurden sie angenommen und mit Behagen geleert, zumal John Kay selber – wie Nestor beschwor – sie ihnen schickte und obendrein eine gute Gesundheit wünschen ließ.
So ereignete es sich, dass zu derselben Zeit, um welche die beiden Zecher in dem Zimmer, nachdem Nestor ihnen fürsorglich in eine bequeme Lage hinein geholfen hatte, einem todähnlichen Schlaf in die Arme sanken, auch die Schildwachen auf den letzten ihnen gebotenen Trunk nur noch mit röchelndem Schnarchen antworteten.
Während Nestor es sich aber angelegen sein ließ, als aufmerksamer Wirt seine Gäste zu bedienen, war auch die treue Eva nicht müßig geblieben. Nachdem der junge Vaquero sie auf einer mit Nestor verabredeten Stelle im nächsten Waldsaum aufgesucht und mit ausgiebigem Rat versehen hatte, schaffte sie drei Sättel mit dazugehörigem Zaumzeug unentdeckt nach und nach eben dahin, worauf Nicodemo und seine Freunde die an Pflöcken grasenden Pferde Lydias zum sofortigen Gebrauch ausrüsteten und nebst ihren eigenen Tieren Eva zur Beaufsichtigung übergaben.
Um sicher zu sein, dass vonseiten der Schildwachen keine Gefahr drohe, hatte Nestor sie einige Male mit dem Fuß in die Seite gestoßen. Doch sie rührten sich nicht; zu betäubend war die Wirkung der von ihm mit Bedacht gemischten schweren Getränke. In das Zimmer zurückgekehrt, verfuhr er mit John Kay und dessen Diener ähnlich. An den Füßen zerrte er sie, brennendes Papier hielt er ihnen unter Beifügung freundlich ermunternder Worte vor die Augen, ohne dass sie, außer dem rasselnden Schnarchen, ein Lebenszeichen von sich gegeben hätten. Dann trat er vor den Tisch hin. Eine Weile betrachtete er die lächerlich geschmückten Opfer sinnend. Dabei vollzog sich in seinem Äußeren eine eigentümliche Wandlung. Die knechtische Haltung ging wie durch Zauberschlag verloren. Wie ein zum Kampf sich rüstender Gladiator warf er sich in die Brust. Während sich unheimliche Glut in seinen Augen entzündete, die breiten Nüstern nach Art gereizter Raubtiere sich zitternd dehnten, wichen in triumphierendem Grinsen die dicken Lippen weit von dem Elfenbein ähnlichen Gebiss zurück. Er schien den Zeitpunkt nicht erwarten zu können, in welchem er das mit so viel List und Geduld eingeleitete Rachewerk zum Abschluss bringen würde. Sich gleichsam zu der Grausamkeit seiner Vorfahren auf der anderen Seite des Ozeans aufstachelnd, strich er mit den Händen über Kopf und Schultern, wo die empfangenen Streiche die Haut dick aufgetrieben hatten. Zähneknirschend warf er einen letzten Blick unauslöschlichen Hasses auf John Kay, und über dessen Leibdiener hinwegsehend, unterrichtete er sich zunächst von dem Stand der Zeit. Der Zeiger der Wanduhr wies auf halb zwölf. Bei seinen weiteren Bewegungen sich keinen Zwang mehr auferlegend, durchsuchte er alle Taschen des den Briefwechsel seines Chefs führenden Adjutanten. Wo nur immer sich Gelegenheit bot, in den Besitz von Papieren des Bandenführers zu gelangen, da sollte er sie nach besten Kräften ausnutzen. So war ihm von dem jungen Reitersmann geraten worden, und das hatte er nicht vergessen. Bald hier, bald dort zog er ein Päckchen sorgfältig verschnürter Briefe und Schriftstücke hervor, sie ebenso schnell an seinem eigenen Körper bergend.
Als er nichts mehr fand, zündete er zwei Lichter an. Sich mit denselben in Lydias Schlafgemach begebend, stellte er sie vor das zum Hof hinausgehende Fenster. In das Wohnzimmer zurückgekehrt, klopfte er mit dem harten Fingerknöchel dicht neben dem Schrank in einem bestimmten Takt an die Wand. Es galt als Zeichen, dass bis dahin alles geglückt sei. Fast gleichzeitig presste er das Ohr auf das Mauerwerk, und so unterschied er ähnliches Pochen, welches aus dessen Innerem hervordrang.
»Armes süßes Herzchen«, lispelte er unbewusst vor sich hin, und auf den Flurgang hinaus tretend, öffnete er die Hintertür. Vor derselben, den Weg versperrend, lag die trunkene Schildwache. Sie zur Seite schleppend, überzeugte er sich abermals, dass sie durch nichts zum Bewusstsein gebracht werden konnte. Er hatte eben die den Händen des Mannes entglittene Muskete zum eigenen augenblicklichen Gebrauch bereit an die Wand gelehnt, als er im Schatten der das Grundstück einfriedigenden Mauer eine unbestimmte Bewegung entdeckte. Der junge Vaquero, oder vielmehr Oliva und ihre Begleiter waren es, welche, durch die beiden Lichter über die Sicherheit der Umgebung belehrt, sich vorsichtig näherten. Schon vor einer Weile hatten sie, von Eva genau unterrichtet, durch die zu dem freien Feld hinausführende unverschlossene Pforte das Grundstück betreten und seitdem auf das verabredete Signal gewartet.
Während Schinges und der Ire, Durlachs Diener, sich neben der nunmehr wieder verschlossenen Pforte aufstellten, um nicht durch eine vielleicht dorthin verirrte Patrouille überrascht zu werden, begleiteten Oliva, Nicodemo, Durlach und Schahoka den Afrikaner in das Haus hinein. Das Zimmer betretend, stellten Nicodemo und der Otoe sich neben den beiden bewusstlosen Zechern auf, um sie im Fall des Erwachens sofort auf ewig verstummen zu machen. Nestor, welchem Oliva mit dem Licht folgte, trat vor das Spind hin. Unterstützt von Durlach gelang es ihm ohne große Mühe, dasselbe von der Wand fortzurücken. Hinter demselben wurde eine sich nur wenig bezeichnende Tapetentür sichtbar. Dieselbe führte in einen schmalen, länglichen Raum, welcher dadurch entstanden war, dass man beim Bau der Küche einen die Regelmäßigkeit der Form des Zimmers störenden Winkel durch eine Mauer abgegrenzt hatte. Vollständig finster diente er zur Aufbewahrung solcher Gegenstände, die nicht für den täglichen Gebrauch bestimmt waren. Diese hatte Nestor zum größten Teil anderweitig untergebracht und dadurch soviel Platz geschaffen, dass ein dort Versteckter sich einigermaßen frei bewegen konnte, außerdem aber durch einen Polsterstuhl und einen Korb mit Lebensmitteln für eine gewisse Bequemlichkeit gesorgt.
Als Nestor sich mit dem Schloss beschäftigte, war Oliva, um zu leuchten, neben ihn hingetreten. Sobald aber die Tür sich nach außen schob, streifte der flackernde Schein des Lichtes ein Antlitz, welches bereits im Tod erstarrt zu sein schien, so bleich war es geworden, so ergreifend prägte sich in jedem einzelnen Zug die Wirkung all dessen aus, was zu erlauschen Lydia gezwungen gewesen war. Indem sie die großen bangen Augen, die nach dem Aufenthalt im Finstern durch das Licht geblendet wurden, mit beiden Händen bedeckte, erzeugte es den Eindruck, als hätte sie gegen eine Ohnmacht gekämpft. Zu sprechen vermochte sie nicht. Das so lange erduldete Grausen, die unausgesetzte Todesangst, dennoch entdeckt zu werden, hatten ihre Zunge gelähmt.
Während Nestor vergeblich nach Worten rang und Tränen seinen Augen entstürzten. Durlach dagegen als ein ihr Fremder rücksichtsvoll auf eine erste Kundgebung von ihr wartete, hatte Oliva Lydias Zustand auf den ersten Blick erkannt. Dem Captain das Licht reichend, bot sie ihr den Arm, die Schwankende beim Verlassen des unheimlichen Verstecks sorgfältig unterstützend. Zugleich nahm sie Bedacht darauf, dass die Aussicht auf die beiden wahnwitzig aufgeputzten Unholde ihr entzogen blieb.
»Das ist grauenhaft«, flüsterte Lydia endlich vor sich hin. Sich schwer auf Olivas Arm lehnend, duldete sie willig, dass sie von ihr aus den Flurgang hinausgeführt wurde. »Mein armer Vater – was soll aus mir werden? Nur mit Mühe halte ich mich aufrecht. Was ich erlebte, es brach meinen Geist, lähmte meinen Körper …«
»Sie befinden sich unter Freunden«, raunte Oliva, von innigster Teilnahme erfüllt, ihr liebreich zu. »Fassen Sie Mut. Nur ein Viertelstündchen eiligen Einherschreitens, und wir sind in Sicherheit.«
»Ich kann nicht«, erklärte Lydia unter hervorbrechenden Tränen, »vielleicht, nachdem ich eine Weile die frische Nachtluft atmete. In dem finsteren Raum war ich dem Ersticken nahe – die letzten Kräfte verließen mich.«
»Sie müssen mit uns fort, und zwar sogleich«, versetzte Oliva nunmehr entschieden. »Jede Sekunde Zeitverlust kann von den verhängnisvollsten Folgen für uns alle begleitet sein.«
Lydia antwortete nicht. Obwohl sie sich aufs Äußerste anstrengte; über eine schleichende Bewegung kam sie nicht hinaus. Sie waren vor der Hintertür angelangt. Ihnen auf dem Fuß folgten außer dem Captain Durlach und dem Schwarzen, Nicodemo und Schinges.
»Wenn wir nur ein Mittel besäßen, sie zu tragen«, bemerkte Durlach leise zu Nestor gewendet.
»Tragen?«, fragte dieser ebenso leise zurück, »das arme süße Ding – ich brächte es wohl fertig, allein …« Mit dem letzten Wort verschwand er, kehrte aber schon nach zwei Minuten zurück, hinter sich einen leichten Handwagen, wie er auf dem Hof zum Befördern gefüllter Mehlsäcke benutzt wurde. Schnell verständigte er sich mit den Gefährten. Ins Haus eilend, erschien er bald wieder mit Decken, einem Pfühl und einem Laken, mittels dessen er, nachdem die Seitenbretter entfernt worden waren, ein erträgliches Lager auf dem Wagen herstellte. Von Oliva gehalten, sank Lydia auf dasselbe hin. Obwohl zu einer unbequemen Lage gezwungen, fand sie doch ausreichend Platz, worauf Oliva sie mit dem Laken bedeckte. Wie eine Schlaftrunkene ließ die Ärmste alles über sich ergehen; wusste sie sich doch unter dem Schutz opferwilliger Freunde. Wenn aber zuvor die Erinnerung an die grausigen Erfahrungen sie bis zur Besinnungslosigkeit erschütterte, so diente sie jetzt dazu, ihre Lebensgeister wieder anzuregen, die allmählich zurückkehrende Hoffnung auf Entkommen neu zu entfachen.
»Nur nicht lebendig in die Gewalt dieser furchtbaren Menschen«, das waren die letzten Worte, welche sie zu den sie Umringenden sprach, bevor Oliva sie ganz verhüllte und das weiße Laken ordnend, ihrer ausgestreckten Gestalt bedachtsam die Ähnlichkeit mit einer für das Grab bestimmten Leiche verlieh.
Da neigte Durlach sich ihr noch einmal zu.
»Mut, Mut«, sprach er gedämpft. Es waren die ersten Worte, welche er an sie richtete. »Gedenken Sie Ihres Vaters. Ich bringe Nachricht von ihm. Also Mut und Vertrauen, was sich auch ereignen mag.« Er trat zurück und von Nicodemo, dem Iren und ihm selbst gezogen, rollte der Wagen der Pforte zu. Dort hielten sie an, um die Rückkehr der beiden Otoes abzuwarten, die kurz zuvor ins Freie hinausgeschlichen waren, um sich von der Sicherheit des von ihnen einzuschlagenden Weges zu überzeugen.
Unter dem Vorwand, das Haus gegen Feuergefahr zu schützen, hatte Nestor nach einem kurzen Gespräch mit Oliva sich noch einmal auf den Schauplatz des wüsten Gelages zurückbegeben. Anfänglich die beiden Trunkenen kaum beachtend, zog er ein handgroßes Blatt Papier, anscheinend einem Taschenbuch entnommen, hervor. Es auf den Tisch legend, glättete er es mit einigen Strichen. Des Lesens unkundig, überzeugte er sich nur, welche Seite die beschriebene, worauf er es, diese oben, vor die Lampe hinschob. Nachlässig zu John Kay hinüberlangend, zog er das an dem Gurt des Adjutanten hängende Messer aus der Scheide. Flüchtig prüfte er die Spitze und sie auf die Mitte des Blattes stellend, nagelte er es durch einen Schlag mit der Faust auf die Tischplatte. Finster betrachtete er sein auserkorenes Opfer, bei dessen röchelndem Schnarchen die Schleifen des Hutes und der Halskrause erzitterten. Länger und tiefer atmete er angesichts des wehrlosen Wüterichs, bis endlich die Luft sich pfeifend seinen Lungen entwand. Mehr und mehr erhielt sein schwarzes Gesicht mit den fletschenden Zähnen den Ausdruck eines Teufels. Die dicken Augäpfel schienen ihre Höhlen verlassen zu wollen. Tastend glitten seine Hände über Scheitel und Schultern, wo die blutrünstigen Male noch immer brannten. Mit sicherem Griff bemächtigte er sich des Revolvers seines Todfeindes. Nachdem er ihn in den eigenen Gurt geschoben hatte, zog er sein Messer. Unheimlich glühte die lange scharfe Klinge im rötlichen Schein der Lampe. Anscheinend um ihn genauer zu betrachten, neigte er sich über den Besinnungslosen hin. Wie Zischen klang, als er in seiner Tigerwut zu ihm sprach: »Meine süße Miss Lydia; das arme Herzchen wäre beinahe gestorben vor Schreck. Wirst wohl keinen Neger mehr misshandeln!«
Nach einer kurzen heftigen Bewegung des rechten Armes richtete er sich wieder auf. Als hätte er erwachen wollen, stellte John Kay sein Schnarchen ein. Zugleich stieß er einige Male mit den Füßen gegen das untere Ende des Sofas.
Nestor achtete seiner nicht weiter. Festen Schrittes verließ er das Zimmer, gefolgt von einem eigentümlich gurgelnden Geräusch. Ins Freie hinausgetreten, stieß er sein Messer einige Male in die Erde, um irgendwelche Spuren von der Klinge zu entfernen, bevor er es in die Scheide zurückschob. Gleich darauf befand er sich neben der Pforte. Die beiden Otoes waren eben eingetroffen und mahnten zur Eile. Ohne Zeitverlust legte Nestor mit Hand an den Wagen. Oliva öffnete die Pforte und schloss sie wieder, nachdem der Wagen hinausgeschoben worden war. Mit vorsichtigen Bewegungen verfolgte der kleine Zug den im Schatten der Mauer hinführenden Weg.
Doch es schien, als ob die Schrecken dieser Nacht kein Ende nehmen sollten; denn kaum achtzig Schritte weit waren die Flüchtlinge von der das Grundstück abschließenden Mauerecke entfernt, und eine kurze Strecke trennte sie nur noch von dem Streifen Buschwerk, welcher, ihnen Schutz gewährend, sich in der Richtung zu dem Waldsaum verlängerte, als plötzlich ein einzelner Mann vor ihnen auftauchte. Das Gewehr auf der Schulter und offenbar auf einem Patrouillengang begriffen, kam derselbe ihnen gerade entgegen. An ein Ausweichen war auf der mondbeleuchteten Fläche nicht zu denken, wollten sie nicht eine Kugel nachgesendet erhalten, was unfehlbar noch größere Gefahren nach sich gezogen hätte.
»Vorwärts in ungestörter Ordnung!«, rief Oliva, die einige Schritte vorausging, gedämpft zurück, und ohne anzuhalten, folgten die Männer mit dem Wagen. Durlach war neben denselben hingetreten, während die Otoes nach einer mit Nicodemo gewechselten Bemerkung sich etwas im Hintergrund hielten.
»Wer geht da?«, schallte ihnen die Stimme des uniformierten Wegelagerers entgegen. Der Lauf der Muskete blitzte im Mondlicht, indem er sie von der Schulter nahm.
»Gute Freunde«, antwortete Oliva unerschrocken, ohne ihre Bewegung einzustellen.
»Wohin des Weges?«, hieß es weiter, als jener ihr gegenüberstand.
»Auf dem Wege zur Beerdigungsstätte«, erklärte Oliva entschlossen, »bevor wir aus der Gegend scheiden, wollen wir einem erschossenen Freund die letzte Ehre erweisen.«
»Bursche, verdammter, das glaube dir der Teufel«, versetzte der Mann und schritt an Oliva vorbei neben den Wagen hin, »‘ne feine Leiche, vermute ich, die aus‘nem Sack mit blanken Dollars besteht, Dollars aber brauchen nicht in der Erde zu verrosten.«
»Stören Sie nicht die Ruhe eines Toten«, nahm Durlach nunmehr ernst das Wort, und verstohlen legte er die Hand auf den Kolben seines Revolvers, »wir wählten die Nacht, um kein peinliches Aufsehen zu erregen.«
»Eure Dollars bedürfen keiner Ruhe«, fuhr der Mann trotzig fort, »umlaufen müssen sie von einer Tasche in die andere, und verdammt will ich sein, wenn ihr mit eurer Leiche davonkommt, bevor ich ihr ins Angesicht sah oder die Patrouille heran ist.«
Während dieses Gespräches gelangten die beiden Otoes in gleiche Höhe mit dem Wagen, der stehen geblieben war. Da trat Oliva, welche ihre Besonnenheit bis zum letzten Augenblick nicht verlor, vor den rohen Menschen hin.
»Lassen Sie Anstand walten«, hob sie kaltblütig an, als dieser höhnisch einfiel: »Zur Hölle mit deinem Anstand …« Er stockte, fuhr aber bald wieder mit boshafter Schadenfreude fort:
»Da soll Gott mich strafen, wenn du nicht derselbe grüne Schurke bist, der unserem Korporal das Gehirn so zierlich aus dem Schädel knallte. Bei der ewigen Verdammnis, Junge, du kommst mir gerade recht. Und ich sollte mir deinen Toten nicht betrachten?« Im Vollbewusstsein eigener Unantastbarkeit neigte er sich höhnisch lachend über die verhüllte Gestalt hin, zugleich die Hand nach dem Laken ausstreckend.
Bis dahin hatten die Männer mit schwer zu schildernden Empfindungen schweigend dagestanden. Angesichts der drohenden Gefahr, durch einen Schuss die erwähnte Patrouille herbeizurufen, zögerten sie, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Eine vom Zufall herbeigeführte günstige Wendung erhoffend, erwogen sie zugleich Lydias verzweifelte Lage. In demselben Augenblick aber, in welchem Durlach den Revolver hob und Nestor sich anschickte, auf den Mann einzuspringen, dieser dagegen das Laken berührte, erhob sich hinter ihm ein Arm. Wie ein Blitz zuckte Schahokas lang geschäftetes Beil, welches anstatt in der gewöhnlichen Schneide, in einer Spitze endete, im Halbkreis um sein Haupt, und mit dumpfem Krachen grub die furchtbare Waffe sich so tief in die Schläfe des ahnungslosen Feindes ein, dass sie in dem Knochen haften blieb. Indem der Otoe sie aber mit vollster Kraft zu sich riss, verhinderte er, dass der lautlos Zusammenbrechende über Lydia hinsank. Bevor diese einen vollen Begriff von dem in ihrer unmittelbaren Nähe stattgefundenen Ereignis erhielt, rollte der Wagen schon wieder weiter. Bis auf Schahoka, der sich noch bei dem Erschlagenen zu schaffen machte, ihm den Hut auf den Kopf drückte und ihn wie einen Schlafenden aufs Gesicht legte, verfolgten die Flüchtlinge die bisher innegehaltene Richtung schweigend und ohne eine Silbe der Verständigung. So erreichten sie den hier und da von vereinzelten Waldbäumen überragten Buschstreifen. In dessen Schatten sich einherbewegend, unterschieden sie plötzlich die Stimmen einer kleineren Anzahl Männer. Dieselben hielten sich offenbar auf gleichen Weg, welchen der einzelne Gefährte eingeschlagen hatte, mussten also binnen kürzester Frist auf den Erschlagenen stoßen. Lydias Begleiter nahmen sich daher nur noch die Zeit, den Wagen zwischen schützendes Buschwerk zu schieben, worauf alle, die Waffen schussfertig in den Händen, neben demselben niederkauerten. Lydia hatte das Laken zurückgeworfen. Anstatt sie gänzlich zu entmutigen, wirkte diese neue Gefahr belebend auf sie ein. Was ihr auch beschieden sein mochte, um sich sehen wollte sie dem Tod lieber ins Auge schauen, anstatt in stumpfer Ergebung das Unabänderliche zu erdulden.
In der Ansiedlung war inzwischen der letzte Lärm verstummt. Ganz deutlich drangen daher die Stimmen der nahenden Patrouille in das Versteck der Flüchtlinge. Anfänglich in Murmeln zusammenfallend, trennten die Worte sich bei jedem neuen Schritt mehr und mehr voneinander, bis sie endlich im Zusammenhang deren Ohren erreichten.
»Ich will euch nur sagen«, erklärte einer unter Vorausschickung einer hässlichen Verwünschung, »diejenigen sind am besten daran, die bei solcher glorreichen Gelegenheit so lange Whisky in die Kehle gießen, bis die Vernunft zum Teufel geht. Dann lässt man sie ungestört liegen, während die Nüchternen sich im Dienst die Nacht um die Ohren schlagen. Geht das so fort, möchten wir uns von dem Quinch lossagen und das Metier auf eigene Faust weiter betreiben. Sind wir unserer zwei Dutzend beisammen, so genügt das, um einzelne Farmen und Ansiedlungen abzusuchen und die Kontributionen in unsere eigenen Taschen gleiten zu lassen.
»Meine Meinung ist, dass Quinch überall das Fett abschöpft und uns mit einem Hundelohn abfertigt«, versetzte ein anderer verdrossen.
Sie hatten die Stelle erreicht, wo der Weg durch den Buschstreifen hindurchführte, befanden sich also kaum dreißig Ellen weit von den Flüchtlingen und nach wenigen Schritten mit ihnen auf derselben Seite.
»Weshalb erließ er das Verbot, das Haus und die beiden Fabriken zu betreten?«, fragte eine dritte Stimme, »doch nur, um sie zuvor selber auszuplündern. Der Besitzer soll nämlich ein schwerreicher Mann sein.«
»Ich hörte davon, Quinch habe es auf dessen Tochter abgesehen«, nahm die Erste wieder das Wort. »Ohne Grund befahl er nicht, die Besitzung scharf im Auge zu behalten. Es muss Wichtiges auf dem Spiel stehen, oder er hätte den John Kay nicht dort einquartiert. Zum Henker mit ihm. Handelt es sich um eine hübsche junge Lady, so bin ich so nahe dazu wie jeder andere.«
Hier flossen die Worte wieder ineinander, sodass die Flüchtlinge der Unterhaltung nicht länger zu folgen vermochten. Aber in ihrem Gesichtskreis befanden sich die Feinde, indem sie auf dem mondbeleuchteten Weg gemächlich einherschritten.
Plötzlich rief einer von ihnen laut aus: »Bei Gott, da liegt jemand.« Und gleich darauf, nachdem sie bei dem Erschlagenen eingetroffen waren, fuhr er fort: »Der nahm so viel zu sich, dass er auf‘ne Woche genug hat. Hallo, Mann!«, rief er lauter und durchdringender. Es war, als hätten Fußstöße diesen Ruf begleitet. »Hast dir ein verdammt hartes Lager ausgesucht! Steh auf, Mann, und schaff dir Bewegung oder du hast Morgen deine Not, die steifen Glieder zusammenzulesen.«
»Lasst ihn ungeschoren und kommt«, spöttelte ein anderer, »bei seinem Anblick werde ich selber durstig. Taumelte er so weit abwärts, mag er zusehen, wie er wieder unter Menschen kommt.«
»So liege, bis du schwarz wirst«, lautete die Erwiderung während des Weiterschreitens, »schade um den schönen Whisky, der über seine Zunge gegossen wurde.« Sorgloses Lachen folgte; dann noch einige Minuten tödlicher Spannung, und von der Patrouille war nichts mehr zu sehen oder zu hören.
Nicodemo sprang auf. Seinem Beispiel folgten die Gefährten. Lydia hatte den Wagen verlassen und stand unter ihnen. Ihr Antlitz leuchtete förmlich im Mondschein.
»Ich fühle mich kräftiger jetzt«, sprach sie entschlossen, »befinde mich auf vertrautem Boden und werde gleichen Schritt mit Ihnen halten.« Sie trat an Olivas Seite, und deren Arm ergreifend, fügte sie hinzu: »Nur noch eine kurze Strecke. Ihre Unterstützung, und meine Füße tragen mich wieder stundenweit.«
Schweigend ordnete sich der Zug. Anfänglich mit gemäßigter Eile, allmählich aber immer schneller ging es im Schatten des Buschwerks dahin, bis endlich nur noch eine schmale Einbuchtung der mondbeleuchteten Ebene zu überschreiten blieb.
Ohne weitere Störung erreichten die Flüchtlinge den Waldsaum, wo unter Evas Aufsicht die gesattelten Pferde ihrer harrten. Ungesäumt bestiegen sie dieselben, und in schnell forderndem Schritt schlugen sie die südliche Richtung ein, um später östlich abbiegend, an den Missouri zu gelangen. Eine Stunde hielten sie sich noch im Schatten des Waldsaums. Dann öffnete sich vor ihnen eine baumlose Ebene, auf welcher sie die Gangart der Pferde beschleunigten.
Und abermals ritten sie eine Stunde, als sie, von einer hervorragenderen Bodenerhebung aus rückwärts spähend, Feuerschein entdeckten. Die Richtung, in welcher der Himmel sich rötete, ließ kaum einen Zweifel darüber, dass die Guerillabande sich mit Raub und Erpressungen nicht begnügt hatte.
Lydia, welche noch immer wie unter dem Einfluss eines furchtbaren Traums lebte, sah traurig hinüber. Sie kannte beinahe alle Bewohner der Ansiedlung. Wer mochte zurzeit unter der Brandlegung zu leiden haben? Wer tränenden Auges in die lodernden Flammen stieren, die seine irdische Habe verzehrten? Der Habe ihres Vaters gedachte sie nicht.
Schaudernd kehrte sie sich ab. Wie von einem Schreckgespenst verfolgt, trieb sie ihr Pferd schärfer an. Mit ihr gleichen Schritt hielten die Gefährten. Keiner sprach ein Wort. Ein böser Bann lastete auf allen Gemütern. Vor ihnen lag noch ein langer Ritt; ein Ritt von Tagen, vielleicht Wochen, je nachdem sie durch feindliche Truppenbewegungen zu Umwegen gezwungen wurden, bevor sie sich einigermaßen in Sicherheit befanden.
Ein sich rötlich färbender Orangestreifen schmückte den östlichen Horizont. Er verhieß einen lieblichen, sonnigen Tag.
*
Gerade die Fabriken des Colonel Rutherfields waren es, die samt dem Wohnhaus in Flammen standen und in dem Feuerschein Lydia gleichsam einen letzten wehmütigen Scheidegruß nachsandten.
Die Flüchtlinge mochten sich seit einer Stunde unterwegs befunden haben, als Quinch nach beendetem Spiel von einer seltsamen Unruhe ergriffen wurde. Sogar der Wachsamkeit seines Adjutanten misstrauend und überall Verrat und hinterlistige Angriffe fürchtend, begab er sich selbst auf den Weg, um sich von dem Stand der Dinge in dem Haus des Colonels zu überzeugen. Von zweien seiner Leute begleitet, schlug er den Weg ein, welcher ihn um die Ansiedlung herum und an Rutherfields Besitzung vorbeiführte. Auch er stieß auf den Erschlagenen. Doch argwöhnischer als die Mitglieder der Patrouille prüfte er den anscheinend in tiefen Schlaf Versunkenen aufmerksamer, um sofort die Gewissheit zu gewinnen, dass derselbe nicht nur tot sei, sondern auch ein gewaltsames Ende gefunden hatte.
Ein böser Verdacht bemächtigte sich seiner. An der Umfassungsmauer hinschreitend, legte er im Vorbeigehen die Hand auf den Griff des Schlosses der Pforte. Zu seinem Befremden wich die Tür beim ersten Druck aus ihren Fugen. Begünstigt durch den Mondschein eilte er zur Hintertür des Wohnhauses hinüber. Ein wilder Fluch entwand sich beim Anblick der sinnlos betrunkenen Schildwache seinen aufeinanderknirschenden Zähnen.
Bereits vertraut mit allen Räumlichkeiten, schritt er über den Flur, welcher durch den aus Lydias offenem Zimmer fallenden Lichtschein matt erhellt wurde. Schon bevor er eintrat, tönte ihm raues Schnarchen entgegen. Auf der Schwelle des Gemachs blieb er stehen, und Unheil verkündendes Grinsen trat auf sein in verhaltenem Grimm verzerrtes Gesicht, als er des mit Flaschen und Gläsern bedeckten Tisches und hinter demselben des wahnwitzig aufgeputzten Mannes ansichtig wurde. Sein zweiter Blick traf den von der Wand gerückten Schrank wie die offene Tapetentür. Jetzt wusste er, dass die Tochter des Colonels ihm gewissermaßen unter den Händen entschlüpft war. Wie in Raserei schlug er sich mit der Faust vor die Stirn.
»Ich hätte es erraten müssen!«, rief er wutschnaubend aus, sodass seine Begleiter scheu von ihm zurückwichen, »aber das ist des verwünschten Negrids Werk. Folgte ich meiner Eingebung, so röstete ich den Hund lebendigen Leibes, und er hätte alles eingestanden. Verdammt! Vielleicht ist er noch zu fassen, dann aber soll ihm die Haut in Fetzen heruntergepeitscht werden, bevor man ihm den Strick um den Hals legt …«
Er brach ab. In das Zimmer eintretend, waren seine Blicke auf John Kay gefallen. Dessen unnatürliche Lage und die vollkommene Regungslosigkeit veranlassten ihn, schärfer hinüberzuspähen. Anfänglich schien sogar er trotz seiner Verstocktheit von Grauen befallen zu werden. Doch nur einige Sekunden, und ein wieherndes Gelächter teuflischer Schadenfreude entwand sich seinen Lippen, als er den Adjutanten, in grässlichem Gegensatz zu den ihn schmückenden blutgetränkten Spitzen und Schleifen, mit durchschnittenem Hals da liegen sah.
»Schade drum, dass der Lump sich jetzt nicht selber betrachten kann«, höhnte er giftig. »Bei Gott! Er würde seine Lust an dem Bild haben! Bei der ewigen Hölle, das ist des Negrids Werk. Der aber ist mit dem Frauenzimmer zum Teufel, oder er müsste weniger Schlauheit besessen haben, als ich ihm zutraue.«
Finster starrte er auf den entseelten Gefährten unzähliger Schandtaten hin. In seinen plötzlich erschlaffenden Zügen verriet sich, dass sein eigenes Los ihm vorschwebte, wenn er sich entschlossen hätte, an John Kays Stelle sein Quartier in dem gefährlichen Haus aufzuschlagen. Scheu sah er um sich. Zähneknirschend vergegenwärtigte er sich, dass die reiche Beute, welche er in Lydias Person bereits in seinem Besitz zu halten glaubte, durch die unbezähmbare Trunksucht seines Adjutanten und die List eines verachteten Negrids unrettbar für ihn verloren gegangen sei. Zurücktretend warf er den Teilnehmer an dem Gelage durch einen Fußtritt von dem Polsterstuhl herab. Wie blödsinnig stierte derselbe zu ihm auf. Nach einem missglückten Versuch sich zu erheben, fiel er zurück, um bald wieder auf dem besudelten Fußboden weiter zu schnarchen. Quinch achtete seiner nicht mehr. Durch das in der Tischplatte steckende Messer war seine Aufmerksamkeit auf das Blatt Papier hingelenkt worden. Gleich darauf befand es sich in seinen Händen, dann las er: »Sullivan, hüte dich! Mache deine Rechnung! Der Strick ist gedreht, an welchem du hängen wirst! Kampbell.«
Als wären sie ihm unverständlich geblieben, las er diese Worte dreimal, und immer deutlicher offenbarte sich, dass sie eine geradezu vernichtende Wirkung auf ihn ausübten. Sein eben noch rotbraun glühendes Gesicht hatte sich entfärbt, und abermals spähte er scheu, wie einen hinterlistigen Angriff befürchtend, um sich. Seine Blicke streiften die beiden ihn unruhig überwachenden Begleiter. In dem Bewusstsein, eine Anwandlung von Feigheit vor ihnen verraten zu haben, knitterte er das Blatt in der Faust zusammen.
»Kampbell«, sprach er, seine heftige Erregung gewaltsam bekämpfend, »wie kommt der verrufene Spion hierher? Zum zweiten Mal bedroht er mich. Wenn er sich nur ein einziges Mal zeigen wollte«, und ingrimmig lachend fügte er hinzu: »Fünftausend Dollars sollten mir nicht zu viel für seinen Skalp sein.« Und wiederum giftig lachend zu seinen Begleitern: »Doch wer kennt den Schurken? Wer sah ihn jemals, mögen wir immerhin das heimliche Wirken dieses rätselhaften Kundschafters auf Schritt und Tritt empfunden haben? Hol ihn der Teufel. Was kümmere ich mich um ihn.«
Einen letzten finsteren Blick warf er auf die grausige Szene, dann zündete er eins der auf dem Tisch stehenden Lichter an. Seinen Leuten voraus schritt er von Gemach zu Gemach. In jedem weilten sie kurze Zeit. Nach Beute suchten sie nur oberflächlich. Was vorhanden war, eignete sich nicht zum Mitnehmen; was aber von Wert für sie hätte sein können, das mochte, wer weiß wo an sicherem Ort geborgen sein.
Als sie ins Freie hinaustraten, knisterte und knackte es im Haus aller Enden. Hier und da sprangen Fensterscheiben vor der Hitze des sich schnell entwickelnden Brandes. Der noch immer sinnlos berauschte Diener des toten Adjutanten war vor die Tür geschleppt worden. Neben der Schildwache lag er vor der untersten Treppenstufe.
»Sie nüchtern sich von selbst aus, wenn es erst zu heiß wird«, meinte Quinch boshaft spöttelnd. »Werden sie angesengt, ist es ihre eigene Schuld. Verdient haben sie es für ihre Wachsamkeit.« Lästerlich vor sich hinfluchend, schritt er mit seinen Bluthunden von Gebäude zu Gebäude, wo Heu, Stroh und Holzvorräte die Brandstiftung erleichterten. Als die Lohe aus dem Dach des Wohnhauses schlug, hing oberhalb der Fabriken und der dazugehörigen Schuppen und Stallungen bereits eine schwere Rauchwolke.
Der Feuerruf ging von Haus zu Haus, von Straße zu Straße. Nur spärlich eilten die Einwohner herbei, nur die Wirkung des verheerenden Elements so viel wie möglich einzuschränken. Wer sagte ihnen, wie lange es noch dauerte, bis sie selbst, obdachlos und des Letzten beraubt, zum Wanderstab griffen! Die Schrecklichsten der Kriegsfurien, jene finsteren Schutzgeister des Verbrechens, waren entfesselt. Wie viel Blut sollte noch fließen, bevor es gelang, sie zu bändigen, ihre Fackeln zu verlöschen und dem holden Frieden neue Wege anzubahnen?
Schreibe einen Kommentar