Jimmy Spider – Folge 26
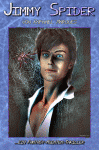 Jimmy Spider und das Todesmoor
Jimmy Spider und das Todesmoor
Es war einer jener schwülen Sommertage, an denen man nicht einmal seinen schlimmsten Feind ohne Ventilator vor die Tür setzte. Die Sonne brannte unerbittlich am gluterleuchteten Himmel, ihre Hitze presste auch die letzte Flüssigkeit aus dem Boden wie aus einem Schwamm, der, nun ja, eben voller Flüssigkeit war.
Durch einen Wald zu wandern brachte dank des dort befindlichen Schattens normalerweise eine gewisse Abkühlung mit sich. Wenn dieser Wald aber nur noch aus knorrigen, vermoderten und mit Moos sowie verschiedenen anderen Pflanzen überwachsenen Bäumen bestand, bei denen man sich sorgen musste, dass diese bei der kleinsten Berührung zu Staub zerfallen könnten, machte das die Sache nur noch schlimmer.
Leider hatte ich mich zu allem Überfluss dazu entschieden, selbst bei diesem Wetter auf meinen obligatorischen Anzug nicht zu verzichten. Ein Fehler, wie sich jetzt zeigte, denn der Stoff sehnte sich derart nach körperlicher Nähe, dass er mich bereits wie eine zweite, recht feuchte Haut umgab.
Nun, das haben Moore nun mal so an sich, dass sie bei großer Hitzeeinwirkung nicht unbedingt zum Eisschrank der Natur werden. Zumindest hatte ich nicht den Fehler gemacht, bei diesen Temperaturen ein paar Sandalen zum Einsatz zu bringen. Stattdessen schmückten ein paar braune Stiefel meine Füße.
Das bereits erwähnte Moor – und damit auch meine Wenigkeit – befand sich im Süden Frankreichs, genauer gesagt in der Nähe eines Ortes mit dem sinnigen Namen Le Tourbière. Die Dorfbewohner hatten mich nicht gerade mit einer Willkommensparade empfangen (genauer gesagt waren es genau zwei Männer gewesen, sonst hatte sich niemand auf die Straße getraut), waren aber immerhin so freundlich, mir den Weg zum örtlichen Moor zu weisen, dessentwegen ich die weite Reise auf mich genommen hatte.
Ein Moor ist ja an sich nichts Ungewöhnliches und beileibe nichts Bösartiges. Zumindest solange man nicht in ihm versinkt – oder versenkt wird. Man lebte damit, man akzeptierte es. Ebenso den Tod der lieben Verwandtschaft, insbesondere, wenn sie einem nicht allzu nahe steht. Wenn aber der liebe Onkel, dem man vor knapp fünf Jahren hinterrücks die Gartenschaufel über den Scheitel gezogen und im Moor versenkt hat, um dessen sauer verdiente Rente einzukassieren, während dieser ohne Wissen des Staates in einem von eben diesem unter Naturschutz gestellten Biotop vor sich hin gammelt, plötzlich wieder auftaucht und an die Haustür seines lieben Neffen klopft, um an dessen saftiges Menschenfleisch zu gelangen, dann war einem das Moor – und die liebe verstorbene Verwandtschaft – doch nicht mehr ganz so geheuer.
Dem Onkel hatte zwar die Flamme einer Kerze die Totenruhe zurückgebracht, aber ob damit der Schrecken aus dem Moor sein Ende gefunden hatte, vermochte niemand zu sagen. So ein Fall rief natürlich die TCA auf den Plan, beziehungsweise der französische Geheimdienst setzte meinen Arbeitgeber auf diesen. Man konnte ja schließlich nicht wissen, wie viele nette Nachbarn ihre Verwandten, Freunde, Feinde oder Haustiere noch in dem ach so friedlichen Moor versenkt oder wie viele harmlose Pilzsammler in den Untiefen des Gewässers ihr Ende gefunden hatten.
Zumindest war mir weder der eine noch der andere Fall bisher über den Weg gelaufen, aber das konnte sich ja noch ändern.
Als Waffen trug ich wie üblich meine Desert Eagle, dazu einen Mini-Flammenwerfer und eine Machete. Man musste schließlich für alles gerüstet sein, sollten sich die Untoten – falls es denn welche waren – als widerstandsfähiger als in der Fachliteratur oder einschlägig bekannten Filmen beschrieben erweisen. Mit dieser Sorte hatte ich noch nicht allzu viel Erfahrung gemacht. Eigentlich war dafür auch die Dämonenjäger-Abteilung der TCA verantwortlich, aber die befand sich gerade auf einem Betriebsausflug in Transsilvanien.
Das erste lebende Wesen, das mir an diesem Tag im Moor begegnete, war ein Uhu, der mit großen Augen aus seinem Bau innerhalb eines Baumstumpfes lugte. Ein Zombie-Uhu war es augenscheinlich nicht, denn trotz meines recht lebendigen Körpers, der sich knapp vier Meter vor ihm aufbaute, machte er keinerlei Anstalten, mir das Fleisch von den Knochen zu ziehen. Stattdessen verzog er sich wieder in den Innenbereich seiner Behausung.
Die Hitze drückte weiter auf mein Gemüt, der Anzug auf meine Haut, die Waffen auf meinen Anzug, eine verweste Hand auf meinen linken Stiefel und meine Stiefel in den feuchten Morast, sodass ich wohl einen Teil meiner Seele verkauft hätte, wenn mir in diesem Augenblick der Teufel erschienen wäre und mir einen Ventilator angeboten hätte.
Aber Moment – was war noch mal mit meinem linken Stiefel? Ich blickte an mir herab und entdeckte eine uralte, teils nicht einmal mehr von Haut überdeckte Hand, die versuchte, meinen Fußknöchel zu umschlingen.
Ich hob mein linkes Bein an, aber statt dass sich die Klaue von meinem Stiefel löste, zog ich ihren Besitzer nur noch weiter aus der feuchten Erde hervor. Das sollte mir auch recht sein, so konnte ich zumindest meinen Angreifer etwas eingehender begutachten.
Mit beiden Händen griff ich nach einem nahegelegenen dünnen Baumstamm, um mich daran festzuhalten, während ich mein rechtes Bein in der Erde verankerte und mit aller Kraft meinen linken Fuß an mich heranzog.
Nach kurzer Zeit trat auch der restliche Körper ans Tageslicht. Ein vor Schlamm triefendes, ausgemergeltes Ungetüm, das nur noch entfernt etwas mit einem Menschen zu tun hatte. So in etwa stellten sich wohl viele die leibhaftige Kate Moss vor. Außer dass diese Dame noch recht lebendig war, was man von dem Monster vor mir nicht unbedingt behaupten konnte. Denn wer offensichtlich einige Dekaden im Moor verbracht hat, den konnte man durchaus als tot bezeichnen. Oder untot, wie in diesem Fall.
Die Moorleiche ließ nun endlich von meinem linken Fuß ab und traf Anstalten, sich langsam aufzurichten. Offensichtlich gab es innerhalb des Moors kein ausgiebiges Yoga-Angebot, sodass sich die ersten Stehversuche meines Gegenübers als ziemlich ungelenk erwiesen.
Doch irgendwie schaffte er es dennoch, auf die Beine zu kommen. Nun konnte ich den Untoten etwas genauer begutachten. Neben seinen bereits erwähnten körperlichen Defizite fiel mir an ihm noch auf, dass einige vermoderte Kleidungsreste an ihm hingen. Aus welcher Epoche sie stammten, war nicht festzustellen.
Die Augen des Untoten waren dagegen noch vollständig vorhanden und starrten mich ziemlich direkt an.
Plötzlich hob der Zombie seine Arme an und warf sich mir entgegen. Auf so viel Zuneigung war ich nicht erpicht, weshalb ich einen kurzen Sprung zurück machte.
Damit hatte der Untote nicht gerechnet. Mit einem saftigen Klatschen landete er bäuchlings wieder auf der Erde.
Das gab mir die Zeit, meine Desert Eagle zu ziehen und zu entsichern. Nun würde sich zeigen, ob das alte Film- und Fernsehgesetz, nachdem ein Schuss in den Kopf dem Zombie ein schnelles Ende bereitet, den Tatsachen entsprach.
Inzwischen kroch der Untote auf allen vieren auf mich zu. Bevor er wieder Anstalten treffen konnte, sich aufzurichten, drückte ich zwei Mal ab.
Die Kugeln hieben knapp über der Stirn in den hässlichen Schädel. Der Untote schüttelte sich und zuckte mit seinem Kopf hin und her, als hätte ihn eine Zecke gebissen. Mehr passierte allerdings nicht. Nach einer kurzen Verschnaufpause drückte er sich langsam wieder empor, wobei er einen Baumstamm als Stütze nutzte.
Nun gut, die Kugeln waren also wirkungslos geblieben. Deshalb steckte ich die Desert Eagle weg und zog die Machete aus der an meiner Hose befestigten Scheide.
Der Untote hatte sich wieder einigermaßen gefangen, wankte aber dennoch eher plump in meine Richtung. Das gab mir die Möglichkeit, sehr genau zu zielen.
Mit beiden Händen umfasste ich den Griff der Machete und schlug von links nach rechts zu. Der Kopf machte diese Bewegung mit, fiel der Schlagrichtung entsprechend vom Hals ab und kullerte noch einige Meter weiter.
Der Torso blieb zunächst wie konsterniert stehen, kippte aber schließlich nach vorne und blieb bewegungslos liegen.
Dieser untote Geselle war also erledigt. Aber wie viele mochten noch auf mich warten?
Wie um meine gedankliche Frage zu beantworten, knackte es plötzlich um mich herum. Als ich meinen Blick nach rechts wendete, sah ich die Bescherung. Etwa zehn Meter entfernt wankten zwei weitere Moorleichen auf mich zu.
Auch aus der entgegengesetzten Richtung erklangen Schrittgeräusche. Ein dritter Untoter hatte sich aufgemacht, sich an meinem saftigen Fleisch gütlich zu tun. Aber dieses Festmahl würde ich ihm kräftig versalzen (natürlich hatte ich nicht wirklich vor, mich vor der Zerlegung meiner selbst mit Salz zu überstreuen).
Mit erhobener Machete lief ich auf die beiden von rechts kommenden Untoten zu. Der Linke der beiden konnte es offenbar gar nicht mehr abwarten, an mein Fleisch zu kommen, denn er riss bereits sein verwestes Maul auf. Die darin befindlichen Zähne hätten dringend ein intensives Sanierungsprogramm gebraucht, aber darum würde das Monster sich nicht mehr kümmern müssen.
Ein kräftiger Schlag reichte aus, und der Kopf des Untoten segelte dem Moorboden entgegen. Der Körper kippte zur Seite weg, traf seinen Leidensgenossen und brachte ihn etwas aus dem Tritt.
Schon holte ich ein zweites Mal mit meiner Machete aus – und schlug blindlings in eine weiche Masse. Sofort drehte ich mich herum. Der zweite Zombie hatte sich heimlich an mich herangeschlichen. Mit einer Geschmeidigkeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte, ballte er seine rechte Hand zur Faust und schlug nach meinem Gesicht.
Geistesgegenwärtig duckte ich mich. Die Faust sauste über meinen Kopf hinweg und landete mit einem saftigen Platschen im aufgerissenen Mund des zweiten Untoten.
Nun hingen die beiden lebenden Leichen zusammen, denn der Schläger bekam seine Faust nicht mehr aus dem Maul heraus. Das gab mir die Gelegenheit, ihnen den Rest zu geben.
Ich konnte allerdings dem Bedürfnis nicht widerstehen, dem Untoten, der mein Gesicht zerschlagen wollte, zunächst den ausgestreckten Arm abzuschlagen. Der nun einarmige Zombie blickte ziemlich verdutzt auf den Armstumpf, aber nur für einen Moment, denn da hatte ich schon seinen Kopf vom Hals geschlagen.
Im Maul des zweiten Untoten hing noch immer der Arm seines verblichenen Artgenossen, aber das hinderte mich nicht daran, auch ihm den Kopf abzuschlagen. Schädel und Faust fielen gemeinsam zu Boden, während ich dem Torso einen Tritt gab, der ihn zu Boden stieß.
Hatte ich damit die untote Brut erledigt? Oder warteten weitere Moorleichen darauf, über mich herzufallen? Und warum tauchten sie überhaupt auf?
Zunächst einmal war aber kein weiterer Zombie in Sichtweite. Ich atmete tief durch und versuchte, die Geräusche der Natur in mich aufzunehmen. Allerdings bot sich da nichts an. Es herrschte eine absolute Stille, als würde der Wald den Atem anhalten. Nichts rührte sich. Wirklich nichts?
Doch, da war etwas. Ein leises Rascheln, als würde eine Schlange über den Boden gleiten. Ich versuchte, den Ursprung dieses Geräusches ausfindig zu machen.
Das Rascheln näherte sich. Von vorne nicht, von links auch nicht, von rechts ebenso wenig – aber von hinten. Die Erkenntnis kam leider etwas spät, denn schon wickelte sich etwas Weiches, aber dennoch Unnachgiebiges um mein rechtes Bein.
Ich blickte an mir herab – und entdeckte, dass es sich nicht um eine Schlange, sondern um eine Wurzel handelte. Immer fester schlang sie sich um mein Bein.
Ich nahm die Machete in die rechte Hand und schwang sie dem Wurzelstrang entgegen, der sich in meinem Rücken über den Boden geschlängelt hatte. Wie ein Messer in warme Butter drang die Machete durch die Wurzel und kappte den Strang von meinem Bein ab.
Der Wurzelstumpf zuckte wild umher, während die Spitze langsam von meinem Bein abfiel.
Doch zum Ausruhen blieb keine Zeit, denn schon näherte sich von rechts eine zweite, wesentlich dickere Wurzel. Ich holte erneut zum Schlag aus – und plötzlich konnte ich meinen Arm nicht mehr bewegen. Als ich zu ihm hochschaute, erblickte ich den Ast eines Baumes, der sich geschmeidig um meinen Unterarm gewickelt hatte und immer fester zudrückte, sodass ich die Machete fallen lassen musste.
Die Rache der Natur, dachte ich. Aber warum?
Die dicke Wurzel hatte meine Überraschung genutzt und wickelte sich rasend schnell um meine Hüfte. Weitere Äste erschienen, fesselten meinem linken Arm. Zwei Wurzeln griffen nach meinen Beinen und umschlangen sie.
Damit war ich gefangen. Und was nun? Würde man mich vierteilen, wie man es im Mittelalter gerne bei Hexen und anderen ungeliebten Mitmenschen gemacht hatte? Oder würde ein kleines grünes Männchen erscheinen, um an mir ein paar Doktorspiele durchzuführen?
Im nächsten Moment erfuhr ich es. Der Moorboden vor mir wölbte sich, platzte auf, und es schob sich eine grauenvolle Kreatur hervor. Sie besaß menschliche Proportionen, war aber mindestens zweieinhalb Meter groß und über und über mit Wurzeln, abgestorbenen Pflanzen und Schlamm bedeckt. Die Augen des Monsters waren weit aufgerissen und leuchteten in einem dunklen Rot.
Um aus solchen Situationen wie dieser herauszukommen, half es oft, ein wenig Konversation zu betreiben. »Hi, wie geht’s so?«, rief ich dem Monster zu. Zugegeben, nicht besonders einfallsreich, aber immer noch besser, als wortlos in die ewigen Jagdgründe einzugehen.
»Sehr gut«, antwortete die riesenhafte Kreatur mit äußerst tiefer Stimme. »Und wie hängt es sich so?«
Offensichtlich hatte ich es mit einem monströsen Witzbold zu tun. Aber gut, ich war nicht in der Situation, um Ansprüche an das Niveau unserer Konversation zu stellen. So gab ich nur ein »Bestens!« von mir.
Um mich herum wuselten plötzlich Dutzende kleine Pflanzenstränge. Sie drangen in meine Kleidung ein, strichen über meine Haut und gruben sich sogar in die Taschen meines Jacketts.
Auf dem Gesicht (oder wohl eher der Fratze) des Monsters erschien so etwas wie ein Lächeln. »Du fragst dich sicher, was das alles zu bedeuten hat und wer zum Teufel ich bin.«
»Das ist wohl ziemlich offensichtlich«, sagte ich mühevoll, während ich ein Kichern unterdrücken musste, da die Pflanzenstränge über einige empfindliche Hautstellen hinweg wuselten.
»Nun, ich will mal nicht so sein. Immerhin sind wir ja unter uns, und du wirst dieses Gespräch sowieso nicht überleben …«
Da war sie wieder, die außerordentliche Geschwätzigkeit arroganter Bösewichter. Mir sollte es recht sein.
Das Monster vor mir deutete eine gespielte Verbeugung an, was bei seinen Körperproportionen reichlich bizarr wirkte. »Um mich zunächst einmal vorzustellen: Mein Name ist Sir Albert Northingale, Chefmagier im Dienste Ihrer Majestät, Königin Victoria. Wie du vielleicht schon erkannt hast, liegt die Ausübung meines Berufes schon einige Jahre zurück.«
Das war kaum zu übersehen. Aber eine weitergehende Bemerkung verkniff ich mir.
»Als Magier hat man so einige Vorteile – man lebt ewig, kann Tote zum Leben erwecken und verfügt über viele weitere gewinnbringende Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Gabe, normale Menschen zu beeinflussen. Diese Gunst nutzte ich einst aus, um meine geliebte Königin ein wenig in meinem Sinne zu dirigieren. Mit Schwarzer Magie ist eben vieles möglich.
Leider blieben meine Handlungen nicht unentdeckt. Ein alter Feind von mir, ebenfalls ein Magier, entdeckte meine Machenschaft und löste die Beeinflussung. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Meine Rache sollte furchtbar sein. Mein Gegner hatte sich bis in diesen kleinen Ort zurückgezogen, aus Furcht, wie ich vermutete. Aber ich irrte mich. Der andere Magier hatte mich in eine Falle gelockt. Er überwand meine Magie, aber da nach unseren ehernen und uralten Gesetzen kein Magier einen anderen Magier töten durfte, vernichtete er mich nicht und verfluchte mich stattdessen, für hundertfünfzig Jahre im Schlamm dieses Moores zu verrotten. Aber nun, da meine Kräfte wieder erstarkt sind, bin ich zurückgekehrt aus dem Untiefen dieses unwirtlichen Ortes. Und mit mir all die Leichen, die im Laufe der Jahrhunderte in diesem Moor versenkt worden sind. Meine Magie hat sie wieder zum Leben erweckt und … oh, was haben wir denn da?«
Einer der dünnen Pflanzenstränge zog etwas aus meinem Jackett hervor – mein Zigarrenetui.
»Ist das etwa das, wofür ich es halte?«, murmelte das Monster.
»Darf ich Ihnen vielleicht eine Zigarre anbieten?«, antwortete ich wenig erfreut.
»Das Angebot ehrt mich.« So etwas wie ein Lächeln erschien auf der vermoderten Fratze meines Gegenübers. »Aber ich hätte mich sowieso selbst bedient.«
Zwei kleine Halme öffneten das Etui, ein dritter umwickelte eine meiner geliebten Zigarren, zog sie hervor, dem Maul des Ungetüms entgegen.
»Sehr schön«, gab der verfaulte Magier zu. »Die Zigarre war schon zu meiner Zeit eine Besonderheit, die nur wahre Genießer zu schätzen wussten. Ich hoffe doch, du hast auch ein paar Streichhölzer.«
Ich hatte Mühe, ein feistes Grinsen zu unterdrücken. Denn dank der Bemerkung des Monsters war mir eine brillante Idee gekommen, diese ungemütliche Situation zu meinen Gunsten zu wenden.
»Nein«, antwortete ich, sehr zum Missfallen des Magiers, relativierte aber kurz darauf meine Aussage. »In dieser Zeit benutzen wir keine Streichhölzer mehr. Die Technik hat sie längst überholt. Stattdessen nehmen wir nun etwas, dass sich Feuerzeug nennt.«
»So?«
»Ganz genau. Wenn Sie mich in meine Jackentasche greifen lassen würden, könnte ich es hervorholen und Sie in den Genuss dieses kubanischen Spitzenproduktes kommen lassen.«
Im Hirn der Kreatur (falls innerhalb dieses hässlichen Schädels überhaupt noch mehr wie eine brackige Brühe vorhanden war) schien es zu rattern, bis sie mir schließlich zunickte. Die Pflanzenstränge an meinen Armen lösten sich.
Zunächst einmal rieb ich meine Handgelenke, um die Durchblutung anzuregen. Dabei bemerkte ich, dass sich meine Umgebung verändert hatte. Nicht insoweit, dass sich das verkommene Moor in den Strand von Maui verwandelt hatte. Nein, stattdessen hatten sich einige Zuschauer eingefunden. Mindestens ein Dutzend Untote glotzten mich mit stumpfen Blicken an. Offenbar war ich als Gratisbüffet gedacht.
Ein Ast tippte mich an. »Nicht einschlafen«, gab mir das Monster zu verstehen.
»Ja ja, schon gut.« In aller Seelenruhe griff ich an meinen Rücken und zog den Mini-Flammenwerfer aus seiner Halterung. Auf den ersten Blick erinnerte das rot schimmernde Gerät an einen Föhn mit zu klein geratener Öffnung.
»Hier ist die moderne Variante des Streichholzes – das Feuerzeug.«
»Und das funktioniert?«, fragte der alte Magier überrascht.
»Sicher.«
»Also gut.«
Einer der Halme schob dem Monster die Zigarre in den Mund, während ich mit meiner rechten Hand den Flammenwerfer/das Feuerzeug in Stellung brachte. Mein Zeigefinger legte sich auf den Abzug (direkt unterhalb des Gebläses).
»Na dann – wohl bekomm’s«, sagte ich noch, bevor ich zudrückte.
Eine gewaltige Stichflamme, die man diesem Gerät gar nicht zugetraut hätte, schoss aus dem Flammenwerfer hervor und traf mit voller Wucht das Gesicht des Monsters.
Der alte Magier schrie schmerzerfüllt auf.
Ich ließ die Flammen weiter hervorschießen und schwenkte dabei den ‚Föhn‘, damit auch der Rest des Körpers etwas von dem Feuer abbekam.
Schließlich brannte das Monster lichterloh. Die rot leuchtenden Augen flackerten wild, konnten aber das Ende der Kreatur nicht verhindern. Die Trockenheit des Moores sorgte dafür, dass der Magier in einem wahren Feuerball zugrunde ging.
Als Erstes brach der linke Arm ab, danach der rechte.
Ein lang gezogenes Neiiiinnnnnn drang mir aus dem weit geöffneten Maul entgegen, während das rote Licht der Augen erlosch und das Ungetüm in sich zusammenbrach.
Die Reste konnte man noch gut als Lagerfeuer benutzen – zu schade, dass ich keine Marshmallows dabei hatte.
Um mich herum knackte und krachte es. Auch die Untoten brachen zusammen. Nur die Kraft des alten Magiers hatten sie am Leben erhalten.
Die Fesseln um meine Beine hatten sich längst gelöst. So ging ich auf den lodernden Morasthaufen zu, der einmal ein mächtiger Magier gewesen war. Aus den Resten lugte noch die verkohlte Zigarre hervor. »Was für eine Verschwendung«, murmelte ich. Dann hob ich das unversehrte Etui auf und zog mir ein weiteres Exemplar seines Inhaltes hervor. Ich steckte sie mir in den Mund, hob das Feuerzeug an und … Moment, das war ja gar kein Feuerzeug. Vor Schreck ließ ich den Mini-Flammenwerfer fallen.
Ich schob die Zigarre wieder zurück in ihr Etui. Die Lust darauf war mir gerade gründlich vergangen …
Copyright © 2010 by Raphael Marques
Schreibe einen Kommentar