Buffalo Bill Der letzte große Kundschafter – 19. Kapitel
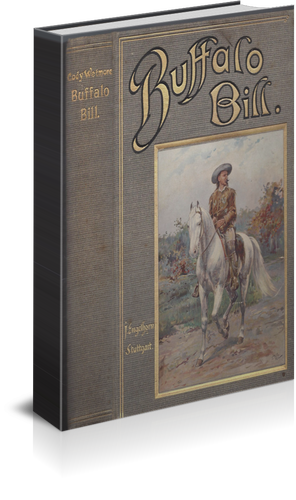 Buffalo Bill
Buffalo Bill
Der letzte große Kundschafter
Ein Lebensbild des Obersten William F. Cody, erzählt von seiner Schwester Helen Cody Wetmore
Meidingers Jugendschriften Verlag, Berlin 1902
Neunzehntes Kapitel
Das Leben in der Armee in Fort McPherson
Im Frühjahr 1870 setzte Will seinen Entschluss vom Vorjahr in die Tat um und ließ sich in der schönen Landschaft westlich des Platte River nieder. Nachdem er eine Unterkunft vorbereitet hatte, in der sich seine Familie wohlfühlen würde, nahm er Urlaub und reiste nach St. Louis, um seine Frau und seine Tochter Arta, die inzwischen ein hübsches dreijähriges Mädchen war, abzuholen.
Der Ruhm von Buffalo Bill hatte sich weit über die Prärie hinaus verbreitet und während seines einmonatigen Aufenthalts in St. Louis stand er im Mittelpunkt großer Aufmerksamkeit. Als sich die Familie auf die Abreise in ihr neues Zuhause an der Frontier vorbereitete, schrieb mir meine Schwägerin und fragte, ob ich sie nicht begleiten wolle. Ich hätte die Einladung gerne angenommen, aber zu dieser besonderen Zeit zog es mich sehr in mein Elternhaus. Außerdem fand ich, dass meine Schwester May, die nicht mit nach St. Louis kommen konnte, einen Anspruch auf die Reise in den Westen hatte.
Also besuchte ich May in McPherson und wir hatten eine wunderbare Zeit, obwohl sie zunächst mit der strengen Disziplin des Armeelebens haderte. Will gehörte zum Offizierskorps, sodass sich Mays gesellschaftliche Kontakte auf die beiden Töchter von General Augur beschränkten, die ebenfalls zu Besuch im Fort waren. Als Ausgleich für den Mangel an weiblicher Gesellschaft gab es jedoch eine Reihe junger, unverheirateter Offiziere.
Jeder Tag brachte kuriose oder belebende Ereignisse mit sich und Mays Briefe an mich waren voller Berichte über das fröhliche Leben in einem Armeeposten. Nach einigen Monaten wurde ich eingeladen, zu ihr zu kommen. Sie war begeistert von einer geplanten Büffeljagd, da sie vor ihrer Rückkehr nach Leavenworth an einer solchen teilnehmen wollte und sich wünschte, dass ich diesen Sport mit ihr ausüben würde.
Als ich die Einladung annahm, legte ich einen bestimmten Tag für meine Ankunft in McPherson fest. Auf meiner Reise wurde ich jedoch aufgehalten und erreichte das Fort erst drei Tage nach dem festgelegten Termin. May war sehr beunruhigt. Sie hatte mir drei Tage Zeit gegeben, um mich von der Reise zu erholen, doch ich kam erst am Vorabend der Büffeljagd an. Natürlich war ich zu erschöpft, um mich für Büffel zu begeistern, und lehnte es ab, an der Jagd teilzunehmen. In meiner Ablehnung wurde ich durch die Nachricht bestärkt, dass mein Bruder auf einem Erkundungsausflug unterwegs war.
»Du hast doch nicht vor, ohne Will auf Büffeljagd zu gehen, oder?«, fragte ich May.
»Nun«, sagte sie, »wir können nie wissen, wann er im Lager ist und wann er weg ist. Er ist fast die ganze Zeit auf Erkundungstour. Und wir können keine Büffeljagd innerhalb von fünf Minuten organisieren, wir müssen im Voraus planen. Unsere Gruppe ist startbereit, und ein Reporter einer Zeitung aus Omaha ist hier, um darüber zu berichten. Wir können es nicht verschieben, und du musst mitkommen.«
Danach gab es natürlich nichts mehr zu sagen und als die Jagdgesellschaft aufbrach, schloss ich mich ihnen an.
Es war eine fröhliche Gesellschaft. Zu den Männern gehörten mehrere Offiziere und der Zeitungsreporter Dr. Frank Powell, der inzwischen in La Crosser lebte. Zu den Frauen gehörten die Ehefrauen von zwei Offizieren sowie May und ich, die Töchter von General Augur. Es gab Sonnenschein, Gelächter und unaufhörliches Geplauder. Wenn man jung ist, gerne reitet und ein gutaussehender junger Offizier an seiner Seite befindet, dann verschwindet die körperliche Müdigkeit für eine Weile.
Bald war das Fort nur noch ein Punkt am Horizont und mit fast ehrfürchtiger Bewunderung blickte ich zum ersten Mal auf die große amerikanische Wüste. Während wir nach Osten ritten, floss zu unserer Linken der schnelle und flache Platte, übersät mit grün bewachsenen Inseln. Washington Irving nannte diesen Fluss den prächtigsten und nutzlosesten aller Flüsse. »Die Inseln«, schrieb er, »sehen aus wie ein Labyrinth aus Wäldchen, die auf dem Wasser schwimmen. Ihre außergewöhnliche Lage verleiht der ganzen Szenerie eine Atmosphäre von Jugend und Lieblichkeit. Wenn man dazu noch die Wellenbewegungen des Flusses, das Wogen des Grüns, den Wechsel von Licht und Schatten und die Reinheit der Atmosphäre hinzufügt, kann man sich eine Vorstellung von den angenehmen Empfindungen machen, die ein Reisender beim Anblick einer Landschaft empfindet, die frisch aus den Händen des Schöpfers zu stammen scheint.«
In scharfem Kontrast dazu stand die sandige Ebene, über die wir ritten. Auf ihr wuchsen kurzes, struppiges Büffelgras, staubfarbener Beifuß und Kakteen in üppiger Fülle. Rechts, vielleicht eine Meile entfernt, erstreckte sich eine lange Reihe von Ausläufern bis zum Horizont. Dazwischen befanden sich hier und da große Schluchten, durch die man in das Hochland gelangte. Sie trugen jeweils einen historischen oder legendären Namen.
Für mich war dieses Bild ebenso schön wie neuartig. Soweit das Auge reichte, gab es keine Anzeichen menschlicher Besiedlung. Es war eine riesige, unbewohnte Einöde, die den Hauch von Unendlichkeit ausstrahlte, wie es auch der Ozean tut.
Als wir in die Ausläufer kamen, entging eine unserer Reiterinnen nur knapp einem Sturz. Ihr Pferd hatte mit einem Huf ein Loch eines Präriehundes getroffen und war abrupt zum Stehen gekommen. Das Bein wurde befreit und ich wurde über die Gefahren aufgeklärt, die Reisende in der Prärie durch diese blinden Fallen der Ebene bedrohen.
Der Weg stieg sanft an und wir erlebten einen leichten Szenenwechsel: Wüstenhügel statt Wüstenebene. Die Sandhügel erhoben sich in Stufen vor uns und ich erfuhr, dass sie vor langer Zeit durch die Einwirkung von Wasser entstanden waren. Was für die Hufe unserer Pferde harter, trockener Boden war, war einst der Grund des Meeres.
Ich interessierte mich sehr für die Geologie meiner Umgebung, viel mehr, als ich es getan hätte, wenn man mir gesagt hätte, dass diese seltsamen, bizarren Hügel der Aufenthaltsort von Indianern auf dem Kriegspfad waren, die ständig auf der Suche nach Skalps waren. Doch diese unangenehmen Tatsachen wurden von den Offizieren nicht angesprochen und so setzten wir in seliger Unwissenheit unseren Weg fort.
Wir mussten eine lange Strecke zurücklegen, bevor wir Wild zu Gesicht bekamen. Nachdem wir zwanzig Meilen zurückgelegt hatten, meldete sich meine vorübergehend vergessene Müdigkeit wieder. Dr. Powell schlug vor, dass die Damen schießen sollten, doch mein Interesse an der Jagd war geschwunden. Ich war seit mehreren Jahren nicht mehr geritten gewesen und war nach den ersten paar Meilen weder körperlich noch geistig in der Verfassung, um die aufregendste Jagd zu genießen.
Endlich kam eine Herde Büffel in Sicht und die Gruppe wurde sofort munter. Ein alter Bulle stand etwas abseits von den anderen Tieren der Herde und wurde für den ersten Angriff ausgewählt. Als wir in Schussweite kamen, wurde May ein Gewehr mit ausdrücklichen Anweisungen zu dessen Handhabung gegeben. Der Büffel hat nur eine verwundbare Stelle, und für einen Anfänger ist es fast unmöglich, einen tödlichen Schuss abzugeben. May schoss, und man könnte ihren Schuss vielleicht als gut bezeichnen, denn das Tier wurde getroffen. Es war jedoch nur verwundet, wütend und stürmte mit gesenktem Kopf auf uns zu. Die Offiziere beschossen den Berg aus Fleisch, was ihn jedoch nur noch wütender machte. May wurde ein weiteres Gewehr gereicht und Dr. Powell gab ihr Anweisungen zum Zielen. Doch May war so erschrocken über die Nähe des angreifenden Bullen, dass sie wahllos schoss.
Obwohl dies streng genommen eine Erzählung der Tatsachen ist, nutzen wir das Privileg des Romanciers und lassen unsere Heldin in ihrer gefährlichen Lage zurück, um für einen Moment zum Fort zurückzukehren.
Will kehrte kurz nach dem Aufbruch der Jagdgruppe von seiner Erkundungstour zurück und fragte sofort: »Ist Nellie hier?«
»Sie ist gekommen und wieder gegangen«, antwortete seine Frau und erzählte ihm, wie ich zu der lang diskutierten Büffeljagd mitgenommen worden war. Daraufhin gab Will einem seiner seltenen Wutausbrüche nach. Die Erkundungstour war lang und beschwerlich gewesen. Er war müde und hungrig, aber auch sehr besorgt um unsere Sicherheit. Er wusste, was wir nicht wussten: Selbst wenn wir die nicht unerheblichen Gefahren einer Büffeljagd überstehen sollten, bestand immer noch die Möglichkeit, von Indianern gefangen genommen zu werden. »Ich muss ihnen sofort nachgehen«, sagte er, machte sich auf den Weg und dachte weder an Ruhe noch an Essen. Er nahm sich jedoch die Zeit, die Offiziersunterkünfte aufzusuchen und seinen Zorn über den verwirrten Untergebenen zu ergießen, der den Platz des abwesenden Kommandanten eingenommen hatte. »Wussten Sie nicht«, rief Will, »dass meine anhaltende Abwesenheit Gefahr bedeutete? Eine großartige Idee, eine Gruppe von Damen auf eine so tollkühne Expedition außerhalb des Forts zu schicken, bevor ich Ihnen versichert hatte, dass dies sicher ist! Wenn meinen Schwestern etwas zustößt, werde ich die Regierung dafür verantwortlich machen!«
Mit dieser gewaltigen Drohung bestieg er das schnellste Pferd im Lager und ritt davon, bevor sich der verblüffte Offizier von seiner Überraschung erholt hatte.
Er konnte uns über die Sandhügel verfolgen und erreichte uns, wie es sich für einen Helden gehört, gerade noch rechtzeitig. Der rasende Büffel stürmte auf May zu, ungehindert durch das heftige Feuer der Gewehre der Offiziere. Alle waren so von der intensiven Aufregung des Augenblicks eingenommen, dass sie das Geräusch der sich nähernden Hufschläge nicht bemerkten. Doch ich hörte hinter uns den Knall eines Gewehrs und sah, wie der Büffel fast zu unseren Füßen tot zu Boden fiel.
Die schlechte Laune unseres Retters dämpfte die Begeisterung, mit der wir ihn empfingen. Die lange Reise mit leerem Magen hatte seine aufgewühlte Stimmung nicht beruhigt und er wies uns alle ordentlich zurecht. Er befahl uns, sofort zum Fort zurückzukehren, und dieser Befehl war so eindeutig, dass niemand daran dachte, ihn anzufechten. Die einzige Frage war, ob wir das Fort erreichen konnten, bevor wir von Indianern abgeschnitten wurden. Es gab keine Zeit zu verlieren, nicht einmal, um Fleisch von der Zunge des gefallenen Büffels zu schneiden. Will zeigte uns den kürzesten Weg nach Hause und ritt im Zickzack vor uns her, um nach Gefahrensignalen Ausschau zu halten.
Ich für meinen Teil war so erschöpft, dass ich mich lieber von Indianern gefangen nehmen lassen würde, wenn sie mir ein Wigwam zur Verfügung stellen würden, in dem ich mich hinlegen und ausruhen könnte. Aber es tauchten keine Indianer auf. Fünf Meilen vom Fort entfernt lag die Ranch eines wohlhabenden Junggesellen. Auf Mays Bitte hin legten wir hier eine Pause ein. Man hoffte, dass der Besitzer der Ranch Mitleid mit meinem erbärmlichen Zustand haben und den Damen für den Rest der Reise ein Transportmittel zur Verfügung stellen würde.
Wir wurden herzlich empfangen und unser Gastgeber sorgte dafür, dass wir uns in seinen Räumlichkeiten rundum wohlfühlten. Währenddessen bestellte er für die Gruppe ein Abendessen. Will war der Meinung, dass wir uns in der Sicherheitszone befanden. Er brach daher zum Fort auf, um seine verschobene Ruhepause einzulegen. Nach dem Abendessen fuhren die Damen in einer Kutsche zum Fort.
In der Omaha-Zeitung des nächsten Tages erschien ein Bericht über die Jagd aus der Feder von Dr. Powell, in dem May Cody den ganzen Ruhm für den Schuss zuteilwurde, durch den der Büffel zu Fall gebracht worden war. Zeitungsleute sind in der Regel bereit, genaue Fakten einem angeborenen Sinn für das Malerische zu opfern.
Zu dieser Zeit machte sich im Fort angesichts zahlreicher Kleinkriminalitätsdelikte unter den Zivilisten etwas Sorge breit. General Emory, der nun die oberste Autorität in der Festung war, bat die Bezirksbeauftragten, Will zum Friedensrichter zu ernennen. Dies geschah sehr zum Leidwesen des neuen Richters, der, wie er selbst sagte, »von Recht so viel verstand wie ein Maultier vom Singen«. Aber er war gezwungen, die ihm auferlegte Ehre zu ertragen, und sein Schild wurde an einer gut sichtbaren Stelle angebracht:
William F. Cody
Friedensrichter
Fast das Erste, was er in seiner neuen Funktion zu tun hatte, war, eine Trauung durchzuführen. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, als er uns in dieser verzweifelten Notlage um Hilfe bat.
Das große Gesetzbuch, das er bei seiner Amtseinführung erhalten hatte, durchforstete er vergeblich nach den benötigten Informationen.
Die Bibel wurde vielleicht so gründlich untersucht wie nie zuvor, aber das Gute Buch war ebenso wenig hilfreich wie der Gesetzeskodex.
»Erinnern Sie sich an Ihre eigene Trauung«, lautete unser Rat, »halten Sie sich so genau wie möglich daran.«
Doch er schüttelte verzweifelt den Kopf. Der sonst so besonnene Scout und Indianerkämpfer war bestürzt, und die Würde des Gesetzes stand auf dem Spiel.
Um die Krise noch zu verschärfen, nahm fast das gesamte Fort an der Hochzeit teil. »Alles ist gut«, sagten wir, als wir sahen, wie der Richter ohne Anzeichen von Nervosität seinen Platz vor dem Brautpaar einnahm.
Zu Beginn verlief die Zeremonie unter seiner Leitung tadellos und wir gratulierten uns insgeheim zu seinem Erfolg. Doch plötzlich wurden wir durch eine Ankündigung aufgeschreckt: »Was Gott und Buffalo Bill zusammengefügt haben, soll kein Mensch trennen.«
Soweit ich weiß, hat noch niemand versucht, dies zu tun.
Bevor May nach Hause zurückkehrte, wurde Will stolzer Vater eines Sohnes.
Er hatte nun drei Kinder: eine zweite Tochter namens Orra, die zwei Jahre zuvor geboren worden war, und einen Sohn. Der erste Junge der Familie war eine Zeit lang Gegenstand des ungeteilten Interesses der Post und es wurden Dutzende von Namen vorgeschlagen.
Major North schlug Kit Carson als passenden Namen für den Sohn eines großen Spähers und Büffeljägers vor. Darauf einigte man sich schließlich.
Meine erste echte Angst kam auf, als Will der Befehl erteilt wurde, sich im Hauptquartier zum Dienst zu melden.
Das Land sei voller Indianer, teilte ihm der Befehlshabende Offizier mit. Diese Nachricht erfüllte mich mit Furcht.
Meine Schwägerin hatte sich an die Ausflüge ihres Mannes in gefährliche Gebiete gewöhnt und akzeptierte solche Unternehmungen als Teil seiner Position. Später lernte auch ich diese stoische Einstellung, aber anfangs war meine Angst so groß, dass Will mich auslachte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte er. »Die Indianer werden das Fort heute Nacht nicht besuchen. Es besteht keine Gefahr, dass sie dir den Skalp abnehmen.«
»Aber«, sagte ich, »ich habe Angst um dich, nicht um mich selbst. Es ist schrecklich, daran zu denken, dass du allein in diese Ausläufer der Berge gehst, in denen es von Indianern wimmelt.«
Das Fort lag in der Prärie, doch die fernen Ausläufer erstreckten sich endlos und boten den Rothäuten beliebte Verstecke.
Will zog mich zu einem Fenster und zeigte auf die dritte Hügelkette, die etwa zwölf bis fünfzehn Meilen entfernt war.
»Ich würde dir raten, ins Bett zu gehen und zu schlafen«, sagte er. »Aber wenn du darauf bestehst, wach zu bleiben und dir Sorgen zu machen, werde ich um Mitternacht auf dem Gipfel dieses Hügels ein Feuer entzünden. Beobachte es genau. Ich kann nur einen einzigen Blitz senden, denn es wird noch andere wache indianische Augen geben.«
Man kann sich vorstellen, mit wie klopfendem Herzen ich in die Dunkelheit starrte, als die Uhr zwölf Uhr schlug. Die Nacht war wie ein Schleier, der tausend Schrecken verbarg. Für meine aufgeregte Fantasie war dieser Schleier jedoch hauchdünn, und ich sah, wie eine Schar schattenhafter Reiter mit hochgereckten Lanzen dahinter vorbeizog. Wie konnte ein Mann allein in ein so düsteres, von Schrecken heimgesuchtes Gebiet?
Die Ritter von einst, die auf der Suche nach finsteren Ungeheuern und giftigen Drachen auszogen, waren nicht mutiger. Sie stellten sich nur eingebildeten Gefahren.
Zwölf Uhr! Die Nacht hatte tausend Augen, aber sie durchdrangen die Dunkelheit der Ausläufer nicht.
Ah! Ein dünnes Lichtband schlängelte sich für einen Augenblick nach oben, dann verschwand es.
Bis dahin war Will in Sicherheit. Aber es lagen noch viele Stunden – die dunkelsten – vor der Morgendämmerung und ich trug den größten Teil meiner Vorahnungen mit ins Bett.
Am nächsten Tag kam der Späher nach Hause, um den genauen Standort der feindlichen Sioux zu melden. Die Truppen, die zum sofortigen Einsatz bereit waren, wurden gegen sie geworfen und die Indianer gründlich geschlagen.
Eine große Anzahl von Häuptlingen wurde gefangen genommen, darunter Red Shirt, ein interessanter Rothaut, der später mit dem Wilden Westen reiste.
Gefangene Häuptlinge waren für die Damen des Forts stets sehr interessant. Für mich waren die beim letzten Überfall gefangenen Krieger vor allem wegen ihrer spärlichen Bekleidung und ihrer mürrischen Art bemerkenswert.
Im selben Herbst erhielt das Fort Besuch von einem Herrn, der als Colonel Judson vorgestellt wurde, obwohl die Öffentlichkeit ihn besser als »Ned Buntline«, den Geschichtenerzähler, kannte. Er wollte die Späher auf einer bestimmten Reise begleiten. Major Brown teilte Will mit, dass das eigentliche Motiv des Autors darin bestand, Buffalo Bill als Helden in einen Roman zu integrieren.
»Nun, ich würde in einem Roman gut aussehen, nicht wahr?«, sagte Will sarkastisch und errötete.
»Ja, ich denke, das würden Sie«, erwiderte der Major und musterte die stattliche Statur seines Gegenübers kritisch.
Daraufhin errötete der Scout erneut, nahm seinen Sombrero ab und bedankte sich für das Kompliment.
»Es ist natürlich schön, seinen Namen gedruckt zu sehen. Ein Buch ist ein Buch, auch wenn es nichts enthält.«
Ned Buntline, ein pensionierter Marineoffizier, trug einen schwarzen Militäranzug. Er hatte ein gebräuntes, zerfurchtes Gesicht, das entschlossen und doch freundlich wirkte. Er humpelte leicht und stützte sich auf einen Stock. Als sie sich vorstellten, schüttelte er Will herzlich die Hand und drückte seine große Freude über das Treffen aus. Dies war der Beginn einer Freundschaft, die Buffalo Bills Karriere entscheidend verändern sollte.
Während der anschließenden Erkundungsexpedition stieß die Gruppe zufällig auf einen riesigen Knochen, den der Chirurg als Oberschenkelknochen eines Menschen identifizierte. Will verstand die Sprachen der Indianer gut genug, um einige ihrer Traditionen zu kennen. Er erzählte die Sioux-Legende von der Sintflut.
Die Weisen dieses Stammes lehrten, dass die Erde ursprünglich von Riesen bevölkert war, die dreimal so groß waren wie moderne Menschen. Sie waren so schnell und stark, dass sie neben einem Büffel herlaufen, das Tier unter einen Arm nehmen, ihm ein Bein abreißen und es während des Laufens verspeisen konnten. Aufgrund ihrer Größe und Stärke waren sie so überheblich, dass sie die Existenz eines Schöpfers leugneten. Wenn es blitzte, verkündeten sie ihre Überlegenheit gegenüber dem Blitz, und wenn es donnerte, lachten sie.
Dies missfiel dem Großen Geist, und um ihre Arroganz zu züchtigen, sandte er einen großen Regen auf die Erde. Die Täler füllten sich mit Wasser und die Riesen zogen sich in die Hügel zurück. Das Wasser stieg jedoch die Hügel hinauf und die Riesen suchten Zuflucht auf den höchsten Bergen. Der Regen hielt jedoch an und das Wasser stieg weiter. Die Riesen, die keine andere Zuflucht hatten, ertranken.
Der Große Geist lernte aus seinem früheren Fehler. Als das Wasser zurückging, schuf er eine neue Menschengattung, die kleiner und weniger stark war.
Diese Überlieferung wurde seit Urzeiten von Sioux-Vater zu Sioux-Sohn weitergegeben. Wie die Legenden aller Völker zeigt auch sie, dass die Geschichte der Sintflut eine allen Völkern gemeinsame Geschichte ist.
Eine andere interessante indianische Überlieferung zeugt jedoch von einem späteren Ursprung. Demnach formte der Große Geist einst einen Menschen aus Lehm und legte ihn zum Backen in den Ofen. Doch er wurde zu lange der Hitze ausgesetzt und kam verbrannt heraus. So entstand die Negerrasse. Bei einem weiteren Versuch fürchtete der Große Geist, der zweite Lehm-Mann könnte ebenfalls verbrennen, und ließ ihn nicht lange genug im Ofen. So entstand der hellhäutige Mann. Nun war der Große Geist in der Lage, ein perfektes Werk zu vollbringen: Der dritte Lehm-Mann wurde weder zu lange noch zu kurz im Ofen gelassen und kam als Meisterwerk, als das Nonplusultra der Schöpfung, heraus – der edle rote Mann.
Schreibe einen Kommentar