Die Geheimnisse Londons – Band 1- Kapitel 10
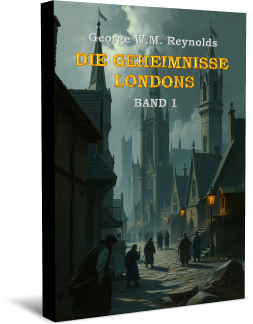 George W.M. Reynolds
George W.M. Reynolds
Die Geheimnisse Londons
Band 1
Kapitel 10
Die Geschichte der Schwachen
Wir müssen nun zu Richard Markham zurückkehren.
Sir Rupert Harborough und der ehrenwerte Arthur Chichester schienen ihn sehr zu mögen. Sie verabredeten sich ständig mit ihm in der Stadt und eilten zu seinem Haus, um ihn aufzusuchen, wenn er nicht an den üblichen Treffpunkten erschien. Er speiste mindestens dreimal pro Woche bei Mrs. Arlington und um ehrlich zu sein, wurden seine morgendlichen Besuche in immer kürzeren Abständen wiederholt.
So verbrachte Richard häufig Stunden allein mit Diana. Unwillkürlich ließ er seinen Blick hin und wieder zärtlich auf ihrem Gesicht ruhen, und allmählich begegnete ihr Blick seinem, ohne sich sofort wieder abzuwenden. Diese Blicke waren so schmachtend und zugleich so melancholisch, dass sie Richard mit einer Leidenschaft erfüllten, die fast einem Delirium glich. Manchmal hatte er das Gefühl, er könnte dieses schöne Geschöpf in seine Arme schließen und sie ekstatisch an seine Brust drücken.
Als er sich eines Morgens von ihr verabschiedete, glaubte er, ihre Hand sanft die seine drücken zu spüren. Dieser Gedanke erfüllte ihn mit einer bis dahin unbekannten Freude, die er selbst nicht beschreiben konnte.
Am nächsten Morgen kam er etwas früher als gewöhnlich. Diana trug ein entzückendes Negligé, das ihre üppige Figur vorteilhaft zur Geltung brachte. Richard war zärtlicher als sonst, und die Zauberin war bezaubernder als je zuvor.
Sie saßen zusammen auf dem Sofa und machten eine Pause in ihrem Gespräch. Richard seufzte tief und rief plötzlich aus: »Ich denke immer an die Zeit, in der ich mich von Ihrer charmanten Gesellschaft verabschieden muss.«
»Verabschieden?«, rief Diana. »Und warum?«
»Früher oder später wird es unvermeidlich sein, dass sich unsere Wege in der Welt trennen.«
»Bist du dann nicht dein eigener Herr?«, fragte Diana forschend.
»Natürlich bin ich das. Aber alle Freunde müssen sich irgendwann einmal trennen.«
»Das ist wahr«, sagte Diana. Dann fügte sie mit gedämpfter Stimme hinzu: »Es gibt Menschen, die sich aufgrund ähnlicher Gefühle und Emotionen zueinander hingezogen fühlen. Für sie ist es sehr schmerzhaft, sich zu trennen!«
»Himmel, Diana!«, rief Richard aus. »Du empfindest genauso wie ich!«
Sie wandte ihm das Gesicht zu: Ihre Wangen waren rot vor Verlegenheit und ihre Augen waren voller Tränen. Doch durch diese Tränen warf sie ihm einen Blick zu, der sein Innerstes entzückte. Er schien voller Liebe und Zärtlichkeit zu sein und weckte in ihm Gefühle, die er noch nie zuvor gekannt hatte. Die Worte Du fühlst genauso wie ich enthielten das naive und unverfälschte Bekenntnis einer neuen Leidenschaft eines Geistes, der noch so unerfahren in den Wegen dieser Welt war wie ein junger Vogel im Nest seiner Mutter, der die grünen Wälder noch nicht kannte. Doch die Tränen in den Augen der Dame, ihr Erröten und ihr Blick, der wie ein Sonnenstrahl inmitten eines Aprilschauers auf den jungen Mann an ihrer Seite fiel, flößten ihm Mut ein, weckten undefinierbare Hoffnungen und erfüllten ihn mit ekstatischer Freude.
»Warum weinst du, Diana?«
»Du liebst mich, Richard«, antwortete sie, wandte ihm ihre schmelzenden blauen Augen zu und hielt den Blick einige Augenblicke lang auf sein Gesicht gerichtet. »Du liebst mich, und ich fühle – ich weiß, dass ich deiner Zuneigung nicht würdig bin!«
Richard schreckte auf, als wäre er plötzlich aus einem Traum erwacht, als wäre er aus einer angenehmen Vision in die harte Realität zurückgekehrt. Er ließ ihre Hand los, die er gehalten hatte, und versank für einige Augenblicke in tiefes Nachdenken.
»Ach! Ich wusste, dass ich dich an deine Pflicht dir selbst gegenüber erinnern würde«, sagte Diana bitter. »Nein, ich bin dir nicht würdig. Aber damit du mir in Zukunft meine Offenheit und Aufrichtigkeit zugutehalten wirst, damit du durch mich selbst vor mir gewarnt bist und damit du mich als Freundin schätzen lernst, wenn du willst, werde ich dir in wenigen Worten die Ereignisse schildern, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin!«
»Fahre fort«, sagte Richard. »Fahre fort! Glaube mir, ich werde dir aufmerksam zuhören – mit größter Aufmerksamkeit!«
»Mein Vater war ein pensionierter Kaufmann«, begann Diana, »und da ich sein einziges Kind war und er über ein ausreichendes Vermögen verfügte, gab er mir die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen konnte. Wahrscheinlich hatte der gute alte Mann beschlossen, dass ich eines Tages einen Adligen heiraten sollte. Da meine Mutter gestorben war, als ich noch sehr jung war, gab es niemanden in meiner Nähe, der die Eitelkeit korrigieren konnte, zu der mich die Schmeicheleien und ehrgeizigen Ansprüche meines Vaters inspirierten. Vor etwa drei Jahren traf ich im Theater, in das ich mit einigen Freunden gegangen war, einen jungen Herrn – groß, gutaussehend und faszinierend wie Sie. Er schaffte es, meinem Vater offiziell vorgestellt zu werden, und wurde zu uns nach Hause eingeladen. Bald wurde er zu einem regelmäßigen Gast. Er hatte ein glückliches Händchen dafür, sich den Launen und Vorlieben seiner Gesprächspartner anzupassen. Er gewann das Herz meines Vaters, indem er mit ihm Schach spielte, ihm die Neuigkeiten aus der Stadt erzählte und ihm die Abendzeitung vorlas. George Montague wurde bald zu einem festen Liebling meines Vaters und er konnte ohne ihn nichts mehr tun. Schließlich schlug Montague ihm bestimmte Spekulationen mit Wertpapieren vor. Mein Vater war von der Aussicht, sein Kapital zu vervierfachen, verführt und willigte ein. Ich muss gestehen, dass die gute Erscheinung des jungen Mannes eine gewisse Wirkung auf mich hatte – ich war damals ein leichtfertiges junges Mädchen – und ich ermutigte meinen Vater eher zu diesen Plänen, als dass ich ihn davon abhielt. Zunächst waren die Spekulationen äußerst erfolgreich, doch dann wendete sich das Blatt. Tag für Tag kam Montague zu uns nach Hause, um neue Verluste und die Notwendigkeit weiterer Vorschüsse zu verkünden. Er erklärte, dass er nun um einen hohen Einsatz spekulieren müsse, der sich in Kürze zu seinem Vorteil auswirken würde. Eine Art Verblendung ergriff meinen Vater und mir war nicht bewusst, welchen ruinösen Kurs er verfolgte, bis es zu spät war. Schließlich war mein Vater völlig ruiniert und George kam, um uns das Scheitern unserer letzten Chance mitzuteilen. Mein Vater bereute, doch es war zu spät. Acht kurze Monate hatten ausgereicht, um sein gesamtes Vermögen zu verschwenden. Er hatte nicht einmal mehr genug, um seine wenigen Schulden zu bezahlen, die er nicht beglichen hatte, weil er jeden Tag auf den glücklichen Moment vertraute, in dem er sich als Herr über Millionen wiederfinden würde.
»Oh, was für eine absurde Hoffnung!«, rief Richard aus, der von dieser Erzählung tief gefesselt war.
»Leider war dieses Ereignis ein fataler Schlag für die Gesundheit meines Vaters und zerstörte gleichzeitig sein Glück«, fuhr Diana fort. »Er flehte Montague an, sein liebes Kind – so nannte er mich – nicht im Stich zu lassen, falls ihm etwas zustoßen sollte. Und noch am selben Tag, an dem er alle seine Aussichten und Hoffnungen in diesem Leben zunichte sah, setzte er seinem Leben mit Gift ein Ende!«
»Das ist schrecklich!«, rief Markham. »Oh, dieser Schuft Montague!«
»Die Gläubiger meines Vaters kamen, um die wenigen verbliebenen Habseligkeiten zu pfänden«, sagte Diana nach einer Pause. »Ich stand kurz davor, obdachlos und schutzlos auf der Straße zu landen, als Montague eintraf. Er holte Gold aus seiner Tasche und beglich die Forderungen der Gläubiger. Außerdem versorgte er mich mit Geld für meine unmittelbaren Bedürfnisse. Ich war völlig von ihm abhängig, denn ich hatte keine Verwandten oder Freunde, an die ich mich um Hilfe oder Trost hätte wenden können. Er schien Mitleid mit meiner Lage zu haben.«
»Vielleicht«, bemerkte Richard, »war er doch nicht so schuldig, was den Verlust des Vermögens Ihres Vaters angeht?«
»Urteilen Sie anhand der Folgen«, antwortete Diana bitter. »Er war ebenso niederträchtig, wie er gefühllos war. Der Übergang von diesem Zustand der Abhängigkeit zu einer noch erniedrigenderen Situation war zu erwarten. Er sprach nicht mehr wie früher mit mir über Heirat, sondern nutzte meine verzweifelte Lage aus. Ich wurde seine Geliebte.«
»Ah! Das war niederträchtig, das war unredlich, das war unmännlich!«, rief Richard aus.
»Er schien über reichlich Mittel zu verfügen, aber er erklärte mir diesen Umstand damit, dass er einen anderen Freund gefunden habe, der ihn bei denselben Spekulationen unterstützte, bei denen mein armer Vater gescheitert war. Wir lebten vier Monate lang zusammen und dann teilte er mir kühl mit, dass wir uns trennen müssten. Da wurde mir klar, dass ich nie wirklich aufrichtige Zuneigung für ihn empfunden hatte. Die geringe Liebe, die ich anfangs für ihn empfunden hatte, war durch seine kalte Grausamkeit erloschen. Er schien bis zu einem gewissen Grad gefühllos zu sein. Bei jeder Gelegenheit kamen ihm Bemerkungen über die Lippen, die darauf abzielten, mich möglichst tief zu verletzen.«
»Der Feigling!«, rief Richard aus, tief bewegt von dieser Schilderung.
»Wenn ich über diese Grausamkeit weinte, behandelte er mich mit noch größerer Brutalität. Sie können sich daher vorstellen, dass ich nicht besonders traurig war, mich von ihm zu trennen. Er gab mir zwanzig Guineen und verabschiedete sich kalt von mir. Seitdem habe ich ihn weder gesehen noch von ihm gehört. Einige Wochen nach unserer Trennung war mein Geld aufgebraucht. Ich beschloss, ein tugendhaftes und ehrenhaftes Leben zu führen und meinen ersten Fehler zu büßen. Oh Gott! Damals wusste ich noch nicht, dass die Gesellschaft reumütige Schwache nicht aufnimmt, dass sie arme, getäuschte Frauen von jeder Hoffnung auf Wiedergutmachung und jeder Chance auf Reue ausschließt. Ich bemühte mich um eine Stelle als Gouvernante, doch das war genauso aussichtslos, als hätte ich versucht, Königin von England zu werden. Charakterzeugnisse! Ich hatte keine. Vergeblich flehte ich eine Dame, bei der ich mich beworben hatte, an, mir einen Monat Probezeit zu geben. Sie beleidigte mich grob. Als ich einer anderen meine ganze Geschichte offen gestand, hörte sie mir geduldig bis zum Ende zu und befahl dann ihrem Lakaien, mich aus dem Haus zu werfen. Die Gesellschaft bestraft nicht nur, sie verfolgt die unglückliche Frau, die einen Fehltritt begangen hat, mit rachsüchtiger und bösartiger Grausamkeit. Sie treibt sie in den Selbstmord oder zu neuen Verbrechen. Das sind die schrecklichen Alternativen. Hätte mir in diesem Moment eine freundliche Hand geholfen, hätte ich ein gütiges Herz getroffen, das an die Möglichkeit der Reue glaubte, und hätte ich nur die Chance erhalten, einen tugendhaften Lebensweg einzuschlagen, dann wäre ich gerettet worden! Ja, ich hätte meine erste Schuld gesühnt, soweit Sühne möglich war. Um dieses Ziel zu erreichen, hätte ich mir die Nägel bis auf das Fleisch abgekaut. Ich hätte jede noch so niedere Stellung angenommen. Ich hätte jedes Opfer gebracht und jedes Los ertragen, solange ich sicher gewesen wäre, mein Brot auf eine Weise zu verdienen, die mich nicht erröten ließ. Doch die Gesellschaft behandelte mich mit Verachtung. Warum wird in diesem christlichen Land die christliche Maxime gepredigt, dass »mehr Freude über einen Sünder herrscht, der Buße tut, als über neunundneunzig Gerechte, die keine Buße tun müssen«, wenn das gesamte Verhalten der Gesellschaft eine kühne Leugnung dieser Wahrheit ausdrückt? Warum wird diese Maxime gepredigt, wenn das gesamte Verhalten der Gesellschaft in unmissverständlichen Worten ihre kühne Leugnung zum Ausdruck bringt?«
»Gütiger Himmel«, rief Richard aus, »kann das wahr sein? Zeichnen Sie ein korrektes Bild, Diana, oder erfinden Sie eine abscheuliche Fiktion?«
»Gott weiß, wie wahr alles ist, was ich sage!«, antwortete Mrs. Arlington mit tiefer Aufrichtigkeit in Ton und Haltung. »Die Not starrte mir ins Gesicht, was konnte ich tun? Der Zufall führte mich zu Sir Rupert Harborough. Getrieben von einer zwingenden Notwendigkeit wurde ich seine Geliebte. Das ist meine Geschichte.«
»Und der Baronet behandelt Sie freundlich?«, fragte Richard.
»Die Bedingungen, auf denen unsere Verbindung basiert, geben ihm weder die Möglichkeit, besonders freundlich noch besonders grausam zu sein.«
»Ich muss mich jetzt für den Moment verabschieden«, rief Markham aus, aus Angst, sich länger der Sirene anzuvertrauen, die ihn sowohl mit ihrem Unglück als auch mit ihrem Charme fasziniert hatte. »In ein oder zwei Tagen werde ich Sie wiedersehen. Oh! Ich kann Ihnen nicht vorwerfen, was Sie getan haben – ich bemitleide Sie! Könnte irgendein Opfer, zu dem ich fähig bin, Ihnen Ihr Glück zurückgeben?«
»Ehre«, rief Diana entschlossen.
»Dieses Opfer würde ich gerne bringen«, fügte Richard hinzu. »Von diesem Moment an werden wir Freunde sein, sehr aufrichtige Freunde. Ich werde dein Bruder sein, liebste Diana, und du wirst meine Schwester sein!«
Der junge Mann erhob sich vom Sofa und sprach diese zusammenhanglosen Sätze auf eine seltsam wilde und schnelle Weise aus. Diana gab keine Antwort, war aber sichtlich tief bewegt und drückte einige Augenblicke lang seine Hand zwischen ihren beiden Händen.
Dann entfloh Richard hastig aus der Gegenwart dieses charmanten und faszinierenden Wesens.
Schreibe einen Kommentar