Das Gespensterbuch – Elfte Geschichte
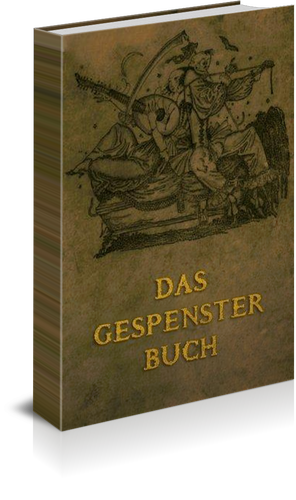 Das Gespensterbuch
Das Gespensterbuch
Herausgegeben von Felix Schloemp
Mit einem Vorwort von Gustav Meyrink
München 1913
Karl Hans Strobl
Die arge Nonn’
Eines Nachts erwachte ich plötzlich aus tiefem Schlaf. Ich war verwundert, überhaupt erwacht zu sein, denn ich hatte tagsüber auf dem Trümmerfeld der Jesuitenkaserne gearbeitet und war sehr müde. Ich legte mich auf die andere Seite und versuchte, wieder einzuschlafen. Doch da hörte ich einen Schrei, der mir den Schlaf raubte. Es war ein Schrei der Angst und im nächsten Moment saß ich aufgerichtet im Bett. Zunächst versuchte ich, mich zurechtzufinden. Wie es oft nachts der Fall ist, wusste ich nicht, wo sich Tür und Fenster befanden. Dann besann ich mich, dass ich merkwürdigerweise nur in einer von Nord nach Süd ausgerichteten Lage schlafen kann, und wusste nun, dass sich die Tür zur Rechten und das Fenster zur Linken befanden. Im Bett zu meiner Rechten schlief meine Frau ihren ruhigen, friedlichen Kinderschlaf. Nach einer Weile, die ich gespannt horchend verbrachte, legte ich mich wieder zurück und überzeugte mich davon, dass ich doch geträumt haben musste. Seltsam stark und wild musste dieser Traum gewesen sein, denn noch so deutlich drang ein Schrei in die Dämmerung meines Bewusstseins. Erst nach zwei Stunden schlief ich wieder ein.
Am Tag ließ mich meine Arbeit nicht dazu kommen, meinen Gedanken, die sich unaufhörlich mit meinem Traum beschäftigten, ungestört nachzuhängen. Ich musste die Abrissarbeiten leiten und überwachen, während ich zwischen den Trümmern der Jesuitenkaserne herumkletterte. Die Sonne brannte unbarmherzig auf mich herab, der Staub des abgebrochenen Gemäuers hüllte mich ein und legte sich auf meine Lungen. Pünktlich um elf Uhr, wie alle Tage, erschien der Vorstand des Landesarchivs, Doktor Holzbock, bei mir und erkundigte sich nach dem Fortschritt der Arbeiten. Er interessierte sich sehr für die Zerstörung des uralten Gebäudes, das in seinen ältesten Teilen fast bis zur Gründungszeit der Stadt zurückreichte. Da er die Geschichte des Landes zu seinem Studium gemacht hatte, erhoffte er sich von der Sezierung dieses ehrwürdigen Körpers manche Aufschlüsse. Wir standen im großen Hof und sahen zu, wie die Arbeiter das erste Stockwerk des Hauptflügels abbauten.
»Ich bin überzeugt«, sagte er, »dass wir noch viel Sonderbares finden werden, wenn wir erst zu den Fundamenten kommen. Auf die Zeugnisse der Vergangenheit wirkt eine Kraft, die der physikalischen Schwerkraft verwandt ist; sie zieht sie zu Boden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr mich solche alten Gebäude fesseln, wenn sie eine so reiche Geschichte haben wie dieses. Zuerst ein Kaufmannshof, dann ein Nonnenkloster, dann eine Festung der Jesuiten und schließlich eine Kaserne. Es scheint, als sei sie von allen Ereignissen berührt worden, als habe sie jede Äußerung des Lebens in sich hineingesogen, sodass ihre Spur zurückblieb. An diesen Ablagerungen, an diesen Schichten, deren Überlagerung die Folgen der Zeiten bedeutet, könnte man eine Geologie der Geschichte aufstellen. Ich glaube, dass wir noch seltsame Dinge in diesem alten Mauerwerk entdecken werden – nicht nur Töpfe mit alten Münzen und übertünchte Fresken, sondern auch versteinerte Abenteuer und fossile Schicksale.«
So sprach der fanatische Archivar, während die Spitzhauen neben uns an dem festen Mauerwerk arbeiteten. Ein Bogengang war bloßgelegt worden, und ich musste mir die aufeinanderfolgenden Züge von Kaufleuten, Nonnen und Jesuiten vorstellen, die einen Teil ihres Lebens unter dem lastenden, grauen Gewölbe dieses Ganges verbracht hatten. Während Doktor Holzbock seine Rhapsodie fortsetzte, fasste ich, da ich den Verführungen der Romantik nicht widerstehen kann, den Entschluss, die Ruine einmal nachts aufzusuchen.
Ich wollte mich dem Reiz des Unheimlichen aussetzen und mich mit den Geistern des Ortes anfreunden.
In dieser Nacht erwachte ich, genauso wie in der vorigen Nacht, aus dem Schlaf und hörte kurz darauf den furchtbaren Schrei. Ich hatte mich darauf gefasst gemacht, ihn zu hören, und strengte mich an, genau festzustellen, woher er kam. Doch im entscheidenden Augenblick ergriff mich eine unerklärliche Angst, sodass ich wirklich nicht genau wusste, ob er aus dem Inneren unseres Hauses oder von der Straße kam. Kurz darauf glaubte ich, von der Straße Schritte laufender Menschen zu hören. Bis zum Morgen lag ich in unruhigem Halbschlaf und beschäftigte mich mit dem Rätsel dieses Schreis. Als ich beim Frühstück meiner Frau von dieser Sache erzählte, lachte sie zuerst. Dann sagte sie jedoch besorgt: »Ich glaube, du fängst an, nervös zu werden, seitdem du in der alten Jesuitenkaserne arbeitest. Nimm doch Urlaub und lass dich von einem Kollegen vertreten. Du bist übermüdet und hast Pflichten gegenüber deiner Gesundheit.«
Aber ich wollte davon nichts wissen, denn das Graben im Schutt dieses alten Gebäudes, das Suchen nach den Dingen, von denen der Archivar so viel erwartete, war mir zur Leidenschaft geworden. Lediglich das erreichte meine Frau, dass ich ihr versprach, sie zu wecken, sollte ich nachts erwachen.
Auch in dieser Nacht fuhr ich wieder aus dem Schlaf. Hastig und ängstlich rüttelte ich meine Frau wach und wir saßen nebeneinander aufrecht in den Betten. Da kam auch schon der Schrei, gellend und ganz deutlich, von der Straße herauf. »Hörst du … jetzt, jetzt. . .« Aber meine Frau zündete das Licht an und leuchtete mir ins Gesicht: »Mein Gott, wie du aussiehst! Es ist doch nichts. Ich höre gar nichts.«
Ich war so außer mir, dass ich sie anschrie: »Schweig doch … und jetzt … Jetzt laufen sie unten auf der Straße.«
»Du tust mir weh«, rief meine Frau, denn ich drückte ihren Arm, als müsste ich sie mit Gewalt überzeugen.
»Hast du nichts gehört?«
»Nichts! Gar nichts!«
Ich sank in die Polster zurück. Ich war schweißbedeckt, erschöpft wie nach einer schweren körperlichen Arbeit und unfähig, den besorgten Fragen meiner Frau irgendeine beruhigende Antwort zu geben. Gegen Morgen, als sie schon wieder schlief, wurde mir klar, was ich tun musste, um meinen Verstand zu bewahren. Durch ein völlig gelassenes und besonnenes Verhalten während des Tages gelang es mir, meine Frau glauben zu machen, dass ich mich beruhigt hatte. Während des Nachtmahls scherzte ich über meine nächtlichen Halluzinationen und gab ihr das Versprechen, heute bis zum Morgen zu schlafen und mich weder um den Schrei noch um den Tumult auf der Straße zu kümmern. Ich gab ihr sogar das Versprechen, nach Beendigung der besonders verantwortungsvollen Arbeiten sofort einen längeren Urlaub zu beantragen. Kaum aber hörte ich an ihren Atemzügen, dass sie eingeschlafen war, erhob ich mich und kleidete mich wieder an. Um unsinnigen Gedanken keinen Raum zu geben, nahm ich Kants Kritik der reinen Vernunft zur Hand und versuchte, mich in die strengen und logischen Vorstellungsreihen zu versenken. Gegen Mitternacht überkam mich jedoch eine Unruhe, die mich unfähig machte, weiterzulesen. Es war unmöglich, dem eisernen Zwang des Buches zu folgen. Etwas Stärkeres zog mich von ihm weg. Leise erhob ich mich und ging vor das Haus. An meinem wachsenden Zittern merkte ich, dass die Zeit heranrückte. In die Vertiefung des Hauseingangs gedrückt, wartete ich. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, aber ich war entschlossen, die Qual meiner Nächte durch ein rasches Aufdecken der natürlichen Ursachen zu beenden. Zwanzig Schritte entfernt brannte eine Gaslaterne und gab genügend Licht für den Teil der Straße vor meinem Haus. Ein junger Mann, der offenbar etwas zu viel getrunken hatte, kam an der gegenüberliegenden Häuserfront bis zu dem Haus, in dem ich wohnte. Er blieb stehen und schloss nach einigen misslungenen Versuchen endlich das Tor auf. Ich hörte die Geräusche seiner Heimkehr noch im Hausflur und auf den ersten Stufen der Treppe. Dann war wieder alles still. Und plötzlich flammte der Schrei in diese Stille. Ich taumelte in den tiefen Schatten zurück und griff nach der Klinke, deren kaltes Metall ich deutlich in meiner Hand spürte. Verzweifelt und außer mir vor Angst wollte ich flüchten. Doch obwohl ich das Haustor nicht versperrt hatte, konnte ich es nun nicht öffnen. Da hörte ich auch schon die eilenden Schritte vieler Menschen auf der Straße, und plötzlich flog etwas an mir vorbei. Ich konnte nicht erkennen, ob es nur ein Schatten oder ein Mensch war. Im Augenblick des Sehens schien es nicht die Schwere eines Menschen zu besitzen, aber es hinterließ sofort den vollen Eindruck der Körperlichkeit: einer Frau, die mit rasendem Lauf die Straße hinunterkam, einer Frau in einem langen, wallenden Gewand, das sie, um besser laufen zu können, aufgenommen hatte. Und hinterdrein kam, wenige Schritte hinter ihr, eine ganze Schar von Männern in sonderbaren Trachten, die unserer Zeit fremd sind. Auch bei ihnen wiederholte sich diese Erscheinung: Wie Schemen gleitend vorüber, hinterließen sie den Eindruck von Körperlichkeit. Ich weiß nicht, welcher Wahnsinn mich ergriff und mich zwang, hinter ihnen herzulaufen. Es mag eine dem Wahnsinn der Schlacht verwandte Art gewesen sein, jenes Wahnsinns, der stärker ist als die Furcht und den Soldaten ins feindliche Feuer wirft. Niemals bin ich so gerannt wie damals; es war weniger ein Laufen als ein Gleiten und Schweben, wie man es sonst nur aus Träumen kennt. Ich sah immer die Jagd vor mir: die Frau voran und die Schar der Männer hinterdrein. Es schien mir, als würde ich schon lange so laufen, und dennoch spürte ich keine Erschöpfung. Plötzlich verschwand die Frau. Ich sah noch ein irres Hin und Her der verfolgenden Männer, dann schien alles in den Schatten der Nacht einzutauchen. Zu meinem Erstaunen stand ich vor dem Plankenzaun, der das Trümmerfeld der Jesuitenkaserne umgibt. Am Eingang, über dem die Tafel mit der Aufschrift »Nichtbeschäftigten ist das Betreten des Platzes verboten!« angebracht war. Ich riss die Tür auf und stürmte hinein. Da stand der Nachtwächter, ganz in der Nähe des Eingangs, an einen Balken gelehnt, und grüßte mich, als er mich plötzlich vor sich sah. Er war stolz darauf, dass ich ihn auf seinem Posten überrascht hatte, und wollte seine Meldung abstatten. Doch ich ließ ihn nicht zu Wort kommen.
»Haben Sie nicht eine Frau gesehen? Eben jetzt … Sie trug ein graues, langes Gewand, das sie zusammenraffte, und lief hier hinein!«
»Ich habe nichts gesehen, Herr Baumeister, gar nichts.«
»Aber, zum Teufel, sie kann doch nicht in der Luft zerflossen sein! Haben Sie etwa geschlafen? Mit offenen Augen geschlafen.«
Der Wächter war sehr gekränkt über meinen Verdacht und versicherte mit allem Nachdruck, dass er nicht geschlafen habe und trotzdem nichts gesehen habe. Nun begann ich selbst zu suchen. Ich kroch überall herum, blickte in alle Winkel der Höfe und übersah keines der vielen Zimmer und Zimmerchen, über deren zackig abgebrochenen Wänden die Decke der vom Widerschein der Stadt erhellten Nacht hing. Ich wagte mich über gefährliche Reste des Mauerwerks, die jeden Moment zusammenstürzen konnten, um in sonst unzugängliche Kammern blicken zu können.
Dann wieder rannte ich halboffene Galerien entlang, auf deren schmutziger Malerei der Schein der Laternen seltsame Schattenspiele trieb. Die Kirche, die einst vollständig von dem alten Gebäude eingeschlossen gewesen war, sodass nur Dach und Turm über die grauen Mauern ragten, war nun schon zum größten Teil freigelegt und bot eine Menge Schlupfwinkel. Aber auch hier fand ich nichts. Mit schwerem Kopf und zitternden Knien ging ich nach Hause. Währenddessen legte ich mir immer wieder zurecht, was ich gesehen hatte, und gab den Dingen neue Deutungen, aber ich wurde nur immer verwirrter.
»Hoffentlich hast du heute nichts gehört«, fragte meine Frau.
»Nein, ich habe fest geschlafen«, log ich und versteckte rasch meinen Kopf in der Waschschüssel, damit meine Frau die Zeichen dieser Nacht nicht in meinem Gesicht entdecken sollte.
An diesem Tag machten wir auf dem Trümmerfeld eine Entdeckung, die den Archivar in höchstes Entzücken versetzte. Bei der Abtragung eines schönen, alten Portals, das einen bedeutenden Kunstwert hatte, musste mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden, denn man wollte dieses Denkmal alter Kunst an anderer Stelle wieder aufstellen. Über zwei Pilastern, die eine reiche Ornamentik mit Blumen- und Früchtemotiven zeigten, schwang sich ein schöner Bogen über die Einfahrt. Auf den Simsen über diesem Bogen standen Heiligenstatuen im Geschmack des 17. Jahrhunderts. Heilige, die ihre Attribute wie Hieroglyphen ihres Schicksals vor sich hinhielten. Als man einen heiligen Jakobus von seinem Postament heben wollte, fiel der Kopf vom Hals, rollte ein paar Schritte weiter und blieb im Schutt liegen. Im Ansatz des Kopfes sah man eine runde, zylindrische Vertiefung, als ob dort einmal eine Eisenstange befestigt gewesen wäre. Als man den Rumpf herab hob, fand man, dass diese Vertiefung im Rumpf der Statue fortgesetzt wurde. Zunächst machte ich den Arbeitern wegen ihrer Unachtsamkeit Vorwürfe, doch Doktor Holzbock, der den Kopf aufgehoben und gespannt betrachtete, unterbrach mich.
»Die Leute können nichts dafür, lieber Freund. Das ist kein neuer Bruch, sondern ein alter. Keine zufällige Trennung, sondern eine beabsichtigte, und es würde mich nicht wundern …«
In diesem Augenblick kam einer der Arbeiter auf mich zu und reichte mir eine kleine Rolle schmutzigen Papiers. »Das war in dem Loch drin«, sagte er, »und vielleicht steht etwas darauf …«
Der Archivar sah mich an und nahm mir die Rolle aus der Hand. Mit aller Sorgfalt versuchte er, sie aufzurollen, und endlich gelang es ihm, sie auf dem Zeichentisch meiner Bauhütte auszubreiten und mit Reißnägeln zu befestigen. Es war ein Stück des starken Urkundenpapiers, auf dem die wichtigsten Verträge der Vergangenheit aufgezeichnet wurden. Ich versuchte vergeblich, mich in dem Gewirr der roten und schwarzen Linien zurechtzufinden. Es schien ein Plan zu sein. Als ich alle meine Kenntnisse als Baumeister vergeblich aufbot, um seinen Sinn zu finden, gab ich meine Bemühungen auf. Doktor Holzbock erklärte jedoch, er sei entschlossen, das Papier zu enträtseln, und bat mich, ihm zu gestatten, den Fund mitzunehmen.
Noch vor Feierabend kehrte er zurück und winkte mir schon von Weitem mit der Hand. Er legte feierlich die Hand auf meinen Arm und führte mich durch eine kleine Nebentür in die Kirche, wo wir ungestört waren. Ein wunderbarer Abendhimmel mit unergründlichen purpurroten und smaragdenen Tiefen, durch die violette Boote mit weißen Segeln der Nacht entgegenfuhren, gab der einsamen Kirche etwas von seinen Farben. Die hohen barocken Silberleuchter, zwischen denen wir standen, schimmerten rötlich, und die heilige Agnes an der gegenüberliegenden Wand verlor ihre Wehmut und erhielt durch die grellen Reflexe eine lodernde Sinnlichkeit im Ausdruck. Auch die Heiligenstatuen, die Kanzel und die Engel unterhalb der Emporen schienen verändert. Als wären sie vom Zwang des Tages erlöst, freuten sie sich auf die Nacht, in der sie ganz frei sein konnten und vielleicht ein Leben lebten, von dem wir nichts ahnten.
Inzwischen hatte der Archivar unseren Plan aus der Tasche gezogen und begann: »Nach einigem Nachdenken war mir klar, dass der Plan, so wie wir ihn zu sehen bekamen, sinnlos ist oder vielmehr, dass er seinen Sinn verbirgt. Betrachten wir das Gewirr von Strichen, so ahnen wir gerade so viel, dass es ein Plan sein könnte, aber wir sind nicht imstande festzustellen, was er zu bedeuten hat. Dem Aussehen des Papiers und den Buchstaben nach, die sich hier und da unter den Linien finden, kann ich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass er aus dem 17. Jahrhundert stammt, und zwar aus dessen erster Hälfte, also aus einer Zeit, in der dieses Bauwerk noch ein Nonnenkloster war. Nun habe ich eine alte Chronik gefunden, in der zu dieser Zeit des Klosters recht oft und recht wenig freundlich gedacht wird. Sie wissen, dass man damals manchen Klöstern die sonderbarsten Dinge nachsagte. So berichtet auch meine Chronik über dieses Kloster sehr viel, aber insgesamt wenig Erbauliches. Hatte unsere Vermutung recht, dass das gefundene Papier einen Plan darstellt, so könnte er irgendwelche Geheimnisse des alten Bauwerks bezeichnen und dann absichtlich verwirrend gestaltet worden sein, um anderen unverständlich zu erscheinen. Eine andere Überlegung stärkte mich in meiner Vermutung. Das Portal, mit dessen Abtragung Sie heute begonnen haben, befand sich an einem der Innentrakte!«
»Jawohl. Es ziert die Einfahrt des Verbindungsflügels zwischen dem nördlichen und dem südlichen Trakt, und zwar die dem sogenannten Dreifaltigkeitshof zugewandte Front.«
»Gut, und es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass dieses Portal mit der Spitze bis in die Höhe des zweiten Stockwerkes reicht, sodass einzelne der Figuren, das heißt die Köpfe der Statuen, ohne Schwierigkeiten aus den Fenstern dieses zweiten Stockes zu erreichen sind.«
»Gewiss, wir können es uns ja ansehen.«
»Bleiben Sie nur, es ist ganz sicher so. Die Köpfe einiger Figuren, darunter auch der des heiligen Jakobus, sind aus den Fenstern des zweiten Stockwerks ohne Mühe abzunehmen, wenn sie vom Rumpf getrennt sind. In einer geschickt angebrachten Vertiefung kann man ganz gut ein gefährliches Papier verstecken.«
»Sie meinen also …?«
»Habe ich Ihnen nicht gleich gesagt, dass es kein frischer Bruch ist? Ich war also vollkommen davon überzeugt, dass sich hinter dem wirren Gekritzel unseres Plans ein Geheimnis verbirgt. Doch wie sollte ich dahinterkommen? Ich musste mir alles gut überlegen, bevor ich irgendein chemisches Reagens anwandte, denn es bestand die Gefahr, dass ich damit alles verdarb. Als Urkundenforscher hatte ich oft Gelegenheit, die vielfältigen und sinnreichen Geheimmittel des Mittelalters zu bewundern. Ich kenne viele Rezepte für Geheimschriften. Eine große Rolle spielen dabei die sogenannten sympathischen Tinten. Die einfachste Art dieser Tinten ist die, deren Schrift nach dem Trocknen wieder unsichtbar wird und erst hervorkommt, wenn man das Papier erwärmt. Hier konnte von dieser Art keine Rede sein, denn unser Plan war ohnehin schon genug verkritzelt. Aber wäre nicht das Gegenteil möglich gewesen? Dass die unwichtigen und verwirrenden Linien beim Erwärmen verschwanden und nur die wichtigen Linien stehen blieben? Das war ein Versuch, den ich machen konnte, ohne Schaden für unseren Schatz befürchten zu müssen. Nun, mein lieber Freund, ich habe ihn gemacht, und er ist vollkommen gelungen. Wollen Sie einmal zusehen?«
Doktor Holzbock zog eine kleine Taschenlampe hervor und entzündete sie. Dann legte er den Plan an den Zylinder an. Wir warteten schweigend in der hereinbrechenden Dämmerung, die nur vom fahlen Licht der kleinen Lampe durchbrochen wurde. Nach einigen Minuten glaubte ich, zu beobachten, dass einige der Linien blasser wurden. Schließlich verschwanden sie ganz, und es blieb nur eine Anzahl von ihnen zurück.
»Ein regelrechter Plan, ein Grundriss«, sagte ich.
»Es wird nun Ihre Aufgabe sein, ihn zu lesen.«
In einem Augenblick hatte ich mich zurechtgefunden. »Hier haben wir den Dreifaltigkeitshof, hier ist der Kreuzgang und das hier bezeichnet die Kirche. Von der Sakristei aus geht … was ist das? Diesen Linien hier entspricht kein Bauwerk. Das muss … Ja, das ist ohne Zweifel ein unterirdischer Gang, der aus dem Kloster führt.«
Der Archivar war vor Freude außer sich, dass sich seine Vermutungen bestätigten. Und auch ich war erregt, denn es schien mir, als müsse diese Entdeckung auf irgendeine Weise mit meinen nächtlichen Erlebnissen in Zusammenhang stehen. Ich war schon im Begriff, ihm davon zu erzählen, als mich eine eigentümliche Scheu zurückhielt. Ich habe mich immer davor gehütet, über Dinge, die sich gerade in der Entstehung befinden, zu viel zu sprechen, denn ich fürchtete die Wirkung des gesprochenen Wortes. Das Wort ist mächtiger, als unser Alltagsverstand denkt, und es beeinflusst die Zukunft auf geheimnisvolle und unfehlbare Art. Doch Doktor Holzbock musste etwas von den Vorgängen in mir bemerkt haben, denn er fragte mich besorgt: »Was ist mit Ihnen? Sie sehen so merkwürdig aus.«
Ich zog ihn, ohne zu antworten, in die Sakristei. Dort begann ich, die Wände nach den Maßen des Plans abzusuchen. Ich fand, dass dort, wo der Beginn des unterirdischen Ganges sein sollte, ein riesiger Kasten an der Wand stand. Es war einer jener riesigen Kästen, die einen ganzen Reichtum an Messgewändern und Kostbarkeiten verbergen, ein gut gearbeitetes Stück alter Handwerkskunst. Ein Ungetüm, schwer wie ein Felsblock, mit reichen Schnitzereien verziert, der vom Boden bis zur Decke reichte. Der Archivar datierte seine Entstehungszeit ins 16. Jahrhundert. Wir waren beide davon überzeugt, dass sich der Eingang hinter diesem Kasten befinden müsse, aber wir waren uns auch darüber klar, dass wir das Ungetüm nicht von der Stelle bewegen konnten, wenn wir den geheimen Mechanismus nicht kannten.
»Genug für heute«, sagte Doktor Holzbock und überredete mich, nach Hause zu gehen, obwohl ich anfangs beabsichtigte, in der Sakristei die Nacht zu verbringen, als hätte ich irgendeine Kostbarkeit vor Dieben zu bewachen.
Unser Fund und die Vermutungen, die wir daran knüpften, beschäftigten mich so sehr, dass meine Frau behauptete, ich sei ganz verstört. Sie setzte mir so lange zu, bis ich ihr versprach, früher als geplant Urlaub zu nehmen. Obwohl ich entschlossen war, diese Nacht nicht wieder außerhalb des Bettes zu verbringen, zwang mich ein sonderbares Gefühl, das Angst und Neugier verband, aufzustehen und die dunkle Stunde unten auf der Gasse zu erwarten.
Es schlug zwölf Uhr, und gleich darauf hörte ich den furchtbaren Schrei. Das Geräusch laufender Menschen kam näher und die Verfolgung ging an mir vorüber, genauso wie in der vorigen Nacht. Diesmal sah ich deutlich, dass das Weib ein langes, nonnenartiges Gewand trug, das über der Brust ein wenig offenstand, als habe sie es eilig umgeworfen. Einen Augenblick kehrte sie mir ihr Gesicht zu, ein blasses, schönes Gesicht, in dem dunkle Augen ein seltsames Licht ausstrahlten. Wieder war ich gezwungen, der Jagd zu folgen, und wieder verschwand alles bei der den Trümmerplatz umgebenden Planke. Ich glaubte jedoch, deutlich gesehen zu haben, dass die verfolgte Frau die Tür aufriss und den Bauplatz betrat.
»Haben Sie heute wieder nichts gesehen?«, schrie ich den Nachtwächter an. Der Mann zog sich ängstlich vor mir zurück und erklärte, er habe nichts gesehen.
»Ich weiß aber, dass sie hier hereingekommen ist. Sie müssen eine Frau gesehen haben.«
Als der Nachtwächter dabei beharrte, keine Frau und überhaupt keinen anderen erblickt zu haben, stieß ich ihn beiseite und begann zu suchen. Ohne mir darüber Rechenschaft abzulegen, warum ich eigentlich so darauf erpicht war, der Sache auf den Grund zu gehen, kletterte ich alle Trümmerhaufen ab, untersuchte alle Mauerreste und glaubte hundertmal, in den tiefen Schatten eine Frau in einem langen, grauen, nonnenartigen Kleid zu sehen. Einmal wandte ich mich plötzlich um, weil es mir so vorkam, als würde sie mir im Mondschein mit leisen Schritten dicht hinter mir folgen, sodass ich ihr Atmen hören konnte. Ich öffnete die Kirche mit dem Schlüssel, den ich heute Abend mit einer bestimmten Absicht in der Tasche meines Rocks gelassen hatte. In diesem Augenblick überlegte ich nicht, dass sie doch keinesfalls in die verschlossene Kirche geflüchtet sein konnte. Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass sich kein lebendes Wesen in der Kirche befand, betrat ich die Sakristei und zog meinen Plan hervor. Der Mondschein lag hell und grün auf dem alten Schrank, sodass die Schnörkel wie aus Bronze gearbeitet schienen. Die schönen Schnitzereien sprangen aus einem braungoldenen Grund hervor, und der Übermut der vielen Putten schien in dem Licht lebendig zu werden. Ein Bild über dem Schrank, das ich bei Tage nicht beachtet hatte, fiel mir auf. Es war ein altes Gemälde, das von Weihrauch und Kerzenflammen geschwärzt war. Nur das Gesicht der Heiligen, die es darstellen mochte, trat wie aus dem Schatten der Jahrhunderte hervor. Oder war es nicht das Gesicht einer Heiligen? War es nicht das Porträt einer Frau, die einst in diesen Mauern gelebt hatte? Es schien mir persönlicher und belebter als ein Heiligenbild und im grünen Mondlicht war es mir, als hätte ich dieses Gesicht schon einmal gesehen. Diese dunklen, flammensprühenden Augen brannten sich in meine.
Ich zitterte vor unerklärlicher Furcht. Plötzlich kam mir ein banger Gedanke. Oft hat man das Empfinden, dass Gedanken, die uns plötzlich überkommen, nicht in uns geboren sind, dass sie nicht unser Eigentum sind, sondern irgendwie von außen kommen, als würden sie uns mitgeteilt, genau wie die Gedanken eines Fremden. Dieses Empfinden war so stark, dass ich den Eindruck hatte, der Gedanke sei neben mir ausgesprochen worden, als habe mich jemand gewarnt … – mit einer flüsternden Frauenstimme. Ja, gewarnt, denn der Sinn dieses fremden Gedankens war eine Warnung. Es war, als ob mir jemand zuflüsterte, ich sollte mich hüten, den auf meinem Plan verzeichneten Gang aufzudecken. Ich wollte den Gedanken abschütteln und versuchte, seine Entstehung aus der absonderlichen Stille, aus diesem wie mit Weihrauch gesättigten Schweigen begreiflich zu finden. In dem alten Mauerwerk der Sakristei rieselte es unaufhörlich, beunruhigt durch die Erschütterungen der Arbeit und die Zerstörung der angrenzenden Gebäude. Das Mondlicht schien von diesem Geriesel erfüllt, als bestehe es aus Hörnern eines silbernen Sandes, der durch die Sanduhr der Zeit gleitet. Je mehr ich mich bemühte, meine Aufmerksamkeit mit diesen Beobachtungen der Umgebung zu beschäftigen, desto hartnäckiger kam die Warnung wieder: Ich sollte meinen Plan nicht verfolgen, da ich sonst ein schweres Unglück heraufbeschwören würde. Immer wieder versuchte ich, mich krampfhaft auf die wunderlichen Spiele des Mondlichts zu konzentrieren, doch der fremde Gedanke wurde immer eindringlicher und bohrender. Einen Moment lang war es mir, als lege mir jemand die Hand auf die Schulter und flüstere mir ins Ohr. Und dann spürte ich ganz deutlich, wie ein fremder Wille über den meinen herrschen wollte. Ich sah auf und blickte in die dunklen, flammensprühenden Augen des Bildes über dem Schrank.
Da wurde mir auf einmal schmerzlich bewusst: Vorhin, als die Jagd an mir vorbeiging, hatte ich diese Augen schon gesehen. Es waren die Augen der verfolgten Frau. Obwohl ich nicht furchtsam bin, erschrak ich so sehr, dass mich die Besinnung verließ. Ich schrie nicht auf und lief nicht davon, sondern tat etwas viel Ärgeres. Langsam, mit festem Blick auf die Augen des Bildes, zog ich mich Schritt für Schritt zurück, als gelte es, einer wirklichen Gefahr zu entkommen. Dabei hielt ich den großen Kirchenschlüssel fest in der Hand, so wie man bei einem Überfall das nächstbeste Gerät als Waffe benutzt. Endlich war ich in der Kirche und warf die Tür der Sakristei zu. Es widerhallte unter den in Dunkelheit getauchten Wölbungen. Die Bilder und Statuen schienen ihre Stellungen verändert zu haben und mich mit höhnischen Grimassen zu mustern.
Rasch verließ ich die Kirche.
Ich war die ganze Nacht über bis in den Morgen hinein schlaflos. Obwohl ich erst in der Dämmerung einschlief, erwachte ich dennoch bald, denn ich wollte sofort mit der Arbeit in der Sakristei beginnen. Trotz der nächtlichen Warnung war ich entschlossen, den Gang aufzudecken. Meine Furcht war am Tage keine Macht, die mich bestimmen konnte.
Als ich den Bauplatz betrat, fand ich dort bereits den Archivar vor, der von derselben Ungeduld angetrieben worden war wie ich. Ich wählte einige geschickte Arbeiter aus und wies sie an, wie sie den ungeheuren Schrank von seiner Stelle rücken sollten. Das Bild über dem Schrank, das ich mit einigem Bangen betrachtete, war ein gewöhnliches Dutzendgemälde, das unter einer dichten Schmutzkruste verborgen war. Man konnte wenig mehr als einen bleichen Fleck erkennen, der das Gesicht der dargestellten Heiligen darstellte. Es war nicht unheimlich. Ich wollte gerade den Archivar um seine Meinung über das Bild befragen, als er mich ansprach.
»Hören Sie«, sagte er, »es muss recht hübsch in diesem Nonnenkloster zugegangen sein. Gestern Abend nahm ich noch die Chronik vor, und ich denke, dass uns dieser Gang einige interessante Dinge verraten wird. Ich glaube, ich habe Ihnen bereits einige Andeutungen darüber gemacht, was die Chronik über dieses Kloster berichtet. Gestern habe ich sie mir noch einmal durchgelesen, in der Hoffnung, einen Anhaltspunkt für unsere Forschungen zu finden. Die Scheu der Nonnen, ihr Kloster in Verruf zu bringen, war hier einer wüsten Schamlosigkeit gewichen. Sie gaben sich ganz offen den schlimmsten Ausschweifungen hin. Die Chronik berichtet, dass Gläserklirren und freches Gelächter oft genug die ganze Nacht hindurch die Nachbarschaft empörten. Es muss eine Art von Wahnsinn gewesen sein, eine Raserei, die das ganze Kloster erfasst hatte und die Nonnen zu den wildesten Orgien anstachelte. Oft genug sahen die Bürger auch die Kirche selbst erleuchtet und hörten den Lärm, der verriet, dass das Gotteshaus zur Stätte des Gelages erkoren worden war. Als Teilnehmer an diesen Orgien wurden die Geistlichen der Stadt herangezogen. Wenn sie anfangs nur bei Nacht und heimlich Einlass ins Kloster fanden, so kamen sie später ganz offen auch am hellen Tage. Oft sah man die Männer wankend und mit gedunsenen Gesichtern das Haus verlassen und betrunkene Nonnen in den Höfen und im Klostergarten herumtaumeln. Den frommen Bürgern, denen dieses Treiben zuwider war, ist es nicht zu verdenken, dass sie Anzeige beim Bischof erstatteten. Der Bischof kam selbst zur Untersuchung herbei, fand jedoch nichts als eine Schar frommer Nonnen, die in diesem Kloster ein dem Gebet geweihtes, beschauliches Leben führten, wie es sich für Bräute Christi schickt. Eine Umfrage bei der Geistlichkeit der Stadt ergab nur die Bestätigung dieser Beobachtung. Die verleumderischen Anzeiger wurden vor Gericht gestellt und unter dem Druck der bischöflichen Autorität zu harten Strafen verurteilt. Nachdem der Bischof der Stadt den Rücken gekehrt hatte, begann das unverschämte Treiben von Neuem. Doch niemand wagte es mehr, eine Anzeige zu machen, aus Furcht, selbst bestraft zu werden. Unter all den lasterhaften Nonnen war Schwester Agathe die schlimmste. Ihr genügten die im Kloster veranstalteten Orgien bald nicht mehr. Sie muss ein ganz seltsames Weib gewesen sein, von einer entsetzlichen, teuflischen Brunst, die alles an sich riss und vernichtete. Sie muss die Unersättlichkeit eines Raubtieres besessen haben, denn die Chronik erzählt, dass sie oft auf heimlichen Wegen das Kloster verließ und sich nachts in der Stadt herumtrieb. In den Frauenhäusern und Spelunken der Vorstädte war sie zu Gast, saß unter dem Gesindel, unter Spielern und Trunkenbolden, als ob sie zu ihnen gehörte. Dabei war sie von adliger Geburt und stammte aus einer der vornehmsten Familien des Landes. Alle Laster ihres Geschlechts, die über Generationen sorgsam verhehlt worden waren, waren in ihr in widerlicher Erscheinung getreten. Wenn ihr ein junger Mann gefiel, umklammerte sie ihn und ließ ihn nicht mehr frei. Wüst und wild wie eine Bacchantin riss sie ihn zu sich herab. Bald kannte man sie in der ganzen Stadt und sprach von ihr wie von einem Alpdrücken, einem Gespenst. Man nannte sie nur die arge Nonn’. Nun geschah es, dass die Luftseuche in die Stadt verschleppt wurde. Auch Agathe wurde von ihr ergriffen, aber sie war nicht imstande, ihren Trieben Einhalt zu gebieten, und setzte ihr Leben fort. Nach wie vor tanzte sie in den Schenken, saß unter dem Gesindel und fiel wie ein Vampir junge Männer auf der Straße an.
»Was haben Sie!«, unterbrach sich Doktor Holzbock, »Sie sehen so krank aus.«
Ich wehrte ab und bat ihn, einen Augenblick mit seiner Erzählung einzuhalten, um den Fortschritt der Arbeiten zu prüfen. Rings um den Schrank war der Fußboden aufgerissen und an den Wänden war der Mörtel abgekratzt. Es war jedoch nicht gelungen, den Schrank auch nur um eine Linie zu verrücken.
»Ich glaube halt«, sagte der Polier, »der Kasten ist in der Wand verankert.«
Es konnte nicht anders sein. Dann musste man ihn gleich damals mit der Wand verbunden haben, als man die Sakristei anbaute. Dann war entweder unser Plan eine Mystifikation oder …
Wir sahen uns an und der Archivar sprach meine Gedanken aus: »Der Weg führt durch den Schrank hindurch.«
Ich war aufgeregt, außer mir vor Ungeduld über den neuen Aufenthalt, und wütend über so viele Hindernisse.
»Aber wie sollen wir herausfinden, wo man hindurchging? Wir müssten den ganzen Kasten in Stücke brechen, aber das dürfen wir nicht, da er zum Kircheninventar gehört. Was sollen wir tun?«
Der Archivar war fast ebenso ungeduldig wie ich.
Während Doktor Holzbock nachdachte, suchte ich den ganzen Kasten ab, drückte auf alle vorspringenden Ornamente, zog alle Schubfächer auf, die nicht versperrt waren, und maß alle Dimensionen ab, in der Hoffnung, aus irgendeinem seltsamen Verhältnis auf verborgene Türen schließen zu können.
»Geben Sie sich keine Mühe«, sagte der Archivar, »dieser Kasten, der ganzen Generationen von Neugierigen sein Geheimnis vorenthalten hat, wird es uns nicht ohne Weiteres verraten. Wir müssen in den Archiven suchen, vielleicht …«
Ich hörte nicht weiter zu, denn während ich die Höhe des Kastens abschätzte, fiel mein Blick auf das darüber hängende Bild. Und plötzlich war es mir, als würde mir dieses Bild den Schlüssel geben müssen. Zur Verwunderung des Archivars befahl ich, eine Leiter an den Schrank zu legen, und kletterte hinauf. In so großer Nähe zu dem blassen Gesicht, Auge in Auge mit ihm, wollte das Grauen der Nacht wieder über mich kommen. Aber ich bezwang mich und begann, das Porträt zu untersuchen. Die dicke Schmutzschicht ließ selbst in dieser Nähe kaum mehr erkennen, als dass die Dargestellte ein nonnenartiges Gewand trug, während der Kopf von Bändern oder Hauben frei war und von Haaren umringelt schien. Seltsam genug waren diese Haare; sie wirkten wie durcheinandergewirrte Schlangen, wie man wohl den Kopf einer Medusa malen mochte. Doch der schlechte Zustand des Gemäldes ließ kein sicheres Urteil zu. Um den Hals trug sie an einer Schnur einen Schmuck. Es war kein Kreuz, wie man es sonst bei Nonnen finden mag, sondern eine Art Brosche, eine bloße Verzierung, ein Ornament. Es sah aus wie eine Lilie, die in ein Polygon eingeschlossen war. Mir kam es so vor, als hätte ich dieses Ornament auch unten auf dem Kasten gesehen, die Lilie bald in einem Sechseck, bald in einem Rhombus und dann wieder in einem Fünfeck wie hier.
»Doktor«, rief ich, während ich die Leiter hinabstieg, »ich glaube, ich bin dem Rätsel auf der Spur.«
»Und die Spur haben Sie da oben auf dem Bild gefunden?«
»Ich glaube es. Die Lilie im Fünfeck ist der Schlüssel. Suchen wir.«
Obwohl ich ganz genau wusste, das Ornament gesehen zu haben, war ich dennoch so verwirrt, dass ich es nicht sofort wiederfand. Wie in einem Nebel verschwammen mir die Bestandteile des Schrankes, und vergeblich kämpfte ich gegen die Müdigkeit an, die ich mir in diesem entscheidenden Moment nicht erklären konnte. Es war ungefähr so, wie es einem Erfrierenden zumute sein muss.
Da rief der Archivar neben mir aus: »Hier ist eine Lilie im Fünfeck. Und was nun!«
Plötzlich war meine Spannkraft wieder zurückgekehrt, als stünde ich nun vor dem Unabwendbaren, wo kein Zweifel über den Ausgang mehr besteht. Ich untersuchte die Lilie, während uns die Arbeiter neugierig umstanden. Es war, als gebe das Holz unter meiner Hand nach. Ich drückte mit aller Kraft, da ging ein Ächzen durch den alten Schrank, ein tief aus dem Innersten kommendes Ächzen. Ein schmaler Spalt zerschnitt den Schrank von oben bis unten. Wir stemmten die Schultern an, aber die rostigen, jahrhundertelang nicht gebrauchten Angeln gaben nur widerwillig nach. Wir mussten die Tür ruckweise öffnen und hatten so Zeit, den sinnreichen Geheimmechanismus zu bewundern. Äußerlich folgte auch dieser Teil des Schrankes der Breitegliederung. Beim Druck auf die Lilie aber vereinigten sich die scheinbar getrennten Flächen zu einer Tür. Im selben Maße, in dem sich diese öffnete, schoben sich die Fächer des Schrankes nach links und rechts auseinander, sodass wir vor der Hinterwand des Kastens standen. Hier war es nicht schwer, den Knopf zu finden, den wir drücken mussten, um auch diese Tür zu öffnen.
Dahinter lag die dunkle Mündung eines Ganges. Ich wollte mich hineinstürzen, doch der Archivar hielt mich zurück.
»Geduld, wir müssen erst erproben, ob die Luft da drinnen atembar ist.«
Er band eine Kerze an einen Stock, zündete sie an und hielt sie in den Gang. Sie brannte mit einer wilden Flamme und das geschmolzene Stearin fiel in großen Tropfen in die Dunkelheit.
Wir betraten den Gang.
Einige Stufen hinab, dann geradeaus, dann wieder einige Stufen hinab und geradeaus.
»Ich glaube, wir befinden uns auf dem geheimen Weg der argen Nonn’«, flüsterte der Archivar. Er glaubte es nur, ich war dessen gewiss. Obwohl die Luft hier frisch war, war mir doch sehr beklommen zumute.
»Marandjosef«, sagte plötzlich der Arbeiter, der mit der Kerze voranging, und blieb stehen. Die Wände sprangen hier in die Dunkelheit zurück und der Gang mündete in eine Art Gruft, in deren Mitte auf Holzgestellen vier hölzerne Särge standen. Ganz einfache, schmucklose Särge, deren Form und Zuschnitt gleichwohl um einige Jahrhunderte zurückwies. Der Archivar hob einen der Deckel ab. Darin lag eine Nonne mit einem mumienartig eingetrockneten Gesicht. Sie hatte die Hände über der Brust gekreuzt. Ihre Kleider waren zerfallen, sodass an manchen Stellen das Fleisch, das der Verwesung widerstanden hatte, durch die Löcher sichtbar wurde.
Wir hoben auch von den übrigen Särgen die Deckel ab. Im vierten Sarg lag Agathe, die arme Nonne. Ich erkannte sie sofort: Es war das Weib, das nachts, von einer Schar wütender Männer verfolgt, an meinem Haus vorbeigelaufen war; es war das Urbild des Gemäldes in der Sakristei.
Da sagte der Archivar neben mir: »Wissen Sie auch, dass unter diesen Leichen möglicherweise Schwester Agathe, die arge Nonn’, sein dürfte?«
»Ich weiß es, diese dort ist es. Ich erkenne sie wieder. Sehen Sie nur, wie viel besser sie aussieht als die anderen. Man merkt, dass die anderen wirkliche Leichname sind, diese aber …«
Doktor Holzbock fasste meine Hand und sagte: »Wir wollen versuchen, bald wieder aus diesem Gang herauszukommen. Die Luft hier unten scheint doch gefährlich zu sein. Vorwärts!«
Es ging nicht mehr weit vorwärts. Nach dreißig Schritten mussten wir Halt machen. Ein Teil der Decke war hier eingestürzt und hatte den Gang verschüttet. Nach meiner Berechnung befanden wir uns unter der Straße. Ich sah, dass der Einsturz erst vor Kurzem erfolgt sein musste, wahrscheinlich infolge der Erschütterung durch die schwer beladenen Lastwagen, die den Schutt des alten Gebäudes wegschafften. Da die Gefahr bestand, dass noch andere Teile nachstürzen könnten, gab ich den Auftrag, augenblicklich einen Schacht von der Straße aus durchzustoßen, alles genau zu untersuchen und alle Vorkehrungen zu treffen, um einen Unglücksfall zu verhüten. Dann kehrten wir durch die Gruft zurück. Im Vorbeigehen überzeugte ich mich davon, dass meine Beobachtungen richtig gewesen waren. Sie sah wirklich anders aus als die drei anderen. Fast, als ob sie noch lebte. Ihre Haut war noch gespannt, hatte einen Hauch von Farbe und ihre glatte Stirn leuchtete. Sie war noch immer schön und im Kerzenlicht schien es mir, als blinzele sie unter den Augenlidern hervor und verfolge unser Tun mit listigen, verstohlenen Blicken.
Als wir in der Sakristei ankamen, musste ich mich setzen. Ich war atemlos, und meine Beine zitterten.
»Ich muss Ihnen erklären«, sagte der Archivar, »wie ich zu der Behauptung komme, dass eine der Mumien dort unten Schwester Agathe ist. Meine Chronik gibt die Erklärung dafür in der Fortsetzung der Geschichte dieses Klosters. Die Seuche, deren Priesterin Agathe war, griff um sich, und schließlich brach eine furchtbare Empörung der Bürgerschaft aus.
Man lauerte der Nonne auf und wollte sie erschlagen. Aber es war, als ob die Gefahr ihre Lust nach Abenteuern noch gesteigert hätte. Sie trieb es noch toller als vorher, und es ist seltsam, dass sie eine Menge Beschützer fand, junge Männer, die sie liebten, obwohl sie wussten, dass sie von ihr vergiftet wurden. Wie ich schon sagte, muss sie ein fürchterliches Weib gewesen sein. Ihre Nacht über die Leiber war schrankenlos. Eines Tages zog jedoch ein bewaffneter Haufen vor das Kloster und verlangte die Auslieferung der Schwester Agathe. Die Wut des Volkes war aufs Äußerste gestiegen und man drohte, das Kloster zu stürmen und anzuzünden, wenn die arge Nonn’ nicht herausgegeben würde. Da sah sich die Äbtissin gezwungen, mit den Aufrührern zu verhandeln. Sie versprach, Agathe zu bestrafen, und erbat sich eine Frist von drei Tagen. Den Besonneneren unter den Stürmern gelang es, die Annahme dieses Angebots durchzusetzen. Nachdem die drei Tage abgelaufen waren, erschien der Haufen wieder vor dem Kloster und erfuhr von der Äbtissin, dass Schwester Agathe plötzlich erkrankt und gestorben sei. Die Chronik lässt offen, ob die Äbtissin wirklich von einem Zufall profitierte oder ob man, um die Bürger zu beruhigen, einen Mord beging. Die Zeiten waren danach angetan, dass man Letzteres mit ebenso viel Wahrscheinlichkeit annehmen kann wie Ersteres. Aber die erhoffte Beruhigung trat nicht ein. Obwohl ein Begräbnis stattgefunden hatte, ein Sarg in die Erde versenkt worden war und man sich davon überzeugen konnte, dass ein Stein mit dem Namen der Nonne auf diesem Grab errichtet worden war, tauchten Gerüchte auf, Schwester Agathe lebe noch. So etwas kam früher häufig vor, wenn man an den Tod sehr verruchter oder sehr geliebter Personen nicht glauben konnte. So war es auch mit ihr. Man wollte die Nonne hier und da noch gesehen haben. Man berichtete von ihren Streifzügen, bei denen sie junge Männer überfiel. Schließlich war man davon überzeugt, dass die Äbtissin eine Komödie gespielt habe, um die drohende Gefahr abzuwenden. Andere, die den Tod der Schwester Agathe für real hielten, waren der Meinung, dass es eine Entweihung der heiligen Friedhofserde sei, ihren Leichnam neben die Körper braver und frommer Bürger zu betten. Gläubige und Misstrauische vereinigten sich in dem Verlangen, das Grab zu öffnen, um sich zu überzeugen, dass die Nonne darin liege. Es muss ein furchtbarer Hass gewesen sein, der diese Frau verfolgte. Als man im Kloster von der Absicht der Wütenden erfuhr, nahm man nachts den Leichnam aus dem Grab und brachte ihn ins Kloster zurück. In meiner Chronik wird die ganze Geschichte so geschildert, als habe es sich um einen ernsthaften Aufstand gehandelt, der die Bürger fortriss, erneut vor das Kloster zu ziehen, als sie das Grab leer vorfanden. Von einem Fenster aus zeigte man ihnen den Leichnam der Nonne. Steine und Holzstücke flogen gegen die Tote, ein Schuss wurde auf sie abgegeben. Die Chronik fügt hinzu, dass unter den Empörten die jungen Männer am empörtesten waren, die sie geliebt hatten, als sie noch lebte. Da man im Kloster erkannte, dass Schwester Agathe auch durch den Tod nicht vor dem Hass ihrer Verfolger geschützt war, behielt man den Leichnam und setzte ihn in einer Gruft bei, in der man sonst Nonnen begrub, die aus irgendeinem Grund getötet worden waren. Diese Gruft haben wir heute gefunden. Sie liegt auf dem Weg, auf dem sie sonst zu ihren Abenteuern ausging.
»So ist es«, sagte ich.
»Und nun müssen Sie mir sagen, wie Sie auf den Gedanken kamen, dass wir die arme Nonne gefunden haben. Sie hatten ja noch nicht das Ende meiner Geschichte gehört. Und wie Sie gerade eine der Mumien als Schwester Agathe bezeichnen konnten! Und was brachte Sie dazu, gerade jenes Bild dort um ein Zeichen zu befragen, wie wir weiterkommen sollten?«
Was sollte ich dem Archivar sagen? Konnte ich ihm von meinen nächtlichen Erscheinungen erzählen? Ich versuchte, ihn durch eine Gegenfrage auf die richtige Spur zu bringen. »Haben Sie nicht eine Ähnlichkeit zwischen diesem Bild und der Toten dort unten gefunden?«
»Nein«, sagte Doktor Holzbock und betrachtete das Bild, das nun im hellen Vormittagssonnenschein deutlich sichtbar war. »Übrigens müsste man es ganz in der Nähe betrachten.« Und er legte die Leiter an, die noch von vorher in der Ecke lehnte. Doch er war nicht imstande, das Bild von der Wand herab zunehmen. Ich weigerte mich, ihm zu helfen. Ich rief zwei Arbeiter zu seiner Unterstützung herein und verließ ihn, denn ich konnte mich des abergläubischen Gedankens nicht erwehren, dass dieses Bild besser an der Wand bleiben sollte. Wieder gewannen die Erscheinungen meiner Nächte auch am hellen Tage in solcher Weise über mich Gewalt. Ich sah mich in eine sehr absonderliche Geschichte verstrickt und ich fühlte mit Grauen, dass ich mich nicht befreien konnte. Es lag wie Schlingen um mich. Als ich im hellen Sonnenschein im Staub und Lärm der Arbeit draußen stand, fasste ich den Entschluss, mich morgen krankzumelden und einen Urlaub anzutreten, unbekümmert darum, was nach mir geschah. Aber vorher wollte ich noch diese Nacht meine Beobachtungen zu Ende bringen, denn ich war überzeugt, dass eine Art Entscheidung fallen musste.
Nach einer Viertelstunde kamen der Archivar und seine beiden Arbeiter und erklärten, dass es auf keine Weise gelungen sei, das Bild von der Wand herabzubringen, ohne den Rahmen zu zerbrechen oder die Leinwand herauszuschneiden.
»Zucken Sie nicht mit den Achseln«, sagte er, »Sie tun, als ob Sie mehr von all diesen merkwürdigen, geheimnisvollen Dingen wüssten als meine Chronik. Sie werden mir noch Ihre Ansicht über all das sagen müssen, denn ich beabsichtige, über unsere Funde einen Aufsatz für die Blätter des Geschichtsvereins zu schreiben.«
Damit ging er und hinterließ mir den Eindruck eines sehr braven, gelehrten und von romantischen Neigungen nicht sehr geplagten Mannes.
Dieser Tag kam mir endlos vor. Alle Stunden hatten graue Gesichter und schlichen wie gelangweilte, träge Schatten an mir vorüber. Als der Abend kam, merkte meine Frau meine Aufregung und ich konnte sie nur beruhigen, indem ich ihr versprach, mich am nächsten Tag der Arbeit zu entziehen. Es wurde elf Uhr, und noch immer brannte das Licht am Bett meiner Frau. Gerade heute schien sie nicht einschlafen zu können, und ich war außer mir vor Angst, dass mein Vorhaben vereitelt werden könnte. Es ging schon gegen zwölf, als sie sich noch einmal über mich beugte. Da ich tat, als schliefe ich, löschte sie mit einem Seufzer das Licht aus. Zwei Minuten später war sie nicht mehr imstande, zu hören, wie ich mich leise erhob und das Zimmer verließ. Gerade als ich vor die Haustür trat, schlug es auf dem Turm der alten Klosterkirche zwölf Uhr. Ich hörte einen Schrei, dann das Geräusch laufender Menschen. Nun flog Agathe an mir vorbei – ich sah ihre furchtbaren, glimmenden Augen – dann kam die Meute der Verfolger.
Ich raste hinterdrein.
Es war wieder dasselbe traumhafte Gleiten und Schweben, in dem mir die Häuser links und rechts wie steile Wände erschienen, die unseren Lauf bestimmten. Nur zweierlei sah ich mit voller Deutlichkeit. Zum einen die Gruppe der Verfolger vor mir und zum anderen den Nachthimmel über uns, der von vielen einzelnen weißen Wolkenschollen bedeckt war wie ein Fluss mit Eisschollen zur Zeit der Schneeschmelze. In den Spalten und Rissen der Wolkenschollen tauchte von Zeit zu Zeit die Mondsichel auf – wie ein Boot auf dem dunklen, abgründigen Wasser des Himmels.
Nun ging die Jagd neben der Planke des Trümmerplatzes weiter und plötzlich verschwanden die Gestalten vor mir. Es war jedoch kein unschlüssiges Hin- und Herlaufen der Verfolger, wie sonst, sondern sie schienen wie von einem Trichter verschlungen zu werden. Es war, als wirbelten sie durcheinander und empor wie eine Rauchsäule, um dann von der Erde eingesogen zu werden. Da stand ich auch schon vor dem Schacht, der auf meinen Befehl hin im Laufe des Tages gegraben worden war. Die ausgehobene Erde lag um seine Mündung, einige Bretter und zwei rote Laternen warnten die Vorübergehenden. Doch die Bretter, die die Öffnung zur Gruft verschlossen, waren zur Seite geworfen. Ich riss die Tür des Zauns auf und lief, ohne erst den Nachtwächter zu suchen, der sich möglicherweise an einem anderen Ort des ausgedehnten Platzes befand, zwischen den Schutthaufen hindurch dem großen Hof zu, der noch durch die Überreste der umgebenden Gebäude erkennbar war. Ich weiß nicht, welche Stimme mir sagte, dass ich hier sein müsse; es war ein Zwang, dem ich mich nicht entziehen konnte. Kaum hatte ich ein Versteck hinter dem Überrest eines großen Laubenbogens gefunden, sah ich den Hof schon von Gestalten erfüllt.
Was ich nun erblickte, ist fast unmöglich zu beschreiben. Es war wie im Traum, und doch war alles vollkommen deutlich. Die Gestalten kamen von der Kirche her, die ich im Mondlicht vor mir sah. Ob sie durch die weit geöffnete Tür kamen oder aus den Wänden quollen, vermag ich nicht zu sagen. Es schien mir nur so, als wären es so viele, dass sie nicht auf einmal durch die Tür hätten kommen können. Am seltsamsten war jedoch, dass ich sie alle in lebhaftester Bewegung sah, in einem Durcheinander von Gebärden. Ich sah, wie sie aufeinander einschrien, sich zuriefen, sich zur Seite stießen und sich unter wilden Gestikulationen vordrängten. Dabei vernahm ich nur das Geräusch vieler Schritte. Keines der Worte, die ich noch sprechen sah, wurde laut, keiner der Rufe drang bis zu mir. Ich hatte den Eindruck, als sähe ich die Vorgänge auf einer Bühne, von der ich durch eine dicke, für den Schall undurchlässige Glaswand getrennt war, sodass ich die Handlung bloß sehen, aber keinen Ton hören konnte. Dieser Eindruck wurde dadurch verstärkt, dass die Akteure dieser aufgeregten Szene im Kostüm erschienen. Sie trugen zumeist das behagliche und bequeme Bürgergewand des 16. Jahrhunderts. Einige von ihnen waren jedoch lockerer wie Studenten oder ernster und feierlicher wie Ratsherren gekleidet.
Es gibt ein gewisses Maß des Entsetzens, bei dem alle Besorgnis um das eigene Ich verschwunden ist und man nur noch durch die Augen lebt, während alle anderen Sinne gleichsam ausgeschaltet scheinen. Dieses Maß hatte ich erreicht und kann mich dafür verbürgen, dass sich alles, was ich sah, auch wirklich zutrug. Der ganze Hof war von Gestalten erfüllt, und einige Male kamen Einzelne von ihnen so nahe an meinem Versteck vorbei, dass ich ihr starres Gesicht deutlich erkennen konnte. Nach einer Weile des aufgeregten Durcheinanderlaufens richtete sich die Aufmerksamkeit aller auf das offene Tor der Kirche. Aus ihm kam eine Gruppe von Männern hervor, in deren Mitte ein Weib geführt wurde. Man stieß sie mit Fäusten vorwärts, schlug ihr ins Gesicht und zerrte an dem Strick, der um ihren Hals gelegt war. Ich sah, wie sie mit den Schultern zuckte, als ob sie bloß ein lästiges Insekt abwehren wollte. Einer der Studenten drängte die anderen zurück, stürzte vor, schien ihr eine Beschimpfung zuzurufen und schlug sie mit der Breite des blanken Raufdegens zweimal über den Kopf. Da hob das Weib die glatte, weiße Stirn und sah den Mann mit dunklen, flammensprühenden Augen an. Es war Schwester Agathe, die arge Nonn’. Unter unaufhörlichen Schlägen und Fußtritten wurde sie bis in die Mitte des Hofes gezogen, wo eine Gruppe schwarz gekleideter Ratsherren stand. Hochaufgerichtet sah ich ihre Gestalt im blassen, ängstlichen Mondlicht vor einer Gruppe von Männern, in der der gemeinsame Hass der ganzen wütenden Menge verkörpert schien. Das weiße Tuch war vom Kopf der Nonne zurückgeglitten, sodass sie aussah wie auf dem Bild in der Sakristei. Nun trat einer der Ratsherren vor. Während die Menge von allen Seiten herandrängte, brach er ein weißes Stäbchen über dem Kopf der Nonne und schleuderte es ihr mit einer Gebärde des Abscheus vor die Füße. Da wich das Volk zurück und ließ einen Platz frei, auf dem die Nonne neben einem Block stand. Von dem Block erhob sich ein Mann in einem roten Mantel. Ich sah alle Einzelheiten der schauerlichen Exekution. Ich sah, wie der Mann ein breites, blankes Schwert hervorzog, den roten Mantel abwarf und das Kleid der Nonne öffnete, sodass der weiße Hals und die schönen Schultern sichtbar wurden. Ich sah, wie er sie vor dem Block in die Knie zwang. Ich hätte schreien mögen, doch ich war auch dankbar, dass die dunklen, drohenden Augen endlich von mir abgewendet waren. In den letzten Minuten hatten sie sich starr nach meinem Versteck gerichtet, als hätten sie mich dort erblickt. Nun lag der Kopf auf dem Block, nun sah ich das Richtschwert in hohem Schwung im Mondschein und schließlich sprang ein Blutstrahl auf. Doch er fiel nicht zur Erde, zerstäubte nicht in einzelne Tropfen, sondern blieb in der Luft stehen, als wäre er im Augenblick erstarrt. Währenddessen fiel der Kopf vom Block und rollte, als folge er einem letzten Antrieb der Gerichteten, geraden Wegs auf mich zu. Da schleuderte die Menge ihre Hüte in die Luft und brach in einen ungeheuren Jubel aus. Dessen Gebärden sah ich deutlich, obwohl ich keinen Laut vernahm. Wie in einer plötzlichen Eingebung stürzten sie sich alle auf den Leichnam, stießen, schlugen und zerrten ihn herum, als wäre ihre Wut noch immer nicht ganz befriedigt. Der Kopf rollte derweil weiter, ohne seine Richtung zu verändern, auf mich zu und blieb schließlich dicht vor meinem Versteck liegen. Seine dunklen, flammensprühenden Augen sahen mich an und ich hörte Worte, die ersten während der ganzen schrecklichen Szene. Worte aus dem Mund des Kopfes: »Du sollst der argen Nonn’ gedenken.«
Da verschwand alles vor mir: das Getümmel der Menge, der Kopf, der Henker samt dem Block. Nur die rote Sichel des erstarrten Blutstrahls schwebte einen Augenblick im grünen Mondlicht.
Es bleibt nichts weiter hinzuzufügen, als dass man am nächsten Morgen den Körper der Schwester Agathe in der Gruft in einem schrecklichen Zustand auffand. Er war durch Stöße und Schläge entstellt, alle Glieder waren gebrochen und der Kopf durch einen glatten Schnitt vollkommen vom Rumpf getrennt. Man vermutete einen Fall sexuellen Wahnsinns und stellte die eingehendsten Untersuchungen an, in deren Verlauf auch ich vernommen wurde. Aber die Nachforschungen der Behörden ergaben kein Resultat, denn ich hütete mich wohl, zu erzählen, was ich nachts gesehen hatte.
*
Ein fürchterliches Verbrechen versetzte am Morgen des 17. Juli 19… die ganze Stadt in Aufregung. Als das beim Ingenieur und Baumeister Hans Anders beschäftigte Mädchen nach mehrfachem vergeblichen Klopfen an der Schlafzimmertür ihrer Herrschaft gegen zehn Uhr vormittags noch einmal an der Tür rüttelte, fand sie, dass diese unversperrt war, und betrat das Schlafzimmer. Die junge Frau lag in ihrem Bett, inmitten einer Blutlache; von dem Herrn war nichts zu sehen. Schreiend lief das Mädchen davon und bekam einen Weinkrampf. Als man ihr schließlich mühsam das Geheimnis entlockt hatte, schickte der junge Student aus dem dritten Stock, der Besonnenste unter den aufgeregten und entsetzten Hausgenossen, sofort die Rettungsgesellschaft und die Polizei. Die Kommission erschien und stellte fest, dass ein Verbrechen vorlag. Die junge Frau war schon seit mehreren Stunden tot. Ihr Kopf war durch einen mit ungeheurer Kraft geführten Schnitt glatt vom Rumpf getrennt worden. In der Wohnung war sonst alles in Ordnung, nur eines der Bilder im Schlafzimmer war von der Wand genommen und vollständig zertrümmert worden. Der Rahmen war in kleine Stücke zerschlagen und die Leinwand in Fetzen zerrissen. Es gab keine Spur, die auf das Eindringen eines Mörders von außen deutete. Das Dienstmädchen bestätigte, dass die Herrschaften gestern Abend wie sonst zu Bett gegangen seien. Als man sie fragte, ob sie vielleicht in der letzten Zeit Zwistigkeiten zwischen Anders und seiner Frau bemerkt habe, sank sie einen Augenblick in sich und erklärte dann, dass ihr nichts aufgefallen sei außer einer zunehmenden Schweigsamkeit beider und manchmal ein nervöses Zittern der Frau. Trotz dieser Aussage blieb nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass Frau Anders aus bisher nicht erkennbaren Gründen von ihrem Mann ermordet worden war und dieser dann entkommen war. Die Beobachtungen der Hausbewohner stimmten mit denen des Dienstmädchens überein. Aus all diesen Angaben ließ sich jedoch kein Schluss auf ein ernstes Zerwürfnis ziehen, aus dem eine solche furchtbare Tat hätte folgen können. Der Gerichtsarzt erklärte jedoch, dass man sich durch den Mangel an äußerlichen Anzeichen eines Zwistes nicht täuschen lassen dürfe, da gerade bei Menschen von hoher Kultur, wie Hans Anders und seine Frau, solche Katastrophen geräuschlos und nach innen abspielten. Dadurch bestärkte er nur die Ansicht des Polizeikommissars, der sofort die eifrigsten Nachforschungen nach dem Gatten der Ermordeten anordnete.
Man fand Hans Anders nachmittags auf einer Bank im Stadtpark. Er saß mit bloßem Kopf da, Hut und Spazierstock lagen neben ihm, und er war gerade dabei, eine Zigarette zu drehen. Ohne Widerstand folgte er der Aufforderung des Wachmanns, er habe selbst schon daran gedacht, auf die Polizei zu gehen und eine Aussage zu dem Vorfall zu machen. Lächelnd und in bester Laune betrat er das Amtszimmer des Polizeikommissars und bat ihn um einen Augenblick Gehör. Er wolle ihm mitteilen, warum er seiner Frau den Kopf abgeschnitten habe.
Entsetzt starrte ihn der Kommissar an: »Sie geben also zu, Ihre Frau ermordet zu haben?«
Anders lächelte: »Meine Frau? Nein!«
Und nun gab er eine so seltsame und unverständliche Erklärung ab, dass weder der Kommissar noch der Untersuchungsrichter, dem der Fall noch am selben Abend übergeben wurde, etwas davon verstehen konnten. Nur so viel konnte man entnehmen: Hans Anders gab zu, der Frau mit dem türkischen Handschar aus seiner Waffensammlung den Kopf abgeschnitten zu haben. Er behauptete jedoch, dass diese Frau nicht seine Frau gewesen sei. Als er sah, dass man ihn nicht verstand, berief er sich auf seinen Bekannten, den Archivar Doktor Holzbock, der alles bestätigen werde. Bevor man den Archivar jedoch vorgeladen hatte, erschien dieser freiwillig vor dem Untersuchungsrichter und gab folgende Aussage ab:
»Ich erachte es als meine Pflicht, durch meine Angaben etwas Licht in die furchtbare Geschichte des Hans Anders zu bringen, soweit sich in eine so geheimnisvolle und höchst sonderbare Angelegenheit eben Licht bringen lässt. Seit langer Zeit mit ihm bekannt, fand ich mich fast täglich auf dem Trümmerfeld der ehemaligen Jesuitenkaserne ein, wo Anders die Abrissarbeiten leitete. Meine historischen und archäologischen Arbeiten sind Ihnen ja bekannt, und ich hoffte, auch bei der Abtragung des mehrere Jahrhunderte alten Bauwerks wieder einiges Interessantes zu entdecken. Gewisse Anzeichen brachten mich auf die Spur eines geheimen Ganges und Anders, dessen Tüchtigkeit als Baumeister außer Frage steht, folgte dieser Spur mit so viel Scharfsinn und Glück, dass es uns gelang, eine alte Gruft mit einigen mumifizierten Leichen zu entdecken. Sie werden sich erinnern, dass man eine dieser Leichen am Tag nach der Auffindung der Gruft in einem Zustand antraf, der auf ein Verbrechen schließen ließ. Die Untersuchung hat damals aber bekanntlich kein Resultat ergeben. Einige Tage später kam Hans Anders zu mir. Ich muss vorausschicken, dass mir schon in der letzten Zeit sein verändertes Wesen aufgefallen war: Er war unruhig, ganz gegen seine sonstige energische und doch liebenswürdige Art, manchmal wie geistesabwesend, dann wieder mürrisch auffahrend; manchmal zitterte er, als ob er von einer schrecklichen Angst gefoltert würde. Dieser Zustand fiel mir bei diesem Besuch ganz besonders auf. Als ich ihn fragte, was ihm fehle, gab er mir eine ausweichende Antwort. Nach einer Weile, als er seine Unruhe nicht länger zu bemeistern vermochte, begann er: ›Heute ist mir ihr Bild ins Haus geschickt worden.‹
›Welches Bild?‹
›Das Porträt der Schwester Agathe, der argen Nonn’. Was Ihnen nicht einfällt! Es hängt in der Sakristei fest, so fest, dass man es nicht von der Wand nehmen kann. Nicht wahr?‹, sagte er. ›Ihnen ist es nicht gelungen, das Bild herab zu nehmen! Aber ich schwöre Ihnen, dass es jetzt in meiner Wohnung hängt.‹
›Wer hat es denn in Ihr Haus gebracht?‹
›Ich weiß es nicht, es kam in meiner Abwesenheit. Ein fremder Mann brachte es, hängte es an die Wand und ging wieder, ohne zu sagen, wer ihn geschickt habe.‹
›Aber es muss doch auszuforschen sein, wer ihn beauftragt hat, Ihnen das Bild zu bringen!‹
›Das ist es eben, ich kann das nicht feststellen. Ich ging schließlich zum Pfarrer, aber auch der wusste nichts davon. Als ich ihn fragte, ob er keine Ansprüche darauf erhebe, da das Bild doch zum Kircheninventar gehöre, entgegnete er, er sei froh, das Bild los zu sein, und er habe sich schon längst vorgenommen, es zu entfernen. Das Furchtbare ist aber, dass ich das Porträt nicht einmal zurückstellen könnte, selbst wenn ich wollte.‹
›Warum?‹
›Weil es jetzt an meiner Wand ebenso fest hängt wie früher in der Sakristei. Es ist unbegreiflich, aber dennoch unbestreitbar. Ich bitte Sie, mich zu besuchen, um sich davon zu überzeugen, dass ich die Wahrheit spreche.‹
Ich muss gestehen, dass mir diese Mitteilung des Baumeisters recht sonderbar vorkam, denn das Bild, um das es sich handelte, war nach der Behauptung des Hans Anders das Porträt der Schwester Agathe, einer der Nonnen, deren Mumien wir in der Gruft gefunden hatten. Um den Aufgeregten zu beruhigen, versprach ich ihm, ihn an einem der nächsten Tage zu besuchen. Als ich gegen Ende der Woche zufällig an seiner Wohnung vorbeiging, erinnerte ich mich meines Versprechens. Hans Anders war ausgegangen, aber ich traf seine Frau daheim an.
›Ach, ich freue mich sehr‹, sagte sie, ›dass Sie zu uns kommen. Ich war schon entschlossen, Sie aufzusuchen. Sie sind der einzige Bekannte meines Mannes, mit dem er näher verkehrt. Er hält sehr viel von Ihnen, und ich hoffe, dass Sie etwas Einfluss auf ihn haben werden.‹ Nachdem ich meine Bereitschaft erklärt hatte, ihr zu helfen, begann sie mir unter Tränen zu erzählen, dass ihr Mann krank sein müsse. Er gehe so seltsam verstört herum, spreche tagsüber kaum ein Wort und werfe sich nachts schlaflos im Bett hin und her. Er habe ihr schon vor mehreren Tagen versprochen, sofort Urlaub zu nehmen und abzureisen, denn er sei sichtlich überarbeitet und müde. Aber jetzt sei er nicht dazu zu bewegen, die Stadt zu verlassen. ›Mein Gott‹, sagte sie, ›ich wage es kaum mehr, vom Arzt zu sprechen. Bei diesem Wort fährt er auf und macht mir Vorwürfe, als ob ich ihm irgendeine erniedrigende Handlung zumute.‹ Ich bestätigte Frau Blanka, dass man versuchen müsse, ihren Gatten zu einer Reise zu bewegen. Wenige Augenblicke später kam Anders nach Hause.
Er begrüßte mich sichtlich erfreut und gab auch seiner Frau einen Gruß, aber ich hatte das Gefühl, dass etwas zwischen den beiden Gatten stand. Ein Schatten, ein wesenloses Ding, ein unsichtbarer Einfluss, der auf beide wirkte und sie trennte. Auf Frau Blanka wirkte dieser Einfluss als Angst, auf Anders – ich glaubte zuerst, mich zu irren, aber meine Beobachtung wurde bestätigt – als Abscheu vor seiner Frau. Ein mit Furcht gemischter Abscheu. Das erschien mir höchst seltsam, da ich wusste, dass Anders seine Frau früher ungemein geliebt hatte. Nach einer kurzen, gleichgültigen Unterredung zog sich Frau Blanka zurück, um mir für meine versprochene Einwirkung auf Hans Gelegenheit zu geben. Kaum war sie draußen, fasste mich Anders am Arm und zog mich mit sich ins Schlafzimmer. ›Kommen Sie‹, flüsterte er, ›Sie sollen sie sehen.‹ Über einer Ottomane, den Betten gegenüber, hing das Bild aus der Sakristei. Ein grüner Vorhang hing zurückgezogen neben ihm. Es war ein etwas unheimliches Bild. Das Gesicht schien von wilden Sünden zu erzählen. Und wenn es wirklich die Schwester Agathe darstellen sollte, so entsprach es wohl allem, was eine alte Chronik von dem lästerlichen Treiben dieser Nonne berichtete. Ich ging auf das Bild zu, mit der Absicht, den Versuch zu machen, es herab zu nehmen. Denn ich wollte Anders beweisen, dass seine unsinnigen Einbildungen der Wirklichkeit weichen müssten. Doch da sprang er mit so zorniger Gebärde auf mich zu, dass ich erschrak und zurückgestoßen wurde.
›Was fällt Ihnen ein? Es ist unmöglich. Nun hängt es einmal an der Wand dort, und keine Macht der Welt bringt es von dort weg!‹
Er hatte offenbar vergessen, dass er mich vor wenigen Tagen selbst gebeten hatte, mich in seiner Wohnung von der Richtigkeit seiner Erzählung zu überzeugen.
›Aber warum‹, fragte ich, ›haben Sie das Bild gerade in Ihrem Schlafzimmer anbringen lassen? Dieses Gesicht kann selbst in die friedlichsten Träume Verwirrung bringen.‹
›Ich sagte Ihnen schon‹, antwortete Anders, ›dass ich nicht zu Hause war, als das Bild kam. Der Mann, der es brachte, hängte es, ohne weiter zu fragen, hierher, und ich kann es nun nicht mehr entfernen. Ich habe es versucht, einen Vorhang darüber zu ziehen. Aber‹, und seine Stimme wurde von der Aufregung ganz heiser, ›sie duldet den Vorhang nicht. Wenn ich ihn abends vorziehe, ist er um Mitternacht wieder zurückgezogen. Sie sieht mich immer an, mit diesen entsetzlichen Augen. Ich kann es nicht ertragen. Und wissen Sie, warum sie mich so ansieht? Ich will es Ihnen sagen.‹
Er zog mich von dem Bild fort und flüsterte mir zu, so leise, dass ich ihn kaum verstand: ›Sie hat mir Rache geschworen, und sie hält Wort. Sie plant etwas Furchtbares, und ich glaube zu ahnen, was sie will.‹
Plötzlich unterbrach er sich und stellte eine Frage, die mir damals wie eine mit seinen Gedanken unzusammenhängende Frage erschien.
›Haben Sie meine Frau genau angesehen?‹ Bevor ich antworten konnte, fuhr er schon wieder fort: ›Unsinn! Es ist Unsinn, was ich mir manchmal einbilde.‹ Dann kehrte er zu seinem Gedankengang zurück: ›Sie will mich vernichten, weil ich den unterirdischen Gang aufgedeckt habe, weil ich den Durchstich zur Straße anordnete und ihren Verfolgern dadurch die Möglichkeit gab, in die Gruft zu dringen.‹
Meine Einwände wies er mit einer Handbewegung zurück. Wenn Sie gesehen hätten, was ich gesehen habe, würden Sie mir zustimmen.«
Erst später sollte ich erfahren, was Anders mit diesen dunklen Andeutungen meinte. Die Worte dieser Unterredung prägten sich in mein Gedächtnis ein, und das Gesicht des Baumeisters, das er flüsternd dicht an mein eigenes brachte, werde ich immer vor mir sehen. Aus seinem ganzen Gebaren gewann ich den Eindruck, dass er sehr krank sei, aber mein Zureden, er möge die Stadt verlassen und einige Wochen in die Berge gehen, war umsonst.
›Ich muss aushalten‹, sagte er, ›es wäre vergebens, ihr entfliehen zu wollen. Sie würde mich in dreitausend Meter Höhe ebenso auffinden wie hier.‹
Am unheimlichsten war, dass er offenbar mit einer gespenstischen Vorstellung kämpfte, als wäre sie eine reale Macht. Ich machte Frau Blanka darauf aufmerksam, dass sie hier zuerst ihren Einfluss geltend machen müsse.
›Einfluss?‹, sagte sie und die Tränen standen der armen Frau nahe. ›Ich habe nicht einmal so viel Einfluss, dass er mich den Arzt holen lässt.‹
Um der Frau einen Gefallen zu tun, sandte ich am nächsten Morgen meinen Freund, den Arzt Doktor Engelhorn, zu Anders. Doch der Baumeister bekam einen Wutanfall und Engelhorn musste schleunigst seinen Rückzug antreten. Gerade damals musste ich verreisen, denn ich wollte das Archiv des Schlosses Pernstein wegen einer wichtigen Urkunde durchsuchen. Es dauerte einige Tage, bis ich die Urkunde gefunden hatte. Beim Suchen hatte ich jedoch einige andere höchst interessante Stücke entdeckt, sodass sich mein Aufenthalt noch um einige Tage verlängerte. Für den Rückweg benutzte ich die Bahn nur einige Stationen weit und stieg dann aus, um in einem frischen Marsch quer durch schöne Wälder die Stadt zu erreichen. Als ich an dem Wirtshaus eines beliebten Ausflugsortes vorbeikam, blickte ich zufällig über den Zaun des Gartens und sah Hans Anders an einem Tisch sitzen. Ich muss gestehen, dass mir seine Geschichte vor meiner Arbeit vollkommen in den Hintergrund geraten war. In diesem Augenblick fiel es mir schwer aufs Herz, dass ich meine Freundespflicht so sehr vernachlässigt hatte. Um wenigstens sofort zu erfahren, wie es um ihn stand, trat ich in den Garten des Wirtshauses und begrüßte ihn. Ich sah, dass Anders viel getrunken hatte. Da dies für den sonst sehr nüchternen Mann ungewöhnlich war, brachte ich es sofort mit seiner dunklen Geschichte in Zusammenhang.
›Oh, Doktor, Archivar‹, rief er mir entgegen, ›ich freue mich sehr, wirklich außerordentlich, und begrüße Sie im Namen der Wissenschaft.‹
Anders sprach viel und so laut, dass er die Aufmerksamkeit der zehn oder zwölf im ganzen Garten verteilten Gäste erregte. Während ich mein Viertel südmährischen Weins trank, trank er drei, und erst als es dämmerte, gelang es mir, ihn zum Heimweg zu bewegen. Wir gingen entlang des Flusses und sahen durch den das Tal erfüllenden Nebel die Lichter der Königsmühle vor uns. Endlich begann Anders von dem zu sprechen, was ihn, wie ich bemerkte, doch unausgesetzt beschäftigte.
›Nun endlich weiß ich, was sie will.‹
›Aber so sprechen Sie doch nicht immer von ihr‹, fuhr ich auf, ›als ob Sie es mit einer wirklichen Person zu tun hätten.‹
Hans Anders sah mich an und verstand meinen Einwand nicht, so sehr war er bereits in seinen Vorstellungen gefangen.
›Und wissen Sie, was vor meinen Augen geschieht? Es ist furchtbar. Sie hat sich meiner Frau bemächtigt.‹
›Also, was soll das wieder heißen?‹
›Sie hat sich meiner Frau bemächtigt, und vor meinen Augen vollzieht sich die Verwandlung. Es hat bei den Augen begonnen. Ein fremder, lauernder Blick ist in ihnen aufgetaucht, mit dem sie mich beobachtet hat: mein Gehen und Kommen, jede meiner Bewegungen. Wenn ich etwas sagte, glomm es in diesen furchtbaren Augen wie Hohn. Dann änderte sich auch die Gestalt. Meine Frau war kleiner und stärker. Das Weib, das jetzt neben mir sitzt und schläft – oder zumindest so tut –, ist schlanker und größer. Sie umkreist mich, spinnt mich ein. Sie hat mein Weib ermordet und Besitz von ihrem Leib ergriffen, um mir ganz nahe zu sein. An dem Tag, an dem sie dem Bild an der Wand vollständig gleicht, wird sie sich meiner bemächtigen. Aber ich bin entschlossen, ihr zuvorzukommen.‹
Mit Entsetzen erkannte ich, dass die nervöse Aufregung des Mannes bereits solche Fortschritte gemacht hatte, dass man fast schon von einer Geistesstörung sprechen konnte. Es war höchste Zeit, mit Energie einzuschreiten. Am nächsten Tag sann ich mit meinem Freund, Doktor Engelhorn, eben darüber nach, was zu tun sei, um der armen Frau zu helfen, als Frau Blanka bei mir eintrat. Sie sah sehr angegriffen aus: blass, mit tiefliegenden, unsteten Augen, und sie war mager geworden, sodass sie mir etwas größer vorkam.
›Ich weiß alles, gnädige Frau‹, sagte ich.
Da begann sie zu weinen. ›Ach, was können Sie wissen. Sie können nicht im Entferntesten ahnen, was ich leide. Mein Leben ist mir zur Hölle geworden. Das ist in meinem Fall keine Phrase, sondern bittere Wahrheit. Ich halte es nicht länger aus. Mein Mann hat sich völlig verändert. Ich sehe deutlich, dass er mich verabscheut. Er beobachtet mich unaufhörlich. Immer fühle ich seine schrecklichen Blicke auf mir ruhen, und er tut, als erwarte er von mir etwas Böses. Manchmal wendet er sich plötzlich und mit grimmiger Gebärde um, als glaube er, dass ich ihm nachschleiche. Dabei spricht er kaum, und wenn ich ihn anrede, antwortet er, als sei jedes Wort eine Falle. Wenn ich versuche, den Grund für sein sonderbares Benehmen zu erfragen, lacht er auf eine fürchterliche Weise. Gestern Abend war er den ganzen Nachmittag fort gewesen und kam etwas berauscht nach Hause. Als ich gerade dabei war, mich auszuziehen, stand er plötzlich hinter mir. Er war vorher in seinem Zimmer gewesen und ich hatte durch die Glastür gesehen, dass er in einem Heft las und darin blätterte. Plötzlich stand er jedoch hinter mir. Er war mir ganz unhörbar nachgegangen. Als ich mich umwandte, fasste er mich am Hals und sagte: Ein schöner Hals, und schon einmal durchschnitten. Da fürchtete ich mich und wollte wissen, was er damit meine. Er lachte jedoch nur wieder auf grässliche Weise und wies auf das alte Bild, das in unserem Schlafzimmer hängt. Frage die dort, oder besser, frage dich selbst. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und dachte über seine seltsamen Worte nach. Am Morgen stand ich auf, ging in sein Zimmer und holte das Heft, von dem mir schien, als müsse es in irgendeinem Zusammenhang mit seiner Veränderung stehen. Es lag noch auf dem Schreibtisch und war von meinem Mann fast vollständig beschrieben. Ich erinnerte mich, dass er in den letzten Wochen in diesem Heft geschrieben hatte – in seltsamer Hast, oft wie verstört, und so gereizt, dass ihn jedes Geräusch in seiner Nähe außer sich brachte. Ich hätte etwas darum gegeben, wenn ich gewusst hätte, welche Arbeit ihn so sehr fesselte und erregte. Als ich aber beginnen wollte zu lesen, überkam mich eine schreckliche Angst, die meine Neugierde überwand. Ich wagte nicht, es auch nur aufzuschlagen, weil ich … Nun, weil ich fürchtete, etwas Entsetzliches zu erfahren. Darum bringe ich Ihnen dieses Heft und bitte Sie, es zu lesen und mir dann zu sagen, was zu tun ist. Teilen Sie mir so viel davon mit, als Ihnen gut dünkt.‹ Damit überreichte sie mir das Heft, das ich Ihnen hiermit übergebe, Herr Landgerichtsrat. Sie werden höchst merkwürdige Aufzeichnungen darin finden. Ich überlasse es Ihrem Scharfsinn, sich in dieser Geschichte zurechtzufinden, die mir dadurch noch verwickelter wird. Doktor Engelhorn und ich versuchten, der Frau ihre Besorgnisse auszureden. Obwohl wir überzeugt waren, dass die Gefahr ganz nahe sei, taten wir so, als habe sie nichts zu befürchten. So erreichten wir, dass sie einigermaßen beruhigt nach Hause ging. Wir hatten ihr versprochen, die Aufzeichnungen ihres Mannes zu lesen und ihr gleich am nächsten Morgen darüber zu berichten. Und das war ein unverzeihliches Versäumnis. Dieser Mangel an Geistesgegenwart und energischer Entschlossenheit ihrer Freunde hat der armen Frau das Leben gekostet. So ist es mit uns Menschen: Wir sehen die Gefahr ganz deutlich, unterlassen es aber, ihr rechtzeitig zu begegnen. Nachdem Doktor Engelhorn und ich das Heft durchgelesen hatten, sahen wir uns an.
›Er ist irrsinnig‹, sagte ich. Aber Doktor Engelhorn ist ein sonderbarer Mensch. Obwohl er Vertreter einer exakten Wissenschaft ist, hat er sich daneben eine Art Aberglauben an allerlei Nachtzustände der menschlichen Seele bewahrt. Er pflegt bei jeder Gelegenheit das Wort Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde zu zitieren. Wenn die medizinische Wissenschaft vor einem Rätsel steht, gibt es niemanden, der sich mehr darüber freut als Doktor Engelhorn. Daher war ich auch gar nicht besonders erstaunt, als er mich zweifelnd ansah.
›Irrsinnig? Ich weiß nicht, ob ich dir Recht geben soll. Er macht nicht diesen Eindruck auf mich. Es gibt Zustände, die dem Irrsinn verzweifelt ähnlich sehen und doch nicht Irrsinn sind. Um dir das zu erklären, müsste ich aber …‹
›Nun, was soll es denn sonst sein?‹, unterbrach ich ihn.
Aber er zuckte nur mit den Achseln. ›Ich weiß es nicht.‹
Diese Unterredung, Herr Landesgerichtsrat, fand am späten Abend statt. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass Frau Blanka ermordet worden war. Was der furchtbaren Tat unmittelbar vorausgegangen war, konnten wir nur von Hans Anders selbst erfahren. Wir können nur vermuten, dass er sich durch den Mord von seinem Gespenst befreien wollte. Die Zertrümmerung des Bildes lässt sich damit ganz gut in Zusammenhang bringen. Es wird Aufgabe des Gerichts sein, darüber zu entscheiden, ob das letzte Wort in dieser seltsamen Geschichte nicht doch der Psychiater haben wird.«
Soweit die Aussage des Archivars Doktor Holzbock.
Der mysteriöse Fall des Hans Anders wurde zwei Tage später durch den Tod des Baumeisters zu einer Art Ende gebracht. Man fand ihn im Untersuchungsgefängnis in sitzender Stellung, an die Wand zurückgelehnt, eine Hand auf dem Herzen, den rechten Arm schlaff herabhängend, in einer so seltsam verdrehten Art und Weise, dass der Gefängnisarzt ihn kopfschüttelnd zu untersuchen begann. Er stellte fest, dass der Arm mehrfach gebrochen und verrenkt war, als sei er von einer furchtbaren Gewalt zermalmt worden. Als eigentliche Todesursache erkannte der Gefängnisarzt jedoch einen Herzschlag infolge plötzlichen Schreckens.
Schreibe einen Kommentar