König Asmordahn
Es war bereits zu später Abendstunde, als der warme Wüstenwind den Sand vor sich her fegte, da ritt ein junger Mann auf einem Esel zwischen den hohen Dünen. Nur der totenbleiche Mond war der stumme Begleiter des Einsamen. Der Esel war mit Nahrungsmitteln, klirrenden Töpfen und mittlerweile nur noch halb gefüllten, ledernen Trinkschläuchen schwer bepackt.
Der junge Mann, dessen Name Vyghan lautete, hatte ein großes Ziel vor Augen und eine beschwerliche Reise, durch Meilen um Meilen glühenden Sandes hinter sich. Er ließ eine Frau zurück, die stets liebevoll und großmütig zu ihm war, seit sie ihn gefunden hatte, die er jedoch nie als Mutter bezeichnete. Er wusste es besser.
Bald erblickten die scharfen Augen Vyghans die hohen Mauern der mächtigen Stadt, in der der hohe und gefürchtete König Asmordahn residierte. Ein gefährliches Lächeln zeichnete sich auf seinen Lippen ab.
Vyghan hätte sich niemals als normal beschrieben, denn ihm waren Dinge zu eigen, die andere wohl nicht verstehen konnten. Zum einen trug er seltsame Fähigkeiten in sich, die er lieber vor anderen Menschen geheim hielt, obwohl sie ihm große Kraft schenkten, zum anderen war da diese merkwürdige Stimme in seinem Kopf, die ihm ein Gefühl längst vergessener Geborgenheit versprach.
Jene Stimme war es, die ihn zur Residenzstadt des hohen Königs Asmordahn gerufen hatte. Vyghan ritt durch das kunstvolle, weiße Südtor, aus dem die prachtvollen Skulpturen alter Helden hervorsprossen, wie Blumen aus fruchtbarem Boden.
Danach erstreckten sich die staubigen und verwinkelten Straßen der Großstadt vor ihm, von sich tummelnden Leibern und brodelndem Lärm überfüllt.
Vyghan bahnte sich stumm seinen Weg durch die gesichtslosen, grauen Massen, die selbst zu dieser späten, mondbeschienenen Stunde murmelnd durch die Straßen wogten. Sein schwer beladener Esel mochte sich bald seiner träumerischen Müdigkeit ergeben, ebenso wie dessen Reiter es sich ersehnte.
Da kamen sie zu einem Gasthaus, aus dessen hell erleuchteten Fenstern monotones Stimmengewirr hervorplätscherte. Vyghan brachte sein Reittier in den angrenzenden Stall, öffnete die hölzerne Tür und setzte sich an einen freien Tisch.
Bald darauf stand ein dampfender Becher Salbeitee mit Kardamom vor ihm, dazu ein Teller mit einem etwas verschmorten Lammspieß, hauchdünnem Fladenbrot und einer großen Portion Hummus.
Das Gasthaus leerte sich schnell. Nachdem der hungrige junge Mann alles verzehrt hatte, hörte er aufmerksam einem Gespräch am Nebentisch zu, wo einige Männer zusammensaßen.
»Ich sage euch, König Asmordahn ist mit dem Teufel im Bunde«, begann der eine.
»Er hat alle Länder, die an die Wüste angrenzen, mit Krieg, Blut und Leid überzogen. Alle stehen unter seiner tyrannischen Herrschaft und fürchten seinen Zorn. Er tut nur das Beste für sich selbst, nicht das Beste für seine zahlreichen Untertanen, von denen viele hungern müssen, während er selbst sich in fantastischen Festmählern ungeahnter Pracht ergeht. Und da wäre noch sein Harem mit diesen wollüstigen Dämonen, die ihm jede Nacht zu Diensten sind … Ich sage euch: Das kann kein guter König sein!«
»Kennt ihr denn die Geschichte, wie Asmordahn König wurde?«, fragte ein alter Mann. Die Blicke richteten sich erwartungsvoll auf ihn.
»Unser heutiger König war einst ein einfacher junger Mann, nicht von königlichem Blut. Man erzählt sich, dass er der Sohn einer Weberin und eines Schmiedes war. Als er eines Tages auszog, um sein Glück zu suchen und seine Berufung zu finden, traf er in einem einfachen, ärmlichen Dorf auf einen Mann, der für sich und seine Familie um Hilfe bat.
Der Mann hatte gesehen, dass der junge Asmordahn einen langen, blitzenden Dolch mit sich führte, der einst im Feuer seines Vaters geschmiedet wurde.
Asmordahn solle ausziehen, um die skrupellosen und habgierigen Räuber zu stellen, die jenes arme Dorf vor ein paar Tagen überfallen und ausgeraubt hatten. Nun, so erzählte der Mann dem späteren König, hätten die Bewohner kaum noch die Möglichkeit zu überleben. All ihre Vorräte waren fort, sogar das Werkzeug, Teller und Besteck hatten die ruchlosen Räuber mit sich genommen. Einer Sache jedoch hatten sie sich nicht bemächtigen können. Und dieser Gegenstand, den der Mann besser versteckt hatte als alles andere, solle Asmordahns Belohnung sein, würde er siegreich zurückkehren und dem Dorf eine neue Zukunft schenken können.
Asmordahn, schon damals kampfeshungrig, wie er es später oft noch unter Beweis stellen würde, versammelte ein paar junge Männer des Dorfes um sich und ritt mit ihnen in die Wüste.
Zwei Tage suchten sie unter sengendem Sonnenschein nach den Räubern und wurden fündig. Die Räuber, selbst arme Männer ohne Hab und Gut und ohne quälende Moral, lagerten in einfachen Zelten nahe einer mächtigen Wanderdüne.
Asmordahn und seine Männer überwältigten sie im Schlaf und trugen all das unrechtmäßig erworbene Diebesgut zurück ins Dorf. Dort wurden sie jubelnd und voller Hoffnung mit strahlenden Blicken empfangen.
Der junge Asmordahn ging nach dem gewonnen Kampf schließlich zum Haus des Mannes, der ihm eine geheimnisvolle Belohnung für seine Hilfe in größter Not versprochen hatte.
Und er sollte sie erhalten. Der Mann öffnete eine mit vielen Schlössern gesicherte Truhe, unter mehreren Brettern im Boden versteckt. An diesem Tag erhielt der junge Asmordahn das magische, silberne Seil, dass laut einer alten Legende von den kunstfertigen Händen eines Halbgottes gefertigt wurde.
Dieses Seil, erklärte ihm der Mann, würde niemals reißen und könne jeden seiner Feinde auf alle Zeiten binden, ohne dass sie sich je befreien könnten. Asmordahn bedankte sich und ritt davon, lies jenes gerettete Dorf hinter sich.
Am Abend desselben Tages kam er in eine kleine Oase. In ihrer Mitte lag ein glasklarer Teich, umstanden von hohen Palmen, deren sichelartige Blätter sanft im Abendwind flüsterten und wisperten, als vertrauten sie sich gegenseitig längst vergessene Mysterien an, die nicht für die Ohren der Menschen gedacht waren.
Asmordahn schlug sein Lager auf, trank das diamantfarbene Wasser der friedlichen Oase und verzehrte ein paar Datteln als Abendbrot, dann fielen ihm die Augen zu. Er wurde vom verführerischen Klang einer sinnlich wispernden Stimme geweckt.
Sie sprach zu ihm von seinen vielen einsamen Stunden des Reisens und den verruchten Lüsten, die er dabei tief im Inneren empfunden haben musste. Sie sprach zu ihm von verzehrenden Liebkosungen, von den feurigen Begierden des Körpers und von der lustvollen Umarmung einer Frau.
Dann trat sie im schimmernden Mondlicht zu Asmordahn. Sie war eine Sukkubus. Eine vom Teufel gesandte Dämonin, deren aufreizendem Körper kein Mann zu widerstehen vermochte. Sie stand nackt vor ihm und in ihren Augen blitzte die Gier der Hölle. Sie würde ihn verführen, so wie sie es bisher mit jedem getan hatte, ob Mann oder Frau. Sie würde ihm die ganze Nacht die wunderbarsten Genüsse körperlicher Vereinigung zeigen, wie er sie noch nie zuvor erfahren hatte, um seine Seele nach der höchsten Höhe kreischender Lust, in die tiefsten Abgründe menschlicher Qual hinabzuziehen.
Niemand konnte einem Sukkubus widerstehen, niemand ihre weiche Haut, die Rundungen ihres Körpers oder das sinnliche Feuer in ihrer Stimme vergessen. Sie waren die reine Inkarnation teuflischer Verführung.
So trat der Dämon elegant auf den zukünftigen König zu und beugte sich zu ihm herab. Sein Blick war erstarrt, seine Gedanken gebannt. Er wusste, was für ein Wesen da vor ihm stand und was mit ihm geschehen würde, wenn er ihr verfiel.
Als seine Hand über ihre Haut strich, war es fast um ihn geschehen. Der Sukkubus grinste böse, da er sich einer neuen Seele gewiss war, die er auf eine Irrfahrt in die brennenden Schlünde ewiger Folter hinabsenden konnte. Doch dann geschah es.
Der junge Mann stieß den wahrgewordenen Traum abgründiger Fantasien von sich fort, griff mit einer schnellen Bewegung in seine Tasche und zog das silberne Seil hervor. Während der Sukkubus kreischte, band er dem Wesen die Hände und fesselte es. Ein Seil wie jenes, das der junge Asmordahn besaß, konnte selbst der Sukkubus nicht zerreißen; und so brach er mit seiner Gefangenen in die heutige Hauptstadt auf.
Schnell machten Gerüchte die Runde, bald hatten alle von dem jungen Mann gehört, der einen Dämon der Wüste gebannt hatte. Einen Dämon, der bis dahin als unbesiegbar galt.
Asmordahn brach oft in der Mitte der Nacht in die mondbeschienene Wüste auf und kehrte am darauf folgenden Morgen mit einem weiteren, gefangenen Dämon zurück.
Bald war es unvermeidbar: Die Menschen forderten den Rücktritt des bisherigen Königs, der sie nicht vor der höllischen Wut der Dämonen aus der Wüste hatte beschützen können. Sie forderten Asmordahn als neuen König. Und so kam es.
Als er König war, überzog er die umliegenden Lande gnadenlos mit Krieg und Verwüstung. Aus jeder besiegten Familie nahm er den ältesten Sohn und ließ ihn in seinem Palast zum Krieger ausbilden, sodass alle, die gegen ihn aufbegehrten, gegen ihr eigenes Blut hätten kämpfen müssen.
Niemand wagte je wieder, Asmordahns Zorn herauszufordern.
Wie ihr wisst, leben die gefangenen Sukkuben im Harem des Königs. Nur er darf es betreten. Jede Nacht nimmt er eine von ihnen zu sich und teilt mit ihr das Bett. Er ist der Einzige, der das kann, er hat dem Zauber der Dämonen widerstanden und verhöhnt sie dadurch – Nacht für Nacht.
Asmordahn muss nichts und niemanden mehr fürchten, er hat keine ernst zu nehmenden Feinde. So lebt er heutzutage bereichert durch jegliche Genüsse, die ein königliches Leben mit sich bringt. Leider hat er darüber den Schmerz seiner Untertanen aus dem Blick verloren.
Manchmal geht er des Nachts noch auf die Jagd in der Wüste, manchmal erlegt er den ein oder anderen Dämon; doch wie es scheint, hat er alle Sukkuben gefangen, die der Höllenschlund ausgespien hat.«
Der junge Vyghan hatte die Geschichte mit Interesse verfolgt. Dabei spürte er, wie die seltsame Stimme in seinem Kopf drängender geworden war. Sie rief um Hilfe, sie bat um Freiheit. Vyghan bezahlte für ein Zimmer und ging zu Bett.
Als die Morgensonne in magischem Schein erwachte, machte er sich auf zu König Asmordahns Palast. Nur wenige Menschen ersuchten den König um eine Audienz, die meisten hatten es wohl aufgegeben. Als Vyghan an der Reihe war, wurde er von einem glatzköpfigen Mann in teuren Seidenkleidern durch einen vor Leben sprühenden Garten, in den Audienzsaal geführt.
In diesem Garten wuchsen Palmen und Blumen in allen erdenklichen Farben, exotische Vögel kreischten in der Luft und die plätschernden Springbrunnen waren mit marmornen Statuen gekrönt.
Vor dem Thron des hohen Königs Asmordahn angekommen, fiel Vyghan auf die Knie. Die strahlend grünen Augen, unter den tintenschwarzen Haaren des Königs musterten ihn misstrauisch.
Neben Asmordahn lag der tintenschwarze Leib eines mit Narben übersäten Panthers, dessen blaue Augen wachsam leuchteten. Keine Kette, kein Seil würden ihn aufhalten, sollte er sich entscheiden, sich in Vyghans Hals zu verbeißen. Er lag still da, dieser Panther musste nicht wild fauchend seine Zähne blecken, um gefährlich auszusehen.
»Was führt dich zu mir?«, fragte der König.
»Ich möchte Euch meine Dienste anbieten«, erwiderte Vyghan und blickte dem König dabei fest in die Augen.
Asmordahn lachte schallend. »Ich habe ein gewaltiges Heer der besten Krieger um mich, die mir treu ergeben sind. Ich habe hunderte Dämonen aus der Wüste gefangen, die mir traumhafte Genüsse zeigen, wie sie sonst kein Mensch kennt, und meine Diener und Untergebenen lesen mir jeden Wunsch von den Augen ab. Deshalb frage ich mich, welche Dienste mir ein ärmliches Wesen wie du anbieten will, die für mich von Nutzen sein könnten«, donnerte der König höhnisch.
Vyghan hörte wieder die Stimme in seinem Inneren. Ihr Flehen war eindringlicher geworden. »Ihr habt die Herrscher der umliegenden Lande bezwungen und sie zu Euren Dienern gemacht. Doch reicht Euch das? Diese Welt ist groß, mein König. Träumt Ihr nicht von weiteren Siegen, von Erfolgen auf dem Schlachtfeld, die Euch zu einer unsterblichen Legende machen würden? Träumt Ihr nicht von all den fernen Landen mit all ihren exotischen und mythischen Geheimnissen? All diese Länder könnten Euch gehören! Und bevor Ihr erneut lacht, hört mir zu. Ja, ich könnte Euch dabei helfen, diese legendären Siege zu erringen! Ich kann derjenige sein, der den Unterschied macht, derjenige der Euch einen solchen Vorteil verleihen wird, das Eure Feinde vor Euch erzittern!«
»Das tun sie, so oder so! Bisher habe ich mir alles genommen, was ich begehrte, und niemand konnte etwas dagegen tun. Außerdem glaube ich Eurem hochtrabenden Geschwätz nicht. Wahrscheinlich ist es das Beste, wenn meine Wachen Euch hinauswerfen.«
Da trat Vyghan vor. Der König blinzelte überrascht, als plötzlich der glatzköpfige Mann in Seidenkleidern vor ihm stand, der Vyghan hineingeführt hatte.
»Ich kann mein Äußeres in einem Herzschlag verwandeln. In der einen Sekunde bin ich noch ich, in der nächsten ein Spion in den Reihen Eurer Feinde, der nicht zu enttarnen ist und Euch ausschlaggebende Informationen zukommen lassen kann«, sagte Vyghan in Gestalt des Mannes in Seidenkleidern. »Alles, was ich dazu benötige, ist eine Winzigkeit desjenigen, in den ich mich verwandeln soll. Meinem Führer zog ich schnell ein Haar von seiner Kleidung, als er nicht zu mir blickte. Dies allein genügt, wie Ihr sehen könnt!«
Zwei der in Silber gehüllten Wachen waren vorgetreten und hielten ihre blitzenden Speere drohend vor Vyghan.
»Er ist ein Dämon aus der Wüste, ein Wechselbalg, das Kind eines Sukkubus! Nur deshalb vermag er es, seine Gestalt zu verändern. Wir töten ihn in Eurem Namen, mein König!«, riefen sie aufgebracht.
Doch König Asmordahn war aufgestanden und hielt seine Wachen mit einer herrischen Handbewegung zurück. In seinen grünen Augen – es war ein toxisches Grün – blitzten Faszination und Gier.
»Keiner rührt ihn an! Ich nehme dein Angebot an, Junge. Man gebe meinem neuen und ergebenen Diener ein angemessenes Zimmer im Palast!«
Und so kam es.
Vyghan lag seit langer Zeit wieder in einem weichen Bett und genoss die Aussicht aus dem weiten Fenster ihm gegenüber. Hinter ihm prasselten lodernde Holzscheite im Kamin, knisterten und knackten, wobei sie behagliche Wärme verströmten. An den Wänden hingen in Gold gerahmte Bildnisse wunderbarer, exotischer Landschaften, von meisterhafter Künstlerhand geschaffen.
Doch trotz aller Behaglichkeit nahm die innere Spannung Vyghans nur zu. Er stand kurz vor der Bewältigung einer großen Aufgabe. Sein geschwungener Dolch, gefährlich aufblitzend im geisterhaften Mondlicht, das von einer geheimnisumrankten Zukunft wisperte, lag griffbereit neben ihm, während sein Blick gedankenverloren in die Ferne schweifte.
Vyghan konnte die hohe Felsnadel erblicken, die wie das versteinerte Horn eines längst vergessenen Teufels aus dem Boden wuchs und sich dem Himmel kampfbereit entgegenstreckte.
Er erblickte den schmalen Grat, der sich, zu beiden Seiten steil abfallend, durch luftige Höhen schlängelte. Er bildete den einzigen Weg auf die Felsnadel, auf der das Gefängnis all der Teufel lag, die der übersinnlichen Macht des Silberseils des Königs erlagen. Dort oben stand der tempelartige Bau, der Asmordahns Teufelsharem bildete und schwieg unheilverkündend im stillen Mondlicht.
Doch im Inneren Vyghans schwieg nichts. Die flehende Stimme hatte sich zu einem geisterhaften, körperlosen Geschrei gesteigert. Mal schwoll es an, mal schwoll es ab. Mal war es angenehm ruhig, flüsterte verständig mit den Umgarnungen eines vernunftbegabten Geistes, mal war es ein wutentbranntes Keifen, das in seine Nerven wie glühende Nägel stach.
Vyghan wusste, dass sich die Wut nicht gegen ihn, sondern gegen den Peiniger richtete, doch ängstigte ihn die Stimme dennoch.
Sie klang mal wie das Brummen tausender, ekelhafter Fliegen, mal wie das Zischeln eines Heeres giftspukender Schlangen, mal wie die wunderbaren Liebkosungen einer mitfühlenden Seele.
Trotz aller abgründigen Finsternis, die diese Stimme versprach, war sie der einzige Ort in Vyghans Innerem, der ihm Geborgenheit schenken konnte; Geborgenheit, die er bei niemandem sonst auf dieser Welt finden konnte, vor allem nicht in den düsteren Blicken, die ihm andere schenkten, von denen viele spürten, dass er anders war.
Die Stimme hatte lange gewartet, viel zu lange, doch dies hatte bald ein Ende. In den Stunden, in denen sie ruhig und vernünftig klang, verriet der Wechselbalg ihr seinen wagemutigen Plan.
Asmordahn wusste was er tat, sonst wäre er nicht in der Lage gewesen, über einen so langen Zeitraum König eines so gewaltigen Reiches zu sein. Er würde dem neuen Teufel in seinen Reihen keinerlei Gelegenheit bieten, sich auch nur eines einzigen Haares von Asmordahn zu bemächtigen. Zu unvorhersehbar, zu gefährlich, ja tödlich wären die daraus resultierenden Folgen.
Der Teufel war eine mächtige Waffe, die sich zwar gegen ihn selbst richten konnte, die aber zurzeit in seiner Hand lag. Und würde der große König Asmordahn mit dieser Waffe in der Hand, die direkt aus den schmerzverkrusteten Tiefen höllischen Wahns zu ihm gesandt worden sein musste, zum Schlag ausholen, gäbe es niemanden, der nicht mehr vor ihm in ergebenster Demut erzitterte.
Er lenkte seine Schritte durch eine Vielzahl verschlungener Gänge und freute sich bereits darauf, sich diese Nacht den verbotenen, dunklen Lüsten seines Harems hinzugeben.
Der König war vorbereitet. Er bewahrte in seinem Gemach eine gut verschlossene, dunkle Holztruhe auf, in der er nur einen einzigen Gegenstand verwahrte. Bei diesem Gegenstand handelte es sich um ein kleines Fläschchen mit einer geisterhaft leuchtenden, bläulichen Flüssigkeit darin.
So, als hätte das Schicksal seine Begegnung mit dem Sohn eines Sukkubus vorhergesehen, hatte er ihm das Fläschchen vor Jahren geschenkt.
Doch das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Wie so vieles andere, was er besaß, nahm Asmordahn das zauberhafte Gebräu einfach an sich. Er enthauptete den einsamen Zauberer in der Wüste, der es einst gebraut hatte, mit einem Schwerthieb.
In seinem Besitz hatte Asmordahn zusätzlich ein altes in Leder gebundenes Buch gefunden, dass uralte, dämonische Mysterien in grotesken Zeichnungen und bizarrem, unaussprechlichem Sprachgebrauch ins Diesseits hervorbrachte.
Asmordahn wusste von dem Ort, an den die Sukkuben manchmal gingen. Er wusste von dem Ort, den kein Mensch allein finden konnte, von dem Ort, der nichts mit einer Hölle gemein hatte.
Dort funkelten sechs diamantartige Sonnen an einem ewig blauen Himmel. Der kühlende Wind flüsterte dort sanft wie ein Bach durch die rauschenden Palmwedel der schattenspendenden Bäume. In den glasklaren Seen schillerten und schimmerten tanzende Fische, geschuppt in allen Farben des Regenbogens, und in den ewig sprudelnden Flüssen, floss Milch, Wein und Honig.
Doch bisher hatte er keinen seiner Gefangenen dazu bringen können, ihm den Weg in dieses verheißungsvolle Paradies zu zeigen. Vielleicht ließ sich dieser Umstand bald ändern.
Der König überquerte den schmalen, sich nach oben windenden Grat bis hin zu dem tempelartigen Bau auf der Felsnadel. Dabei genoss er den atmosphärischen, mondscheingetränkten Blick über die Dächer und Gärten seiner gewaltigen Metropole.
Die beiden in blitzendes Silber gehüllten Wächter öffneten das marmorne Tor und Asmordahn trat ins Innere seines Teufelsharems. Unter rankenüberzogenen Säulen lauerten lüsterne Blicke auf ihn.
Dort standen sie alle, seine dämonischen Eroberungen und warteten liegend oder sitzend, umgeben von blühender Vielfalt und umschmeichelt von knisterndem Feuerschein, der sanft über ihre unverhüllten Körper leckte.
Jede einzelne war begehrenswerter als die andere. Ihre Körper bildeten die sinnlichste Allegorie lodernder Leidenschaft. Asmordahn erblickte Lilith, deren glänzende Haare von zwei anderen Sukkuben in einem verzierten Brunnen gewaschen wurde, während sich ihr geschwungener Oberkörper noch oben reckte und ihre Hand keck mit der grün geschuppten Schlange spielte, die sich elegant über ihren weißen Leib schlängelte. Sie war Gefahr und Verführung zugleich.
Im Zusammenspiel mit dem mystischen Mondlicht, das durch das offene Dach hindurch schien, bildete die Szenerie eine fanatisch schöne Komposition übermenschlicher, uralter Geheimnisse.
Viele der sich räkelnden und flüsternden Wesen, die seelenlosen Mächten verschrieben waren, hatten bereits versucht, ihn zu töten, doch keiner war es je gelungen. Der König war intelligenter, brutaler und hinterhältiger als alle Teufel der Hölle.
Manche Sukkuben drängten sich ihm auf, ihm in dieser von Sternenglanz getränkten Nacht zu eigen zu sein, manche wichen angstvoll vor ihm zurück. Und eine, die ihm ins Auge fiel, schien keine Notiz von ihrem König zu nehmen.
Es war diejenige, die auf den Namen Caleeja hörte. Sie lag auf einem runden Podest, das vollständig von Ranken überzogen war, umhüllt vom flackernden Licht zweier Feuerschalen.
Caleeja schien ganz in sich versunken, als hätte sie die Verbindung zur Außenwelt unterbrochen. Asmordahn hatte seine Wahl für diese Nacht getroffen.
Im Gemach des Königs entfloh der Sukkubus seiner träumerischen Apathie und enttäuschte ihren Herrn in keiner Weise. Sie bereitete dem gierigen König verzehrende Stunden tiefster, keuchender Vereinigung, trieb ihn in wahnhaft kreischende Ekstase und zerkratzte ihm am höchsten Punkt innigsten Verlangens seine Brust.
Als sie in den Harem zurückgebracht wurde, strich sie das Blut des Königs unter ihrem Fingernagel an einen Stein in einem der prachtvollen Korridore. Zur gleichen Zeit entstand im Kopf des jungen Vyghan ein genaues Bild eben jenes Korridors. Seine Vorstellung, übermittelt von der fremdartigen Stimme, zeigte ihm den Stein und die genaue Stelle, an der sich der Tropfen Königsblut befand.
So stand er eilig von seinem Lager auf und huschte in stiller Heimlichkeit durch die Gänge des Palastes. Er fand die Stelle, die ihm in Gedanken gezeigt wurde. Mit seinem Dolch kratzte er das getrocknete Blut in einen ledernen Beutel, in dem er die kleinen Artefakte all der Menschen sorgsam aufbewahrte, in die er sich verwandeln konnte.
Nun war auch der große König Asmordahn, der Herrscher der Wüste, der gefürchtete Schlächter unter den Hüllen, die sich der Wechselbalg überziehen konnte. Vyghans weiße Zähne blitzten gefährlich, wie die eines Wolfes, in einem höllischen Grinsen auf.
Nachdem er sich vergewissert hatte, das ihn niemand sah, streifte er sich die Hülle des Königs über.
Alle Wachen, die er passierte, ließen Vyghan vorbei, ohne ihn zu behelligen. Er überquerte den Grat und betrat den Harem. Die Sukkuben waren offensichtlich nicht überrascht, ihren König diese Nacht zum zweiten Mal zu erblicken. Vyghan blieb einen kurzen Moment blinzelnd stehen, als ihn die Ehrfurcht vor diesem kunstvollen Bau packte. Dann machte er sich schnellen Schrittes auf die Suche.
Während er die Gänge und Säle durchquerte, hingen sich manche der Teufelinnen an seine Fersen oder stellen sich ihm in aufreizenden Posen in den Weg. Dabei lächelten sie verführerisch mit ihren roten, vollen Lippen oder strichen in gespielter, sinnlicher Verzückung mit ihren eleganten Fingern über die vollendeten Harmonien ihrer Körper.
Vyghan kämpfte verzweifelt gegen den inneren Drang an, sich ihnen einfach hinzugeben und alles andere zu vergessen.
Da erblickte er die eine, die er suchte, wegen der er all die Qualen und Torturen seiner langen Reise auf sich genommen hatte. Caleeja lächelte ihn zaghaft an.
»Seid ihr es wirklich, mein König?«, fragte sie, und Vyghan nickte stumm.
Da merkte sie, dass es sich wirklich und wahrhaftig um ihren Retter handelte, der gekommen war.
Vyghan nahm sie am Arm und mahnte sie zur Eile. Sie rannten den gesamten Weg zurück, passierten Korridor um Korridor und gelangten schließlich in den fast magischen Garten, hinter dem das Eingangstor des Palastes lag.
Sie wähnten sich schon in sicherer Freiheit, als Vyghan die dunkle Gestalt vor dem Tor erblickte, die regungslos im Mondschein auf sie wartete. Asmordahn trug keine Waffe, lächelte sie jedoch siegessicher und überheblich an.
»Ich dachte eigentlich immer, ein Sukkubus kann keine Kinder bekommen. Es wäre wohl schlecht fürs Geschäft, aber ich habe mich wohl getäuscht. Du bist eine große Ausnahme, meine schöne Caleeja, du bist etwas wahrhaft Besonderes. Keiner der anderen Dämonen, die ich im kreischenden Wüstenwind fing, hat je ein Kind erwartet, du jedoch schon. Man stelle sich nur vor, was ich tun könnte, zeugte ich noch mehr von euch Wechselbälgern. Die ganze Welt, die der Menschen und die der Teufel könnte mir gehören, mir allein! Ich wäre der König über alles, was existiert! Es tut mir herzlich leid, doch ich denke, ich kann euch unmöglich gehen lassen.«
Vyghan drehte sich um. Dort standen keine Wachen, nur der schwarze Panther mit den leuchtenden Augen hatte sich lautlos herangepirscht. Er beobachtete sie wachsam, machte jedoch keine Anstalten, anzugreifen.
Obwohl der König keine Waffe trug, durfte Vyghan ihn nicht unterschätzen. Asmordahn war zu skrupellos, zu brutal und hinterlistig. Doch der Wechselbalg hatte eine Idee, wie er seinen Widersacher überlisten konnte. Es streckte seine Hand aus, die Hand des Königs und griff nach dem ledernen Beutel.
Da hatte Asmordahn bereits blitzschnell ein kleines Fläschchen hervorgezogen und es auf den Wandler geschleudert. Ein Fläschchen, dessen blauer Inhalt in seinem Flug im fahlen Licht der Nacht aufblitzte.
»Du hattest vor ,dich in ein Raubtier oder noch besser in einen Dämon der Sande zu verwandeln, richtig? Deine Wandlungskünste sind nicht nur auf das menschliche Äußere beschränkt, nicht wahr? Ich kenne einige eurer Geheimnisse und hätte es genauso gemacht wie du. Nur leider wirst du dich nie wieder verwandeln können! Der Trank, der dich benetzte, nimmt dir diese Fähigkeit für alle Zeiten.«
Mit diesen Worten sprang der König, schnell wie eine zubeißende Viper vor und landete auf dem überraschten Vyghan. Dessen Dolch fiel klirrend zu Boden.
Asmordahn verfluchte lautstark den Wechselbalg und trieb ihm gnadenlos die Fäuste in den Leib. Doch Vyghan war stark, er wehrte sich mit allen Kräften. Die beiden Kontrahenten waren ineinander verschlungen und rollten über den Boden.
Caleeja, die ahnte, dass Vyghan dem König unterlegen war, griff den Dolch und schleuderte in einem inneren Impuls folgend auf Asmordahn, von dem sie glaubte, dass es der echte war. Der Dolch bohrte sich sirrend in dessen Leib, Blut ergoss sich auf den Boden des Gartens.
Der überlebende Asmordahn blickte Caleeja kurz an, dann packte er wieder ihren Arm und zerrte sie durch das Tor. In diesem Moment setzte der Panther zum Sprung an.
»Wir müssen hier weg!«, keuchte er atemlos. Sie rannte, wie sie noch nie gerannt war.
Das grollende Fauchen des Panthers verfolgte sie wie ein Schatten durch die engen Straßenschluchten.
Da rief der Sukkubus seinem Begleiter zu, er solle die Augen schließen und er tat es. Plötzlich berührten seine Füße nicht mehr Staub und Stein, sondern liefen auf Gras.
Verwundert hob er seine Lider und blickte sich um.
Er befand sich im Paradies, so wie er es sich in seinen kühnsten Träumen erhofft hatte. Die sechs farbenprächtigen Sonnen schenkten dem kraftstrotzenden, funkelnd grünem Gras ihr wärmendes Licht, der zauberhaft wispernde Wind ließ verspielt die Palmblätter tanzen, die schillernden Fische, geschuppt in den leuchtenden Farben des Regenbogens sprangen vergnügt aus dem sich kräuselnden Wasser; und tatsächlich, in den ewig sprudelnden Flüssen flossen leuchtend goldener Honig, schneeweiße Milch und feuerroter Wein.
Zwischen den Palmen gingen die Sukkuben, die schönsten Wesen, die der Teufel je geschaffen hatte. Es war das Paradies und hier gab es keinen Tod, kein Altern. Hier herrschte das ewige Vergnügen.
Der Neuankömmling fragte sich, warum es gerade Dämonen waren, die den Weg ins Paradies kannten, doch konnte er darauf keine Antwort finden. Er bewunderte beeindruckt den Schein der Sonnen, die Leben spendenden Flüsse und die majestätischen Berge am Horizont. Nie wieder würde er diesen Ort verlassen.
Doch auch nachdem sie bereits viele Jahre in Glück und Zufriedenheit in den leuchtenden Wonnen ewiger Jugend verbracht hatten, blieben Caleejas Zweifel ihre treuen Begleiter. Natürlich war es Vyghan gewesen, ihr eigener Sohn, den sie gerettet hatte – oder?
Manchmal, da sah sie diese Hülle Asmordahns so seltsam an, da wagte sie kaum seine Gedanken zu erraten. Das Band der inneren Stimme, das sie und ihr Kind so lange verbunden hatte, war seit dem Moment fort, da Vyghan, der Wechsler, ihr im Teufelsharem gegenübergetreten war, doch hatte sie es nie wieder aufs Neue knüpfen können. Das mochte vielerlei Gründe haben, außerdem benötigten sie es nun nicht mehr, nun waren sie für alle Zeiten vereint.
Das Geschenk, an diesem Ort des Überflusses leben zu können, verlieh der höchste Dämon nur denjenigen, die ihm Hunderte, wenn nicht Tausende von entrissenen Seelen brachten. Caleeja war dies gelungen. Und sie hatte ihren Sohn mit zu diesem Ort genommen, schenkte ihm, so wie jede Mutter es wohl will, ewiges Glück, das niemand ihm würde entreißen können. Oder hatte sie ihren Sohn getötet?
Trieb sie ihm mit ihrer eigenen Hand einen Dolch in den Leib? Das Grausame daran war, dass sie es nie mit völliger Gewissheit sagen konnte. Die Zweifel würde sie als ewige Bürde mit sich tragen müssen.
Sie war eine Mutter, die niemals erfahren würde, ob sie ihrem Kind, ihrem einzigen Schatz im Leben, das größte Geschenk der Fantasie oder den Tod gebracht hatte.
War dieser Asmordahn der gefürchtete König, der echte, der sich durch hinterhältige sowie geniale Gerissenheit in der richtigen Situation, durch arglistige und berechnende Täuschung nicht nur sein Leben, sondern darüber hinaus seinen ewigen Platz in der endlosen Pracht des magischen Paradieses erschlichen hatte?
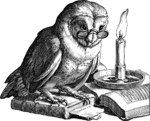
Schreibe einen Kommentar