Addy der Rifleman – Der Kampf im Schellsbusch
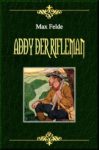 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Der Kampf im Schellsbusch
Man hatte den Mohawk entlang die Kunde, dass Thayendanegeas durch Addy schwer verwundet worden sei, mit großer Genugtuung aufgenommen und erging sich schon in der Hoffnung, dass man nun wenigstens einige Zeit, vielleicht für immer, Ruhe haben werde. Galt doch dieser Häuptling als die Seele aller dieser Einfälle.
Aber schon nach ganz kurzer Zeit sollten die Ansiedler bitter genug erfahren, dass sie sich, indem sie friedlichere Tage erhofften, gründlich getäuscht hatten. Schon in den darauffolgenden Wochen mehrten sich die Überfälle, und, man erkannte das bald, es lag System in der Sache.
Namentlich in den oberen, westlich vorgeschobenen Teilen des Tales folgten die Überrumpelungen so rasch aufeinander und derart, dass die dortigen Ansiedler ihre wenig geschützten Wohnungen und Farmen größtenteils aufgaben und nach den weiter östlich gelegenen Bezirken zogen.
Aber auch in den German Flats, die dichter bewohnt und durch das Fort Schuyler geschützt waren, donnerten eines Abends zwei Kanonenschüsse.
Sofort flüchteten die Talbewohner mit ihren schnell zusammengerafften Habseligkeiten ins Fort.
Dort war ein Grenzer mit der Nachricht eingetroffen, dass dieses Mal mehrere hundert Rothäute im Anrücken begriffen seien, und dass drei seiner Kameraden, die zur gleichen Zeit mit ihm in der Richtung des anrückenden Feindes oben in den Wäldern streiften, von den Indianern abgefangen und auf der Stelle getötet wurden.
Kaum war die Dunkelheit hereingebrochen, da fielen die Rothäute schon ins Tal ein und kennzeichneten durch brennende Häuser den Weg, den sie nahmen, ohne indessen einen Angriff auf das Fort zu wagen, dessen Besatzung übrigens, wie schon der erste Versuch lehrte, zu schwach war, um dem Feind offen gegenüber zu treten.
Schaurig rot glühte der Himmel die ganze Nacht hindurch und als die Indianer am anderen Morgen abgezogen waren, da zählte man dreiundsechzig niedergebrannte Häuser und siebenundfünfzig Scheunen. Es waren drei Mahl- und zwei Sägemühlen vernichtet und nicht weniger als 235 Pferde, 229 Stück Hornvieh, 269 Schafe und 93 Ochsen weggeschleppt worden. Dagegen waren glücklicherweise nur zwei Personen ums Leben gekommen.
Am anderen Morgen verfolgten etwa zweihundert schnell zusammengezogene Reguläre und ebenso viele Milizmänner den Feind. Es kam zu einigen blutigen Scharmützeln, doch vermochten diese Truppen den Rothäuten von dem Raub nichts mehr abzunehmen.
Man machte bei der Verfolgung nun auch noch obendrein die betrübende Erfahrung, dass an diesem Raubzug nicht nur Huronen, sondern auch Onondaga- und Senecaleute teilgenommen hatten, und das konnte nur eine Verschlimmerung des ohnehin grausam genug geführten Grenzkrieges bedeuten.
Bald fand sich hierfür die Erklärung, denn man erfuhr von einigen befreundeten Oneida, die kurz nach diesen Vorgängen im Tal auftauchten, dass Agenten der Johnsonschen Regierung den um die Seen wohnenden, sogenannten fünf indianischen Nationen eine Prämie von acht Dollar für jeden amerikanischen Skalp angeboten hätten.
Diese barbarische Maßnahme war natürlich nicht nur für die Huronen, sondern auch für die anderen Indianerstämme ein Reizmittel, verheerend in das Mohawktal einzubrechen, die schlimmsten Instinkte der Wilden zu entfesseln und den Grenzkrieg, welcher sich bisher nur auf die waffenfähigen Männer beschränkt hatte, zu einer grausamen, allgemeinen Metzelei zu steigern.
Eines Morgens zog Franzl auf schmalem Feldpfad, etwa eine Stunde nordöstlich des Fort Dayton, zu dem etwas abgelegenen sogenannten Schellsbusch.
Dort wohnte der Farmer Johann Christian Schell mit seiner Frau und sechs Söhnen und die waren stets gute Abnehmer seiner feilgebotenen Waren.
Franzl, der sich zwar auch mit der Landwirtschaft beschäftigte und fleißig der Jagd oblag, war seines Zeichens eigentlich ein Handelsmann.
Alljährlich, wenn der Winter nahte, oder wenn es dem Frühjahr zuging, machte er sich auf den Weg nach Albany, erhandelte dort von den holländischen Kaufleuten allerlei Winter- und Sommerbedürfnisse, mit denen er dann, schwere Packen in einer korbartigen Tragevorrichtung auf dem Rücken schleppend, von Farm zu Farm hausieren ging.
So hatte er vor Jahren als Handschuhhändler in der deutschen Heimat das ganze Bayernland hausierend durchwandert, war auf seinen Zügen alljährlich auch in die Pfalz gekommen und eines Tages von einer Emigrantengruppe, die sich jenseits des Atlantischen Ozeans goldene Berge versprach, überredet worden, sich ihnen anzuschließen. Wanderlustig wie er war und ledig jeglicher Verpflichtung, hatte er ohne langes Besinnen eingeschlagen, war mit ihnen hinübergesegelt über das große Wasser. Als ihm drüben nicht sogleich die gebratenen Tauben in den Mund geflogen kamen, hatte er den altgewohnten Hausierhandel wieder aufgenommen.
Stets munter und aufgeräumt war er auf den Farmen ein gern gesehener Gast und vermochte durch seine launige Beredsamkeit manche Bäuerin zu beschwatzen, dass sie mehr einkaufte, als sie eigentlich beabsichtigt hatte, oder ihre Börse zurzeit bestreiten konnte. Franzl gewährte dann aber auch gerne Kredit oder tauschte gegen seine Waren irgendwelche Wertgegenstände ein. So hatten sich mit den Jahren zwischen ihm und den Farmen rege kaufmännische Beziehungen herausgebildet.
Nun freilich gedachte er selbst eine Farm zu übernehmen. Sein Binche hatte vor etlichen Wochen schon von ihr Besitz ergriffen und schaltete und waltete dort bereits als fleißige Hausfrau.
Er wollte nur noch auf einem letzten Wanderzug alle die Verpflichtungen regeln, die reichlichen Rückstände, die ihm noch vom letzten Winter her da und dort zu gute standen, wenn möglich einziehen, um dann, wenn er über zwei Wochen Hochzeit halten und von der Farm Besitz ergreifen würde, einiges Betriebskapital in Händen zu haben.
Den Rücken schwer bepackt, die Büchse im Arm, oftmals sein Filzhütl zurückschiebend und sich die Schweißtropfen von der Stirn wischend, stapfte er einsam zwischen den Feldern und Baumgärten dahin.
Die Sonne stand fast im Zenit und sandte ihre Strahlen gar fühlbar zur Erde nieder.
Franzl gönnte sich eine kleine Rast, legte seine Bürde ab, warf sich ins Gras und begann seine Pfeife zu stopfen.
Nicht weit von seinem Ruheplatz stand ein Apfelbaum. Auf diesem fand sich, während Franzl müßig im Gras lag, ein kleiner Vogel ein, der hell und munter sein kurzes Lied sang:
Tirili – bin hie, bin hie,
Kiwitt, kiwitt,
Komm mit, komm mit.
Und Franzl, zu dem gefiederten kleinen Sänger aufblickend, stimmte alsbald täuschend dieselbe Weise an.
Verwundert, woher der Lockruf wohl käme, verstummte der Vogel, um dann aber bald nur umso lauter loszulegen.
Da unterbrach ein zweites Vögelchen dieses Duett, kam herbeigeschwirrt, eine Federflocke im Schnabel.
Das Erstere hüpfte dem zweiten von Ast zu Ast entgegen, dann verschwanden beide hoch oben in der dicht beblätterten Baumkrone.
»Aha … aa Nestl bau’n … Hochzeit mach’n?«, sprach Franzl, der im Anblick der kleinen traulichen Szene lächelnd seine Pfeife hatte sinken lassen.
Da kamen die beiden Vögelchen fröhlich jubilierend aus ihrem Nest wieder hervor und hüpften flink von einem Zweig zum anderen.
Franzl ließ auch nun wieder seine schönsten Lockrufe ertönen, aber die beiden kleinen Tiere hatten wohl keine Zeit, auf ihn zu achten.
Schwapp schwirrten sie davon, um neues Baumaterial für ihr Nest zu suchen und emsig heimzutragen.
Franzl blickte ihnen lange sinnend nach.
Befand er sich nicht ganz in demselben Fall? War nicht auch er dabei, noch einiges für sein Nest zusammenzutragen, das er dann mit diesen Mitteln für sich und sein Binche so recht traulich und später, so gut er es vermochte, weiter ausbauen würde?
In Gedanken verloren, spitzte er noch mehrere Male seinen Mund, den melodiösen Ruf der Tiere nachzuahmen, doch die beiden Vögelchen ließen sich nicht wieder blicken.
Da störte mit einem Mal der gelle Schrei einer weiblichen Stimme seine beschauliche Ruhe.
Aufspringend gewahrte er, wie eine Frau, etwa hundert Schritte von ihm entfernt, über den Acker lief, dass die Kittel nur so flogen, die Hände vor den Mund hielt und ein ums andere Mal einen Namen rief.
Gleich darauf hörte er von fern her einige männliche Stimmen, und nun kamen aus den Büschen, die das Gut dem Wald zu umsäumten, ein starker, kräftiger Mann und vier junge Leute gelaufen, denen zwei Jungens im ungefähren Alter von acht Jahren zu folgen sich bemühten.
»Sakra«, schimpfte Franzl, »nu’ kann i’ mir scho’ vorstell’n, was los is … sans scho’ wieda da … net amol a Pfeif’n lass’ns aan stopf’n …«
Eilig steckte er die halb gefüllte Tabakspfeife in die Brusttasche, nahm seinen Tragekorb auf und lief, so schnell er es mit seiner schweren Bürde vermochte, zum Wohnhaus der Farm, dessen helles Gebälk er bereits durch die Bäume schimmern sah.
Die Hälfte des Weges lag hinter ihm, als sich die Frauenstimme geller als je erhob.
Zur Seite blickend, gewahrte Franzl, dass etwa ein Dutzend Rothäute hinter den fliehenden Weißen einher sprangen und dieselben fast schon eingeholt hatten.
Sofort warf Franzl seinen Tragekorb ab und benutzte ihn als Deckung.
Sofort hielt Franzl an, legte die Büchse an die Wange, der Schuss krachte.
Das brachte die Indianer, die in ihrer Hast den Mann mit dem Tragekorb bisher wahrscheinlich gar nicht bemerkt hatten, zum Stehen und die Fliehenden gewannen dadurch einen bedeutenden Vorsprung.
Franzl lud sofort wieder, schoss, doch vermochte er es nicht zu hindern, dass sich inzwischen zwei der Rothäute über die hinterdrein trabenden beiden Jungen hermachten, diese gefangen nahmen und dem Wald zu schleppten.
Nun eröffneten aber auch die Rothäute das Feuer und Franzl, dem die Kugeln bedenklich um die Ohren pfiffen, merkte es nur zu gut, dass das Schießen ihm galt.
Sofort warf er seinen Tragekorb ab, legte sich dahinter und benutzte ihn so als Deckung.
So wechselte er mit dem Feind mehrere Schüsse und seine Kugeln mussten gut gezielt sein, denn die Rothäute wagten nicht näher zu kommen.
Inzwischen hatten die fünf Weißen das Wohnhaus erreicht, die Büchsen hervorgeholt und eröffneten nun auf die Rothäute von dort aus ein nachdrückliches Feuer.
Dies hatte zur Folge, dass sich die Indianer unter stetem Schießen, teils kriechend, teils von Baum zu Baum springend, zu dem Busch zurückzogen, aus dem sie hervorgebrochen waren.
Dadurch bekam Franzl Luft. Er raffte seinen Tragekorb vom Boden auf und seinen Oberleib damit schützend, lief auch er nun zum Blockhaus.
Hier wurde er von den Farmersleuten kurz, aber herzlich begrüßt. Seit man im Tal keinen Tag mehr sicher war, von den Rothäuten auf offener Straße überfallen zu werden, verstand es sich ganz von selbst, dass man sich in der Not gegenseitig unterstützte. Da bedurfte es nicht vieler Worte, da gab es keine lange Danksagung.
Der alte Schell, der Franzl schon von Weitem die schwielige Hand entgegengestreckt hatte, war ein derber und knorriger Mann. Trotzdem sein Haupt- und Barthaar schon reichlich Silberfäden aufwies, war er doch ein Bild von Frische, Gesundheit und strotzender Manneskraft.
Auch die Söhne waren kräftige, jugendliche Gestalten, gestählt durch harte Arbeit, die alle, man sah es jedem an, so jung sie noch waren, ihren Mann stellten.
Frau Schell war ebenfalls eine etwas derbe, doch recht sympathische Erscheinung.
Sie hatte zufällig durch ein Fenster des oberen Stockes geblickt, einige Rothäute aus dem Wald herabsteigen sehen und war dann gleich im Geschwindtempo hinausgelaufen, die ihren, die sich arbeitend draußen auf dem Feld befanden, zu warnen und heimzurufen.
Nun stand sie auf demselben Platze und starrte durch die schmale Öffnung in der Wand hinüber zum Wald, ab und zu verstohlen die Augen wischend. Waren es doch ihre beiden Jüngsten, ein Zwillingspaar, die nicht mehr mitgekommen waren vom Feld und von den Roten weggenommen wurden, und die beiden Jungen waren ihr besonders ans Herz gewachsen.
Während man sich auf Franzls Vorschlag noch beriet, ob man den Rothäuten nachsetzen sollte, um ihnen die beiden entführten Knaben wieder abzujagen, krachte dumpf und rollend das Alarmsignal vom Fort herüber, dem sofort ein zweiter Kanonenschuss folgte.
Es war das Zeichen, dass ein Überfall drohe, und zugleich die Aufforderung an die umliegenden Talbewohner, sich nach Dayton zu begeben.
Aber Vater Schell wollte, da sich die Indianer bereits in der unmittelbaren Umgebung der Farm gezeigt hatten, von einem Aufbruch dahin nichts wissen.
»Mein Haus ist stark und gut zur Verteidigung eingerichtet«, sagte er. »Wir sind sechs Mann und haben zehn Büchsen – meine Frau wird, wenn es gilt, auch nicht fehlen. An Pulver und Blei ist kein Mangel. Sollen wir uns ins Ungewisse auf den Weg machen? Soll ich etwa noch eins von den meinen verlieren? Nein, wir vertrauen auf Gott, auf unsere starken Arme und bleiben!«
Alle waren einverstanden und dabei blieb es.
Und in der Tat, das aus Balken errichtete Farmhaus war ausnehmend stark gebaut und mit mancherlei Einrichtungen für die Verteidigung gegen feindliche Angriffe versehen.
Die untere Balkenlage hatte außer einer Anzahl Schießlöcher, die nach allen Seiten hin reichlichen Ausschuss gestatteten, als einzige Öffnung nur den Hauseingang. Der war durch eine starke, massive Tür verschlossen, die Vater Schell nun nicht nur verriegelte, sondern auch noch durch zwei innen vorgelegte Balken sicherte.
Rund um den oberen Stock zog sich auf allen vier Seiten ein Gang, der über den unteren Teil des Gebäudes vorragte. Er war aus starken Balken gefügt und stellte somit eine verhältnismäßig sichere Brustwehr dar.
Im Boden dieses Ganges befanden sich mehrere Löcher, welche die Abwehr des Feindes auch von oben her ermöglichten, sobald er den Versuch wagen sollte, die Eingangstür aufzubrechen oder das Haus in Brand zu stecken.
Das niedrige Stallgebäude, in dem sich einiges Vieh befand, lag dicht hinter dem Haus. Der einzige Eingang desselben war dem Wohngebäude zugekehrt, sodass er von diesem aus leicht beherrscht werden konnte.
Vater Schells Erstes war nun, die Stalltür schließen zu lassen, dann zwei seiner Söhne oben auf den Gang des Wohnhauses zu schicken. Sie sollten sich dort oben so aufstellen, dass jeder derselben zwei Längsseiten des Hauses im Bereich seiner Büchse hatte, und dass sie beide das ganze umliegende Gelände zu überblicken vermochten.
Da Wald und Busch sehr nahe lagen und die Kulturen rings um das Haus außerdem stark mit Bäumen bestanden waren, erforderte dieser Auslug große Aufmerksamkeit.
Frau Schell erinnerte sich unterdessen, dass sie bereits das Mittagessen gekocht hatte, das sie den ihren auf das Feld bringen sollte.
Sie verschwand trotz ihrer Aufregung in einem als Küche dienenden Nebenraum des Erdgeschosses und kehrte mit einer dampfenden Schüssel zurück, die sie auf den schweren, roh gezimmerten Tisch des Hauptraumes stellte.
Sie legte eine Handvoll Holzlöffel daneben und nötigte, als die Männer nur wenig Neigung zum Essen bezeigten, noch zitternd am ganzen Leib, zum Zugreifen.
»Du hast recht, man fühlt sich mutiger und ist zum Widerstand mehr fähig, wenn man etwas Ordentliches im Leibe hat – wer weiß, was die nächsten Stunden bringen …«, meinte Vater Schell.
Also reihte man sich um den Tisch.
Der Alte sprach ein Gebet und man aß gemeinsam aus einer Schüssel, nachdem auf das Geheiß der Mutter der älteste Sohn zuvor noch für die beiden Wache haltenden Brüder einen Teil schöpfte und nach oben brachte.
Auch Franzl hatte sich mit an den Tisch gesetzt, zog seinen eigenen Löffel aus der Hosentasche und langte anfangs gleich den anderen wacker zu.
Wohl um die ihren zum Essen aufzumuntern, war Frau Schell selbst mit gutem Beispiel vorangegangen und schöpfte Bissen um Bissen.
Da aber blieben ihre Blicke mit einem Mal an zwei Löffeln hängen, die übrig geblieben waren und unbenutzt auf dem Tisch lagen. Nun war es um die Ruhe, die sie seither so tapfer bewahrte, geschehen.
Eine dicke Träne brach sich Bahn aus den Augen der Mutter und rollte langsam über die Wange herab. Die Brust der Farmerin hob sich krampfhaft und sie brach in herzzerbrechendes Schluchzen aus.
Alle hatten den langen Blick, den sie nach den beiden verwaisten Löffeln geworfen, aufgefangen und ihn sehr wohl verstanden.
»Beruhige dich, Rösche«, tröstete Vater Schell, »der Wille des Herrn mag geschehen und es ist geschehen … mir müssen es in Demut hinnehmen …«
Aber das Trösteramt stand dem Alten übel an; man merkte es an seiner Stimme, dass er nicht minder schmerzlich ergriffen war.
Über eine kleine Weile legte auch er seinen Löffel sachte auf die Tischplatte, schob ihn mit seiner schwieligen Faust langsam beiseite und eins ums andere folgte seinem Beispiel.
»Lasst enk die Sach’ net gar z’ nah’ geh’n, Frau Schell«, unterbrach Franzl die entstandene schwüle Pause, »so ‘was kann an ‘s Herz’l abdruck’n, un’ das darf net sei’, un’ dös is aa goar net nöti’. No’ is net aller Tage Abend – ‘leicht hab’n unsere Scharfschütz’n jetzt schon die Rot’n am Krawattl, un’ dann müss’n’s die zwoa Buab’n wieder hergeb’n. Dann, sag’ i’; der Christl un’ der Martl san grod aa net auf ‘n Kopf g’fall’n, san flink wie d’ Wieserln; kann man’s wiss’n, ob’s net, kloa wie’s san, irgendwo durchschlupf’n un’ ‘n Weg nach der Farm find’n? Lasst ‘s enk net goar a so bekümmern, Frau – vertraut auf ‘n Gott Vota in Himmi drob’n, der wird die Sach’ scho’ recht mach’n.«
Frau Schell ließ sich denn auch beruhigen. Sie trocknete mit dem Schürzenzipfel ihre Augen und sah Franzl für seine tröstenden Worte dankbar an. Ja, sie ließ sich sogar herbei, dass er ihr später seine Schätze vorlegen durfte, die zum großen Teil ihren Beifall fanden.
»Schaug’t’s«, so pries er seine Herrlichkeiten vor dieser, »Strümpf hob’ i’, a wundaschöne War’ … woach sans, un’ warm halt’n’s, dass ma sei’ Lebtag bumberlg’sund bleibt … Kalte Füeß hab’n, das hat d’r Teuxl g’sehn … net woahr, die Strümpf san schön? – Un’ da san Stoff’ von all’n Art’n, wie man’s net bessa wünsch’n kundt … für’n Vota un’ für die Buab’n, farbecht, stark wie Eis’n, absolut net zum derreiß’n. Aber i’ hab’ aa ‘was B’sunders für die brave Hausfrau … was? so a blau’s Sunntagsg’wandl tat enk net üb’l ansteh’n? Un’ da san Knöpf’, Nadl’n, Fad’n, was a Frau vom Haus allstündli’ brauch’n kann, schöne farbene Bandl’n, Spitz’n, un’ da schaut’s a mol die wundaschöne Haub’n an!«
Mit einer kühnen Handbewegung setzte Franzl der Frau die Haube auf das volle, noch ganz dunkle Haar und reichte ihr aus seinem Korb einen blanken Metallspiegel dar.
Noch mit Tränen im Auge betrachtete sie sich mit diesem Kopfputz, und selbst Vater Schell nickte beifällig, als er sein Rösche mit der wirklich gut kleidenden Haube geschmückt sah.
»Nun ja, wollen abwarten, ob uns die Roten überhaupt Zeit lassen, das eine oder andere näher anzusehen«, entschied Frau Schell, »für jetzt packt nur wieder ein, Franzl … Das Nächste ist, dass wir Haus und Hof hüten!«
»Das versteht si’«, pflichtete Franzl bei. »Erst dischkrier’ ma mit die Rot’n a Wörtl, nachd’n mach’ ma unsr’n Hand’l ferti’!«
Franzl machte sich ans Einpacken, hatte aber noch lange nicht alle ausgekramten Gegenstände in den Tragekorb zurückgelegt, als oben auf dem Rundgang polterndes Getrappel sich hören ließ. Gleich darauf erschien einer der beiden jungen Söhne auf der Treppe und schrie: »Vater, sie kommen!«
Sofort stürzten die Männer nach oben, und richtig, vom Waldgelände her näherten sich teils kriechend, teils im Schutz der Bäume mehr als ein halbes Hundert Rothäute.
Eilig stellten sich Vater Schell, Franzl und die beiden ältesten Söhne hinter die Balkenwand des Ganges, während die beiden Jüngsten an den zwei hinteren Ecken der Galerie ihre Beobachtungen fortsetzen sollten, um, wenn von diesen Seiten her oder von rückwärts dem Haus eine Gefahr drohte, sofort Lärm zu schlagen.
Wurde hier oben der Ausblick durch zahlreiche Bäume auch beeinträchtigt, so war der Gesichtskreis im Ganzen doch ein weit größerer als vom Erdgeschoss aus, und der alte Schell hoffte, dass es ihnen gelingen würde, die Angreifer in achtungsvoller Entfernung zu halten.
Gelang es den Rothäuten aber, in unmittelbare Nähe des Gebäudes vorzurücken, dann allerdings würden sie den Schwerpunkt der Verteidigung nach unten verlegen müssen.
Die vier Männer lagen im Anschlag. Frau Schell stand im Innenraum an einem großen Tisch, auf dem vier Reservebüchsen und Munitionsbedarf lagen.
Die trübe Stimmung der Hausfrau war nun ganz gewichen. Aus ihren Zügen sprach Mut und Entschlossenheit.
Die umsichtige Frau hielt die nach dem Gang führende Tür offen und hatte auch die Läden der beiden seitlichen Fenster so weit geöffnet, dass sie die vier Schützen stets im Auge behalten konnte.
Draußen kroch der Feind zwischen hochragenden Feldfrüchten mit all der Geschicklichkeit, die der Rothaut eigen ist, heran, oder es tauchten einzelne dunkle Gestalten plötzlich auf Augenblicke auf, um flink wieder hinter einem Baumstamm oder sonst einem Gegenstand zu verschwinden. Noch waren sie von dem Farmhaus gut hundertfünfzig Schritte entfernt. Man beriet sich, wann wohl das Feuer am vorteilhaftesten zu eröffnen sei, und kam überein, den Feind auf etwa achtzig Schritte herankommen zu lassen.
Mit jeder Minute näherte sich derselbe mehr, und als die Rothäute auf der Farm keine Lebenszeichen wahrnahmen, wurden sie bald dreister; sie beschleunigten ihr Tempo.
Allgemach waren sie auf die Entfernung herangekommen, in welcher sie, der Verabredung gemäß, den ersten Kugelgruß empfangen sollten. Zugleich mussten sie einen frisch abgemähten Wiesengrund überqueren, auf dem nur einige wenige Bäume Deckung boten.
Nun gab der alte Schell das Zeichen und fast zugleich krachten vier Schüsse, deren jeder sein Opfer forderte.
Ein Wutgeheul brach draußen los, zugleich erhoben sich die Indianer dutzendweise, wahrscheinlich in der Meinung, dass die Belagerten erst laden müssten, und sprangen wieder ein Stück vor.
Aber das sollte ihnen übel bekommen. Denn Frau Schell war sofort, nachdem die ersten Schüsse gekracht hatten, zu den Schützen hinausgesprungen, hatte ihnen die abgeschossenen Büchsen abgenommen und frisch geladene in die Hände gedrückt.
Wieder knallten schnell hintereinander vier Schüsse, und das Geheul, das darauf antwortete, bewies den Weißen, dass sie gut gezielt hatten.
Nun feuerten aber auch die Rothäute.
Klatschend fuhren die Kugeln in die Balkenwand des Rundganges. Diese aber war stark und gut, sodass die Angreifer den Belagerten nichts anhaben konnten.
Frau Schell entwickelte nunmehr im Laden der abgeschossenen Büchsen eine bewundernswerte Geschicklichkeit, war flink im Zureichen der frisch geladenen Waffen, sodass die Männer hinter den kleinen schmalen Luken stets schussbereit lagen und so den Rothäuten übel mitspielten. Durch das schnelle Schießen musste bei ihnen überdies die Meinung erweckt werden, dass sie es mit einer weit größeren Anzahl Verteidiger zu tun hatten, als sie wohl ursprünglich annahmen.
So war das Feuergefecht ein recht lebhaftes geworden und das Vorrücken der Indianer, die empfindliche Verluste erlitten, alsbald zum Stillstand gekommen.
Schon frohlockte Vater Schell, dass sich die roten Leute über kurz oder lang respektvoll zurückziehen würden.
In der Tat wandte sich ein großer Teil derselben wieder nach dem Busch, kamen aber schon nach kaum einer Viertelstunde wieder aus demselben hervor und nun gewahrten die Belagerten mit Schrecken, dass sich diese Leute nur zu dem Zweck zurückgezogen hatten, um sich mit einer Menge Reisigbündel zu beladen.
»Bis jetzt war die ganze G’schicht net unrecht«, meinte Franzl. »Dass ‘s oba so viel Holz daherschlepp’n, dös will ma scho’ goar net g’fall’n!«
»Mir ebenso wenig«, entgegnete, recht bedenklich geworden, der alte Schell.
»Was dageg’n mach’n?«, fragte Franzl.
»Wir müssen eben versuchen, auch dieser Gefahr möglichst entgegen zu wirken. Vor allem wird es, wenn es wirklich zu einem Sturmlauf auf das Haus kommen sollte, wohl am besten sein, wenn wir hauptsächlich die Bündelträger aufs Korn nehmen.«
»Dafür bin i’ aa’, Vota Schell«, meinte Franzl. »Nur ka Holz net ans Haus herlass’n. Wann das erst brennt, nachd’n könn’ ma scho’ glei’ a unsa Testament mach’n.«
»Und dann«, meinte der Alte, »wäre es vielleicht richtig, wenn ich mit meinen beiden Ältesten jetzt schon nach unten gehe. Was sagt Ihr dazu?«
»Mir soll’s recht sein«, entschied Franzl, »i brauch enk net – i’ will da herob’n schon dermach’n, was an rechtschaff’n Mensch’n mögli’ is.«
»Ich lasse noch einen von meinen zwei Jungen, den Konrad, herkommen. Ich denke, einer tut es jetzt dahinten mit dem Aufpassen … und vergesst auch nicht die Löcher im Fußboden für den Fall, falls sich die Halunken bis an die Tür wagen.«
»Hab’s schon g’seg’n – die Fuchslöcha, die vergiss i’ net – i’ neid kan von die rot’n Teuf’ln, der da drunt’n steht, wann der Franzl da herob’n is.«
Vater Schell ging nach hinten. Er rief seinen Konrad, einen frischen, blonden Jungen von etwa vierzehn Jahren, an Franzls Seite, der voll Kampfeseifer daher gerannt kam. Der Alte instruierte sodann auch den anderen Aufpasser, der nun, stetig hinter der Brustwehr auf und ab schleichend, ein umso größeres Terrain nicht aus den Augen zu lassen hatte.
Dann begab sich Vater Schell hinab zu den beiden Ältesten, die dort hinter den Schießluken bereits Aufstellung genommen hatten, und auch Frau Schell ging, nachdem sie Franz und ihren Konrad noch mit Munitionsbedarf versehen hatte, mit ihren Reservebüchsen, Kugel- und Pulverbeutel ins Erdgeschoss.
Es war die höchste Zeit, dass alles wieder schussfertig an seinem Platz stand, denn schon waren die Bündelträger draußen bis an den freien Wiesengrund heran gelangt und beim Übersetzen desselben war ja die beste Gelegenheit, ihnen die Streitbarkeit der Belagerten bestmöglich fühlbar zu machen.
Als die ersten Rothäute über die Wiese sprangen, krachten denn auch oben auf dem Gang und unten im Erdgeschoss rasch nacheinander die Flinten. Mehrere Indianer brachen mitten im Sprung zusammen und blieben mit ihren Holzbündeln am Platz. Aber die Nachfolgenden rafften im Vorbeikommen das fallen gelassene Reisig wieder auf und die bereits weiter vorgedrungenen roten Leute eröffneten gegen das Farmgebäude mit einem Mal ein solch starkes Feuer, dass durch den dicht vorgelagerten Pulverrauch entlang der ganzen feindlichen Stellung bald nichts mehr unterschieden werden konnte.
Wohl oder übel schwiegen die Flinten der Belagerten nun, denn was hätte es genützt, blindlings darauf loszufeuern.
Dafür aber trafen sie alle Vorbereitungen, einem etwaigen Sturm auf das Haus mit der Kugel im Laufe umso nachdrücklicher zu begegnen. Sie taten gut daran, denn plötzlich erhob sich ein wildes Kriegsgeschrei und sämtliche Rothäute, von denen etliche Feuerbrände schwangen, stürmten gegen das Wohnhaus.
Schlag auf Schlag krachten jetzt die Büchsen der Farmersleute und fegten manchen der Feinde hinweg.
Sie konnten es aber nicht hindern, dass die Mehrzahl der Rothäute bis in die unmittelbare Umgebung des Hauses vordrang, ja dass einige Verwegene bis an die Wand des Gebäudes gelangt waren, wo sie sich zwischen den Schießscharten dicht an die Balkenlage drückten, sodass ihnen vom Erdgeschoss aus mit der Flinte nicht mehr beizukommen war. Zum Glück führten diese Leute kein Holz mit sich.
Sobald aber die Indianer ihre Situation übersahen, begannen die hinter den nächsten Bäumen haltenden roten Männer den an der Wand des Hauses Stehenden Bündel um Bündel zuzuwerfen. Sofort gingen die Letzteren an das Aufstapeln des Reisig, während einige andere mit ihren Kriegsbeilen gar mächtig die Tür bearbeiteten.
Aber diese verwegenen roten Leute hatten die Rechnung ohne die Wirte gemacht, denn Franzl und der jugendliche Konrad erinnerten sich, als sie die Gefährlichkeit der Lage erkannten, rechtzeitig der Löcher oben im Fußboden des Ganges. Sie senkten ihre Gewehrmündungen durch dieselben nieder, und wie ein Bombenschlag wirkte es unten, als dicht über den Köpfen fast gleichzeitig zwei Büchsenläufe sich entluden.
Schon war inzwischen Frau Schell mit frisch geladenen Reservebüchsen die Treppe emporgestiegen und versetzte dadurch die beiden Schützen in die Lage, sofort noch einige Schüsse folgen zu lassen.
Das hatte denn auch die Wirkung, dass die unten in ein unbeschreibliches Wutgeschrei ausbrachen, und dass alles, was noch heil war, heulend davonlief.
Die plötzliche Panik gerade derjenigen Leute, die schon gewonnenes Spiel zu haben glaubten, das Haus in Brand zu stecken, dazu das heftige Feuer, das nun wieder ununterbrochen aus den Schießluken des Erdgeschosses hervorflammte, entmutigte aber auch die übrigen Rothäute derart, dass auch sie einer nach dem anderen Fersengeld gaben und erst weit hinten zu einem geordneten Halt sich wieder sammelten.
»Habt’s enk’r Teil!«, höhnte Franzl, als er auf allen Punkten die Roten laufen sah. »Ja, so a weiße Kopfhaut is schwer zum hab’n – sieb’n Stuckln, das machet fufzig und sex Dollar – für den, der’s hat, a schön’s Geld. – Vorläufi’ is damit oba no’ nix!«
Auch die unten waren, als sie den Feind durch die Luken hindurch in vollem Davonlaufen sahen, in Jubelrufe ausgebrochen, worauf Franzl mit einem hellen heimatlichen Jauchzer antwortete, aber mitten in dem Ruf jäh abbrach.
»Da schaug her«, sagte er, als er die Sprache wieder erlangte, mit dem Ausdruck jähen Erstaunens, und hielt seine Augen sperrangelweit auf eine etwa dreißig Schritte vom Farmhaus entfernt stehende Ulme gerichtet. »Was is denn dös in dem Baam da ob’n für a Vog’l?«
Hoch in den Ästen des Baumes, von Zweigen und Blättern nur halb verdeckt, hockte ein Indianer, dessen Glutaugen zu Franzl herüber funkelten.
»So, deine saubern rot’n Brüderln san dir davong’lauf’n«, rief Franzl gut gelaunt zu der Rothaut hinüber. »Du arm’s Hascherl, du, dich ham’s im Stich g’lass’n. – Na, wart, dir werd’ i’ das Baamkrax’ln verleid’n, du Spitzbua – hast’s auf eh’ nix anders als auf mi’ abg’seg’n«, und legte die Büchse an die Wange.
Aber in demselben Augenblick stieg drüben in der Ulme eine Rauchwolke auf und Franzl, der in der Überraschung über seine Entdeckung unvorsichtig genug war, statt sich hinter die Umrahmung der Galerie zu legen, den Schuss über die Brustwehr hinweg abzugeben, sank getroffen nieder.
»Sakra, hat mi’ der Malefizschlankl do’ derwischt«, schimpfte er und langte mit der rechten Hand tastend nach der linken Schulter. »Konradl, gib’s eahm, eh’ er di’ oda an anders aa no’ unglückli’ macht!«, schrie er dann seinem jugendlichen Nachbar zu, und da krachte auch schon des Jungen Büchse.
Ächzend schob sich Franzl bis zum nächsten Schussloch vor und sah, wie drüben auf der Ulme der Wilde bedenklich schwankte, seine Flinte fallen ließ und dann plötzlich von dem Ast, auf dem er hockte, herunterrutschte.
Indem er sich mit beiden Händen krampfhaft festhielt, machte er verzweifelte Anstrengungen, mit den baumelnden Beinen eine Stütze zu finden. Doch unmittelbar unter ihm befand sich nur dünnes Geäst, das bei jeder Berührung nachgab und dann wieder in seine alte Lage zurückschnellte.
So hing er wohl an vierzig Fuß hoch zwischen Himmel und Erde und musste zudem schwer getroffen sein, denn schmerzhaft zuckte und wand sich sein ganzer Körper.
Da verließen ihn die Kräfte und jäh schoss er aus der Höhe durch das rauschende und brechende Geäst nieder auf die Erde und blieb dort bewegungslos liegen.
»Der arme Schlankl – da hat er’s«, sagte Franzl mit einem Anflug von Bitterkeit und wendete sich weg von dem Anblick. »Oba er hat’s ja net anders woll’n«, beruhigte er sich. »Was braucht er aufiz’steig’n? – I’ dank’ schön – hoch in die Baa’m un’ in da Luft umanand so a Stucker fufzig Wilde – nachd’n kinn’ ma da herob’n glei’ z’samm’pack’n!«
Da kam Frau Schell mit einem Trunk daher, ihn den Schützen als Erfrischung anzubieten, und erschrak nicht wenig, als sie durch ihren Konrad erfuhr, dass Franzl verwundet sei.
Sofort rief sie ihren Mann herbei. Der kam und entblößte ohne viele Umstände Franzls linke Seite.
Es stellte sich heraus, dass oben an der linken Schulter eine Kugel eingetreten war und das Schlüsselbein zerschmettert hatte. Glücklicherweise nahm das Geschoss den Weg nach oben und war über dem Rücken wieder ausgetreten.
»Nun«, sagte Vater Schell, »Ihr könnt noch von Glück sagen. Wäre die Kugel eine Handbreit tiefer dahergeflogen, wäre es Euch wahrscheinlich schlimmer ergangen.«
»Na«, erwiderte Franzl, »dann sa ma halt z’fried’n mit dem, was ma hab’n, un’ ergeb’n uns in das unabwendbare Schicksal. Aber«, meinte er, »der Teixl hat’s g’seg’n, a nette Bescherung is do’, just jetzt, agrad vor’m Hochzeitmach’n.«
»Wann sollte die denn sein?«, fragte Frau Schell.
»Heunt über vierzehn Tag’n … ‘s Binche hat mir erst gestern botschaft’n lass’n, dass mi’ bestimmt erwart’ und dass alles schon g’richt is.«
»Nun«, meinte Vater Schell, »die Wunde wird bald wieder heil sein. Die Hochzeit, die werdet Ihr schon um etliche Wochen hinausschieben müssen … Doch, Rösche, schnell, hol Wasser und Linnenzeug – wir wollen nicht unnütz die Zeit verplaudern, sondern schnell noch, solange uns der Feind Ruhe gönnt, die Wunde auswaschen und einen Verband anlegen.«
Flink sprang Frau Schell davon und war mit dem Erwünschten gleich wieder zur Stelle.
Während nun der alte Schell vorsichtig die Wunde auswusch und verpflasterte, hielten seine Söhne unten und oben scharfe Wacht.
Fortgesetzt fielen hüben wie drüben einzelne Schüsse, doch hielten sich die Rothäute immer noch in der gleich respektvollen Entfernung.
Auf einmal aber erhob sich draußen wieder ein wildes Geschrei.
Sämtliche Rothäute waren wie mit einem Zauberschlag aus ihren Verstecken aufgesprungen und rannten wie wahnsinnig schnurstracks wieder gegen das Haus.
Das war so unerwartet und rasch gekommen, dass der Farmer, der sofort von Franzl abließ und aufsprang, noch nicht auf seinem Posten unten angekommen war, als auch schon die Rothäute am Haus anlangten.
Und es lag diesmal ebenso viel oder noch mehr Berechnung und System in ihrem Angriff.
Während nämlich ein Teil der Roten sich daran machte, den Rest der umherliegenden Holzbündel aufzulesen und entlang der Balkenwand des Hauses aufzustapeln, hinderte ein anderer Teil die Belagerten insofern am Schießen, als sie die Mündungen ihrer Büchsenläufe von außen her in die Schießscharten steckten und blindlings in das Innere des Hauses schossen.
Einige andere Rothäute richteten ihr Feuer gegen die über ihnen befindlichen Bodenlöcher des Rundganges so heftig, dass die oben es nicht wagen durften, sich über den Schießluken blicken zu lassen.
Die Lage, namentlich für die unten im Erdgeschoss, war dadurch eine sehr üble geworden, denn wenn die Schüsse, welche die Indianer in das Haus abgaben, auch zum Glück nicht trafen, so konnten die Schützen an die Schießluken nicht oder doch nur schwer heran, und zudem füllten sich die Räume des kleinen Hauses bald dermaßen mit Pulverrauch, dass man kaum mehr die Hand vor den Augen sah.
Vater Schell zog es unter diesen Umständen vor, sich mit seinen beiden Söhnen zum Gang oben zurückzuziehen, in der Annahme, von oben her eher zum Schuss zu kommen.
Nur Frau Schell blieb, und sie kam, als sie in ihrer Erregung zunächst ganz planlos in den raucherfüllten Räumen umherrannte, plötzlich auf den glücklichen Einfall, das Küchenbeil zur Hand zu nehmen. Sie schlich sich mit diesem entlang den Wänden, und wo es durch die Schießluken hereinblitzte, oder wo sie einen Büchsenlauf zu entdecken vermochte, da sauste ihre Waffe mit kräftigem Hieb auf die Mündung der Schusswaffe nieder.
Die Rothäute waren außen nicht wenig verwundert, wenn sie auf diese Weise durch den eigenen Flintenkolben plötzlich einen gar derben Backenstreich empfingen.
Sie zogen unwillkürlich die Waffe zurück und brachen in ein Wutgeheul aus, wenn sie den Lauf nicht schlecht verbogen und dadurch das ganze Schießzeug als unbrauchbar geworden befinden mussten.
Diese wenig angenehmen Entdeckungen und das wütende Geschrei, das sie erhoben, hatte aber auch noch die andere Wirkung, dass es die Aufmerksamkeit derjenigen Rothäute auf sich zog, welche die Schusslöcher oben im Boden des Ganges zum Ziel erwählt hatten, und dadurch bekamen die dort befindlichen Weißen mit einem Mal Luft.
Vater Schell und die seinen gaben das, was sie einmal errungen hatten, nicht so leichten Kaufes wieder preis – Franzl und die zwei Jüngsten luden – und alsbald krachte Schuss auf Schuss von oben nieder.
Diesem nachhaltigen und wohlgezielten Feuer konnten die Indianer unten nicht mehr standhalten, und nun suchte sich einer nach dem anderen in Sicherheit zu bringen.
Nur eine grell bemalte, robust gebaute Rothaut mit dem Häuptlingszeichen in den dunklen Haarsträhnen, offenbar der Anführer der ganzen Bande, hielt hartnäckig aus.
Er hatte einen Hebebaum in die unter der Eingangstür befindliche Fuge eingesetzt und arbeitete mit herkulischer Kraft, die Tür aus den Angeln zu heben.
Das Werk wäre ihm auch gelungen, hätte nicht Vater Schell den Eingang gleich zu Beginn des Überfalles innen durch zwei vorgelegte Balken, die gegen feste eiserne Streben stießen, gesichert.
Nun sollte aber auch dieser verwegene Wilde seine Hartnäckigkeit schwer büßen.
Er bekam einen Schuss in den Oberschenkel, und mit hasserfülltem Blick nach oben sank er in die Knie.
Als Vater Schell dies gewahrte, sprang er auf, war schnell über die Treppe hinab, hob die Balken an der Türe aus, entriegelte dieselbe, erfasste mit eisernem Griff den Verwundeten und zog ihn ins Haus, worauf Frau Schell den Eingang schleunig wieder schloss.
Diese augenblicklicher Eingebung entsprungene Tat war für die Belagerten in mehrfacher Hinsicht von größtem Wert.
Einmal rettete sie dieselben von weiterer Feuergefahr, denn die Indianer hätten den nochmaligen Versuch, das Haus anzuzünden, sich wohl überlegt, da sie ihren Häuptling dann ja mit verbrannt hätten, zum anderen gab sie den Belagerten dessen reichliche Munition in die Hände, die umso erwünschter kam, als der Vorrat an Pulver und Blei schon bedenklich zusammengeschmolzen war.
Als die Rothäute ihren Führer in der Gewalt der Gegner und die Tür sofort wieder schließen sahen, erfasste sie ein so gewaltiger Grimm, dass sie sofort einen neuen Sturmlauf unternahmen.
Ihr Häuflein war aber schon gar zu arg zusammengegangen, und das heftige Feuer, das sie empfing, nötigte sie schon auf halbem Weg, wieder umzukehren.
Sie zogen sich nunmehr in recht raschem Tempo in den Busch zurück.
Inzwischen war es Abend geworden. Die Sonne stand bereits tief im Westen und warf ihre letzten Strahlen auf die Stätte des Kampfes.
Endlich konnten die schwer bedrängt Gewesenen etwas aufatmen, doch versäumten die Männer darüber nicht, ihre Büchsen zu untersuchen und die unverhofft erhaltene Munition des Häuptlings unter sich zu verteilen, um jeden Augenblick für einen etwaigen erneuten Angriff gerüstet zu sein.
Zu bewundern war Frau Schell, welche kurz zuvor über Übelkeit geklagt hatte, die Aufforderung der ihren, sich nach den gehabten Anstrengungen nun ein wenig Ruhe zu gönnen, aber energisch zurückwies. Im Gegenteil, sie verschwand in der Vorratskammer, aus der sie geschäftig das Beste, das dieselbe darbot, herbeischleppte, um den Männern Erfrischungen zuzuführen.
Während namentlich die Jungen wacker zugriffen, stimmte sie ein frommes Lied an, in das sofort auch die anderen und selbst der verwundete Franzl mit seinem hellen Tenor einfielen.
Dies wirkte auf sie alle dermaßen erhebend und ermutigend, dass sie die Müdigkeit, die ihnen die Aufregung und die ungewohnte blutige Arbeit verursacht hatten, vergaßen. Ja, die beiden Jüngsten verfielen in ihrer Freude über den Sieg nachher in eine förmliche Ausgelassenheit und johlten, lärmten und schrien, soviel ihre jungen Kehlen es vermochten. Angesteckt davon, fielen auch die beiden älteren Söhne in dieses Konzert nach Kräften ein.
Diese spontane unwillkürliche Äußerung aber erlöste die Familie, ohne dass sie darum wusste, endlich von aller Gefahr. Denn als Stunde um Stunde verrann und kein neuer Angriff erfolgte, entschloss sich Vater Schell, in Begleitung seines ältesten Sohnes zum nahen Busch zu schleichen. Es ergab sich, dass sowohl dort als auch in den angrenzenden Waldesteilen keine Rothaut mehr zu sehen war.
Was lag näher, als anzunehmen, dass das Schreien und Lärmen der Belagerten beim Feind die Befürchtung erregt habe, sie jubelten, weil Unterstützung aus dem Fort Dayton eingetroffen oder im Anzug sei. In der Tat hatten die Indianer den Lärm auf der Farm in diesem Sinne aufgefasst und sich dann schleunig aus dem Staub gemacht.
Als Vater Schell und sein Begleiter mit dieser Kunde in das Farmhaus zurückkehrte, brach der Jubel erst recht los.
Es bedurfte geraumer Zeit, ehe der erneute Freudenausbruch wieder kühler Besonnenheit Platz gemacht hatte. Dann aber hielt man großen Kriegsrat und kam überein, dass es am besten sein würde, zum Fort aufzubrechen, um dort den Rest der Nacht zu verbringen, zumal Franzl dringend der Hilfe eines Wundarztes bedurfte.
Man machte sich über den gefangenen Häuptling her, um ihn zu binden, fand aber, dass seine Verwundung eine so schwere war, dass ein Fluchtversuch ganz ausgeschlossen schien.
Man ließ ihn also ohne Fesseln liegen, ja einer der Jungen wurde sogar beauftragt, aus dem Stall Streu herbeizuholen und ihm ein weiches Lager aufzuschütten.
Vater Schell verriegelte sodann sorgsam alle Fenster und schloss die Eingangstür.
Man gab dem wenigen Vieh im Stall Wasser, warf ihm reichlich Futter vor und machte sich dann vorsichtig auf den Weg.
Im Fort Dayton angekommen, erregte die Schilderung der tapferen Tat dieser einfachen, anspruchslosen Bauernfamilie gerechte Bewunderung.
Hier stellte sich auch heraus, dass fast die ganze Farmerschaft des County auf das Alarmsignal in das Fort geeilt war, dass die zur Zeit sehr schwache Besatzung in der Folge gerade genug zu tun hatte, die Flüchtlinge und die nächstliegenden Farmen vor den Feuerbränden der umherstreifenden Indianerhaufen zu schützen.
Man hatte dann wohl den ganzen Rest des Tags über von fern her Flintenschüsse vernommen, doch erst spät sich der Schellschen Familie auf der entlegenen Farm erinnert.
Umso größer war die Freude und die Anerkennung, die man den längst Aufgegebenen jetzt entgegenbrachte.
*
Just um dieselbe Zeit, als die Huronen sich anschickten, der Schellschen Niederlassung sich zu nähern, befand sich auch Addy im Schellsbusch.
Der Jäger hatte nämlich, Unheil witternd, schon mehrere Tage und Nächte ganz in der Nähe im Wale gestreift, die Annäherung mehrerer Indianerhaufen dann sehr wohl bemerkt und diese auch rechtzeitig durch einen ihm begegnenden Grenzer nach Fort Dayton melden lassen. Als es ihm zuletzt zur Gewissheit wurde, dass die Indianer es auf die Schellsche Farm abgesehen hatten, zog er sich voll Ingrimm zurück, denn er musste sich sagen, dass er allein nicht imstande sei, dem ganzen Haufen entgegenzutreten. Er hoffte, dass der Kommandant des Forts so schnell wie möglich eine kleine Schützenabteilung senden würde und dann sollte ihn nichts mehr abhalten, mit diesen Mannschaften den Farmersleuten zu Hilfe zu eilen.
Der Jäger zog sich also unbemerkt in den Wald zurück, hinauf auf eine kleine Anhöhe, von wo er den Busch unten einigermaßen überblicken konnte.
Er hörte die ersten Schüsse und ahnte nicht, dass diese mit seinem zufällig des Weges gekommenen Freunde Franzl gewechselt wurden.
Dann gab es eine längere Pause, bis endlich ein regelrechtes Feuergefecht unten bei der Farm sich entwickelte.
Addy schloss daraus, dass es dem alten Schell mit seinen tatkräftigen Buben gelungen war, sich noch rechtzeitig in das Haus zurückzuziehen und dass er entschlossen sei, den Wilden Widerstand entgegenzusetzen. Aus dem Knall der verschiedenen Büchsen, davon ein Teil ihm, dem Jäger, entgegenschlug, dann aus dem wilden Zorngeheul der Indianer schloss er, dass es mit der Verteidigung der Farm vorläufig nicht schlecht stand.
Gleichwohl erwog er bereits den Gedanken, sich etwas näher an die Farm vorzuschleichen. Vielleicht ergab sich irgendein glücklicher Umstand, der ihm ermöglichte, dennoch entscheidend einzugreifen.
Schon spähte er als Mann der Vorsicht um sich, ob die nächste Umgebung auch vollkommen rein sei und schickte sich an, im Schutz des Waldes zu dem Busch abzusteigen, als plötzlich klägliches Kindergeschrei an sein Ohr schlug.
Blitzschnell verschwand er hinter einem Baumstamm und gewahrte dann, vorsichtig spähend, kaum hundert Schritte seitwärts, zwei Huronen durch den Wald schreiten, jeder einen kleinen hemdsärmligen Buben vor sich hertreibend, die beide zwar gewaltig schrien, aber durch Püffe und Schläge willfährig gemacht, mit ihren kurzen Beinchen tapfer waldeinwärts liefen.
Obwohl Addy die Angehörigen der Familie Schell nicht alle kannte, sagte er sich sofort, dass diese beiden Buben zu der Farm gehörten und durch irgendein Missgeschick in die Gewalt der Rothäute geraten seien.
Er selber aber, Addy, war durch diesen Vorgang in einen bösen Zwiespalt mit sich selbst geraten. Sollte er sein Vorhaben, sich der Farm zu nähern, nun noch ausführen und die beiden Knaben ihrem Schicksal überlassen? Lag nicht auch hier ein Gebot der Menschlichkeit vor, die beiden Kinder, die vielleicht die Augäpfel ihrer Mutter waren, den Rothäuten wieder abzunehmen? Was sollte er tun?
Nach klarer Erwägung musste er sich sagen, dass die Annäherung an die Farm, solange nicht Hilfe vom Fort kam, einen doch nur sehr fragwürdigen Erfolg haben könne. Wurmte es ihn auch gewaltig, den Farmersleuten nicht helfen zu können, so lag es für ihn unter den obwaltenden Umständen doch näher, sich vorerst der Kinder anzunehmen. War ihm gelungen, diese zu befreien, dann konnte er ja immer noch auf seinen zuvor gefassten Plan zurückgreifen. Vorläufig schien sich Vater Schell unten noch wacker zu halten.
Also erhob er sich und schlich den beiden Indianern nach, die mittlerweile die beiden Buben auf die Schultern gehoben hatten und nun mit großer Schnelligkeit immer tiefer in den Wald eilten.
Endlich an einer Stelle, wo das Erdreich sich schon wieder etwas senkte und aus der Ferne das Geräusch eines fließenden Gewässers hörbar wurde, machten sie Halt.
Addy war ihnen wie ein Schatten gefolgt und, soweit es die Vorsicht zuließ, ihnen ziemlich dicht auf den Fersen geblieben.
Nun duckte er sich noch mehr hinter die Baumstämme und ließ sich dann bald ganz auf den Boden nieder, von Busch zu Busch auf allen vieren vorkriechend.
Was Addy vorausgesetzt hatte, dass die beiden Rothäute sich an dem Gewässer durch einen Trunk laben würden, war eingetroffen.
Unten am Bach hockten sie, sich mit den hohlen Händen Wasser in den Mund schöpfend.
Die beiden Knaben standen daneben und die eine Rothaut war menschlich genug, auch den Kindern von dem Wasser anzubieten.
Der eine Junge schlürfte aus der hingehaltenen Hand lang und tief, sodass der Hurone noch ein zweites Mal Wasser schöpfte.
Der andere Knabe jedoch, als er die dunkle Hand so unmittelbar vor seinem Gesicht sah, fing mächtig an zu schreien, stieß sie zurück, machte kehrt und begann davonzulaufen.
Oben unter den Bäumen, keine dreißig Schritte von der Gruppe entfernt, lag Addy, seine Doppelflinte zum Schuss erhoben, hinter einem dicken Baumstamm.
Als er den Jungen unten davonlaufen sah und gewahrte, dass dieser die Richtung auf sein Versteck nahm, senkte Addy die Mündung seines Flintenlaufs.
Den beiden Rothäuten schien der Fluchtversuch des kleinen Kerlchens anfangs viel Spaß zu machen. Sie lachten und sahen dem kleinen Ausreißer grinsend nach.
Als der Junge aber hinter den Bäumen zu verschwinden begann, sprang die eine Rothaut auf und setzte hinter dem Flüchtling mit weiten Sprüngen drein.
Dieser Indianer, zumal in seiner Hast, konnte nicht bemerken, dass hinter einem Baum, an dem er unmittelbar vorüber musste, Addy lag und dass sich der Jäger mittlerweile erhoben hatte.
Als die Rothaut hier vorüberschoss, fühlte sie plötzlich eine eiserne Faust an ihrem Nacken. Ein fürchterlicher Faustschlag und der rote Mann stürzte bewusstlos zu Boden.
Flink zog Addy zwei Lederriemen aus seiner Jagdtasche hervor und in wenigen Augenblicken lag sein Opfer an Händen und Füßen gebunden.
Nun schlich sich der Jäger wieder zurück hinter den Baum.
Unten stand die andere Rothaut und wartete auf den Kameraden.
Allem Anschein nach etwas unruhig geworden, starrte der rote Mann unablässig hinauf zu dem Punkt, wo der andere kurz zuvor verschwunden war. Wahrscheinlich hatte der Mann unten von dem Geräusch vernommen, das der Fall des Kameraden oben verursacht hatte, wusste es sich aber offenbar nicht zu deuten.
Endlich schien ihm die Sache doch zu lange zu dauern. Er stieß einen scharfen gellenden Ruf aus. Als keine Antwort erfolgte, hob er den Jungen auf seine Schultern und kam ebenfalls die kleine Anhöhe herauf geschritten.
Wäre dieser Mann gleich dem anderen unmittelbar vor dem Baum vorübergekommen, hinter dem der Jäger stand, hätte sich das Schauspiel von zuvor wahrscheinlich wiederholt. So aber lag, als die Rothaut die Höhe erreicht hatte, immerhin eine Entfernung von mehreren Schritten zwischen ihr und Addy.
Wie ein Bombenschlag wirkte es auf den Mann, als der Jäger, mit dem Büchsenkolben an der Wange, plötzlich hinter dem Baum hervortrat und dem Indianer ein donnerndes Halt zurief.
Der noch junge Indianer fasste sich aber rasch wieder. Schnell warf er den Knaben wie ein Stückchen Holz von sich und die Hand des jungen Kriegers erfasste das im Gürtel steckende Kriegsbeil.
Da krachte des Jägers Flinte und lautlos brach der Hurone zusammen.
Dafür aber erhob sich weiter oben, tiefer im Wald, fast sofort ein klägliches Schreien und gleich darauf hob auch der Junge, der soeben von dem Indianer abgeworfen worden war, an, sich mit dem kräftigsten Jammergeheul bemerkbar zu machen.
Addy nickte befriedigt mit dem Haupt.
Wenn der Junge noch von solcher Lungenkraft war, dann konnte er durch den Fall keinen allzu großen Schaden erlitten haben.
Der Jäger lud zunächst den abgeschossenen Lauf seiner Flinte. Dann überzeugte er sich davon, dass der Kleine in der Tat im Vollbesitz seiner gesunden Glieder sich befand. Einige Hautschürfungen am Kopf und den Armen abgerechnet, war eine Verletzung nicht zu entdecken.
Nun begann Addy in der freundlichsten Art, deren der eckige, fast raue Mann fähig war, auf den Jungen einzureden, und er hatte die Genugtuung, dass sich der Kleine bald beruhigte. Auch das Geschrei tiefer im Wald war mittlerweile verstummt und als sie dann zusammen nach dem Brüderchen suchten, da kam der kleine tapfere Mann ihnen schon entgegen gestapft. Das Geschrei des zurückgebliebenen Bruders hatte ihn zur Umkehr veranlasst.
Nun nahm Addy die beiden kleinen Helden an den Händen und wanderte mit ihnen quer durch den Wald dem Schellsbusch zu.
Ab und zu blieb der Jäger stehen und verwies die beiden kleinen Plappermäuler, die nach und nach ganz lebhaft geworden waren, zur Ruhe. Dann hörte man wohl in weiter Ferne lebhaftes Schießen.
Wie gerne wäre Addy schneller vorangeeilt, sich von dem Stand des Kampfes unten an der Farm zu überzeugen. Aber er konnte doch die beiden kleinen Menschenkinder, die er an den Händen führte, nicht im Stich lassen.
So dauerte es geraume Weile, bis sie zu dem Punkt zurückgelangten, wo Addy die Entführung der beiden Knaben durch die Rothäute wahrgenommen hatte.
Als der Jäger endlich den Schellsbusch einigermaßen überblicken konnte, da überzeugte er sich, dass die Schießerei noch in vollem Gange war, dass dann aber plötzlich die Rothäute in schnellster Gangart dem Wald zu flüchteten.
Nun stand es für ihn fest, dass die Huronen den Kürzeren gezogen hatten, dass Hilfe aus dem Fort angekommen war und die Farm als gerettet betrachtet werden konnte.
Schnell lud er die beiden Knaben auf den Rücken und schlug sich seitlich in den Wald, den vom Busch herauftrabenden Rothäuten auszuweichen. Als er sich dann einigermaßen in Sicherheit fühlte, schlug er mit den beiden Knaben den Weg zum Fort Dayton ein.
Dort, nach langer Wanderung angekommen, standen die Gruppen der Menschen noch immer beisammen, die sich bei der Ankunft der Schellschen Familie gebildet hatten. Lebhaft schilderten die Söhne und der Vater den Soldaten und Farmersleuten die einzelnen Phasen des durchlebten Ereignisses. Nur Frau Schell, die sich nach den großen Erregungen und den fast übermenschlichen Anstrengungen des Tages nun recht müde fühlte, saß stilltraurig und in sich gekehrt etwas abseits. Sie trauerte um ihr Liebstes, um ihre beiden Buben.
Da öffnete sich plötzlich der Kreis der Soldaten, Männer und Frauen, und gleich darauf hingen zwei stramme, pausbäckige Knaben, die sich wie ein Ei dem anderen ähnlich sahen, hell aufjauchzend an ihrem Hals.
Die gute Frau, die sich heute als eine so kaltblütig tapfere erwiesen hatte, war im ersten Augenblick so heftig erschrocken, dass sie einen Schrei des Entsetzens ausstieß und gar ungläubig auf die beiden Blondköpfe nieder sah. Dann aber begannen die hellen Tränen aus ihren Augen zu tropfen und krampfhaft schluchzend umschloss sie liebend ihre beiden wiedergekehrten Sprösslinge.
Im Hintergrund stand Addy, sah auf die Szene nieder, und eine seltsame Rührung sprach aus seinen verwetterten, sonst so ruhigen, fast harten Gesichtszügen.
Als ob er sich dessen plötzlich bewusst würde und sich dieser Wallung schäme, vielleicht auch um dem Dank der beglückten Mutter zu entgehen, schlich er sich heimlich von dannen.
Schreibe einen Kommentar