Addy der Rifleman – Ernste Besorgnisse
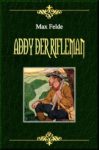 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Ernste Besorgnisse
General Herckheimer war in seine ebenerdig gelegene, einfach, doch wohnlich ausgestattete Arbeitsstube getreten, noch immer ein Lächeln auf den Lippen, denn das kleine Erlebnis mit den Buben hatte seiner kernhaften Soldatennatur vielen Spaß gemacht.
Er durchmaß geraume Weile mit langen Schritten das Gemach, langte dann seine Lieblingspfeife von einem Nagel an der Wand, füllte sie mit Tabak und entzündete den Inhalt.
Die Tür öffnete sich. Binche, die Haushälterin, trat ein. Sie brachte den Postbeutel.
Mit fast fieberhafter Ungeduld machte sich der General über denselben her, öffnete nacheinander etwa ein halbes Dutzend Briefe, durchflog ihren Inhalt. Unmutig schob er ein Schreiben nach dem anderen von sich.
Mit umwölkter Stirn trat er an das Fenster und starrte, mächtige Rauchwolken vor sich her blasend, gedankenvoll hinaus in die Landschaft, auf die saftig grünen Wiesen, auf die wogenden reifenden Getreidefelder. Hier und dort ragte der Giebel eines Farmhauses aus gut gepflegten Obstbaumgruppen hervor. Bläuliche Rauchwölkchen ringelten sich von den Dächern zum klaren Himmel empor; weit im Hintergrund ein Saum herrlicher, dichtbestandener Wälder.
Ein tiefer Seufzer entstieg der Brust des sinnenden Mannes. Von allen Seiten dräuten die Wetterwolken des Krieges, und hier vor seinen Augen ein liebliches Bild des Friedens, das Ergebnis jahrzehntelangen Ringens, der schwer errungene Besitzstand redlich arbeitender, nie ermüdender deutscher Bauern.
Er kannte und liebte diese fleißigen deutschen Ansiedler, und er kannte ihre Geschichte.
Es war schon über ein halbes Jahrhundert her, im Juli des Jahres 1722, als sich eine kleine Anzahl Pfälzer Familien erstmals in dieser ehemaligen Wildnis einfanden. Die um den Mohawk wohnenden Indianer zeigten sich auf Vermittlung der englischen Regierung geneigt, einen vierundzwanzig englische Meilen langen Landstrich abzutreten, ohne dass sie eine Gegenleistung forderten, weil sie, wie sie sagten, für ihre Bedürfnisse ohnehin Grund und Boden in Hülle und Fülle besäßen. Die Pfälzer besannen sich nicht lange und griffen sofort mit beiden Händen zu. Sie baten an maßgebender Stelle, dieses Land vermessen und unter sich aufteilen zu dürfen. Der englische Gouverneur Bournet, der die Deutschen, ihre Energie und Leistungsfähigkeit kannte, genehmigte die Bitte und verfügte, dass jede Person, gleichviel ob Mann, Frau oder Kind, hundert Acker erhalten solle. Nach dem darüber ausgestellten Bournetsfieldpatent machten davon vorläufig neununddreißig Familien Gebrauch. Diese kamen dadurch mit einem Schlag in ein verhältnismäßig sehr reiches Besitztum, denn rechnete man auf jede Häuslichkeit fünf Personen, und oft waren es deren noch mehr, dann hatten die Einwanderer also ohne jede Schwierigkeit je den Besitz von fünfhundert Acker erlangt, wozu auch noch die Benutzung der bewaldeten Höhen kam, von denen das Tal überall umschlossen war.
Rüstig gingen die neugebackenen Grundbesitzer an die Arbeit und verwandelten das Mohawktal durch ihren Fleiß bald in einen blühenden Garten, in dem überall fröhliches Gedeihen, Zufriedenheit und Auskommen, ja binnen kurzer Zeit sogar Wohlstand und Überfluss herrschte. Der Haupterwerbszweig der Ansiedler war und blieb der Landbau. Viele aber betrieben in der ruhigeren Jahreszeit nebenher mit den in der Nähe lebenden Indianern noch einen einträglichen Handel, denen sie gegen wertvolles Pelzwerk, Schusswaffen, Pulver und Blei und sonstige Bedürfnisse abließen.
Der wachsende Wohlstand zog in der Folge noch manche andere deutsche Emigrantengruppe an, die sich entweder im Tal selbst oder in den Nachbargebieten niederließ. Allgemach war dadurch ein förmlicher Gürtel von Ansiedlungen entstanden, der einerseits die weiter östlich gelegenen holländisch-englischen Niederlassungen umsäumte, sich aber westlich weit hinein mitten in das Indianergebiet erstreckte.
Die Willfährigkeit der englischen Regierung war nicht ohne Eigennutz. Ihr lag vielmehr ein wohlberechneter Plan zu Grunde: Die Deutschen, die nun gut zwei Drittel der Tallinie von Little Falls und German Flats (dem heutigen Herkimer, benannt nach General Herckheimer) bis Frankfort inne hatten, sollten für die eigenen, englischen Niederlassungen gegen das etwaige Andringen der Franzosen, mit denen sich die Briten in die Herrschaft über den damaligen amerikanischen Norden noch teilten, ebenso gegen die Indianer einen starken Schutzwall bilden.
Und in der Tat, dauernde Ruhe und behagliches Gedeihen sollte diesen ersten Ansiedlern nicht beschieden sein.
Inzwischen hatten nämlich die englischen Gouverneure die guten Beziehungen zu den Rothäuten arg vernachlässigt, und die fünf indianischen Nationen, die Huronen, Onondaga, Cayuga, Seneca und Oneida, welche damals die äußersten nördlichen und westlichen Breiten des Staates New York bewohnten, zeigten in der Folge eine bedenkliche Hinneigung zu den Franzosen, die ihre wilden Nachbarn und Bundesgenossen weitaus besser als die Briten zu behandeln wussten. Dazu kam noch das Bestreben der Engländer, den Handel, welchen die am St. Lorenz befindlichen französischen Stationen den Mohawk abwärts mit Albany lebhaft betrieben, nach Möglichkeit zu schmälern.
Dieses Rivalisieren der beiden Mächte führte schon 1744 zum Krieg und gipfelte in dem Bemühen, die fünf indianischen Stämme für sich zu gewinnen. Dadurch kam es allgemach dazu, dass die Rothäute bald von der einen, bald von der anderen Seite bestimmt wurden, den Kriegspfad zu betreten. Als das Kriegsbeil einmal ausgegraben war, kamen die grausamen Instinkte der Wilden bald zum vollen Ausbruch. Die Indianer kannten nur zu gut die Wohlhabenheit und den prächtigen Viehbestand der Bewohner des Mohawktals. Dieses reizte ihre Beutegier, und in der Folge musste mehr als einer der Deutschen nicht nur seine Kühe, sondern auch seine Kopfhaut lassen. Mit der Zeit stiegen die Kriegswirren, und mit ihnen war die Unsicherheit im ganzen Tal so groß geworden, dass die weit auseinanderliegenden Blockhäuser befestigt oder mindestens mit Schießscharten versehen werden mussten. Der bisher friedlich und nur der Bestellung seiner Äcker und Felder lebende Bauer war nun auch zum Kriegsmann geworden, ging und stand von da an nur noch mit der Büchse über der Schulter hinter seinem Pflug. Erst als die Pläne der Franzosen im Jahre 1759 endgültig zunichte gemacht wurden und England die Alleinherrschaft zufiel, da gab es für einige Zeit wieder Ruhe.
Nun war das englische Interesse das allein Maßgebende und die Bauern von Tryon County, welche die einstige Landschenkung nicht vergessen hatten, ordneten sich willig den neuen Verhältnissen unter. Die Verwaltung des mittlerweile neuernannten Gouverneurs Sir Wm. Johnson, der durch kluge Maßnahmen nach und nach auch die Indianer zur Vernunft zu bringen und für sich zu gewinnen wusste, war eine gute und trug viel dazu bei, wieder geordnete Zustände herbeizuführen.
Als aber dieser Gouverneur das Zeitliche segnete und das Gouvernement an seinen Sohn, den Obersten John Johnson, einen leidenschaftlichen und fanatischen Royalisten, überging, da vermehrten sich schon wieder die Missgriffe. Er begann nach einem System zu regieren, das den freiheitliebenden Bauern nicht gefallen konnte. Bald hatte die Unzufriedenheit gegen zahlreich eingetretene Bedrückungen nicht nur im Mohawktal, sondern auch in allen angrenzenden Distrikten breiten Fuß gefasst. Die Bauern beriefen zwar einige Kongresse ein, fassten Resolutionen, baten und verhandelten, doch es blieb alles beim Alten. Als dann aus Süd und Ost die Wogen der nahenden Revolution, welche nichts Geringeres als die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten erstrebte, bereits auch im Mohawktal fühlbar zu werden begannen, da machten die Mehrzahl der Farmer aus ihrer Gesinnung, dass sie der englischen Regierung mehr als gram waren, kein Hehl mehr. Das wusste Oberst Johnson und gedachte, den Bauern die Köpfe so bald wie möglich zurechtzusetzen, hatte er doch gegenüber den verhältnismäßig wenigen Ansiedlern leichtes Spiel, da die englische Regierung bereits mit aller Macht rüstete, die in den südlichen Kolonien bereits offen zum Ausdruck gelangte Rebellion mit einem Schlag niederzuwerfen. Schon war eine große Flotte unter Admiral Howe mit 40.000 Mann gelandet worden, die in drei Abteilungen in das Innere vordrang: General Clinton in die südlichen Provinzen, Howe in Pennsylvanien, General Bourgoyne in die nördlich und westlich vom Hudson liegenden Distrikte. Bereits hieß es entlang des Mohawktals, Johnson fühle durch den Vormarsch Bourgoynes Rückhalt genug und würde seine Kolonnen gar nicht erst abwarten, vielmehr mit verbündeten Indianern demnächst schon über die Niederlassungen hereinbrechen. Sicher war, dass er mit einzelnen im Tal wohnhaften Anhängern der englischen Sache heimliche Beziehungen unterhielt. Es wetterleuchtete also schon wieder. Besorgt sah der Bauer nach seinem Schießeisen und dem Munitionsbeutel.
Aber die bedrohten Ansiedler hatten sich aus den vorangegangenen Kriegswirren auch manche gute Lehre gezogen. Die oft weit voneinander wohnenden Farmer hatten nämlich längst aus sich heraus einen Sicherheitsausschuss gebildet, und der blieb schon auf die ersten bedenklichen Nachrichten hin nicht untätig. Um Haus und Hof zu schützen, bestand lange schon die Absicht, nötigenfalls auch als geschlossene Truppe dem Feind entgegentreten zu können. So organisierte man die vorhandenen Streitkräfte in vier Bataillone zu je zweihundert Mann, deren jedes durch einen Oberst kommandiert wurde. Die ganze Streitmacht aber unterstellte man dem kriegserprobten General Nikolaus Herckheimer. Er, der einfache, schlichte Mann, wurde schon während des französischen Krieges im Jahre 1758 in der Miliz von Schenectady infolge seiner Tapferkeit zum Leutnant ernannt und verteidigte dann ein und ein halbes Jahr lang das später nach ihm benannte Fort Herkimer gegen die Indianer und Franzosen. 1775 wurde er auf den Vorschlag des Sicherheitsausschusses vom Konvent des Staates New York zum Oberst des ersten Milizbataillons und schon ein Jahr darauf zum Brigadegeneral sämtlicher Milizen des Mohawktals ernannt.
Das alles gab ihm, dem Mann, der nun mit umwölkter Stirn aus dem Fenster seiner Arbeitsstube hinausblickte, viel zu denken. Er fühlte nur zu gut den Ernst der Lage und schwere Sorgen bedrückten sein Herz.
Plötzlich wurde er aus seinem Sinnen aufgeschreckt. Heftiges Hundegebell ließ sich vernehmen. Gleich darauf klang der Hufschlag eines Pferdes.
Der General hörte, wie dann draußen vor der Haustür sich eine sonore Männerstimme nach ihm erkundigte, worauf Binche erschien und den Obristleutnant Jakob Klock, Kommandant der ersten Milizkompanie, meldete.
Der General ging seinem Gast bis auf den Hausflur entgegen, wo sich die Herren freundlich begrüßten, dann in das Zimmer traten und dort Platz nahmen.
»Ist der Oneida schon bei Euch gewesen?«, war des Obristleutnants erste Frage.
»Ein Oneida? Ich weiß von nichts.«
»Es hieß, Addy wäre heute mit Tagesanbruch von einer größeren Jagdstreife zurückgekehrt und hätte eine Rothaut mitgebracht, die nach Euch verlange, wichtige Meldungen zu überbringen.«
»Das träfe sich gut. Es ist noch keine halbe Stunde her, dass ich nach Addy schickte. Dann wird er wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen und den Läufer mitbringen.«
»Das wäre mir lieb. Meine Zeit ist karg bemessen, und doch litt es mich auf diese Nachricht hin nicht länger zu Hause. Ich wollte hören, was sich zugetragen hat. Was gibt es sonst Neues? Habt Ihr gute Nachrichten erhalten?«
»Schlecht, sehr schlecht steht es. Von Norden her lauter Hiobsposten. Vom Süden nur Absagen.«
»Wir können also auf keine Truppen rechnen?«
»Es ist nicht entfernt daran zu denken. Es wird mir unter dem üblichen billigen Ausdruck des tiefsten Bedauerns mitgeteilt, dass Washington zurzeit keinen einzigen Mann, geschweige größere Truppenmassen entbehren könne. Es scheint, dass man im Kongress neuerdings wieder mit schweren Sorgen zu kämpfen hat.«
»Das alte Lied, die alte Leier.«
»Und dennoch kann man den Leuten keinen Vorwurf machen. Der Kongress meint es gut und redlich, er lässt es an Anstrengungen nicht fehlen; aber die Uneinigkeit des Südens gibt ihm noch immer mächtig zu schaffen. Die Partei der Loyalisten, die vom Losreißen der Kolonien nichts wissen will, bereitet immer wieder neue, fast unüberwindliche Schwierigkeiten. Die Gelder fließen nicht.«
»Und doch hieß es erst vor wenigen Monden, dass jetzt Geld genug vorhanden wäre.«
»Allerdings. Aber, Ihr wisst, Papiergeld, das vom Kongress selbst herausgegeben wurde. Es ist ebenso bezeichnend wie beklagenswert, dass diesem Geld selbst von den Republikanern wenig oder kein Vertrauen entgegengebracht wird, sodass es jetzt schon nahezu entwertet ist.«
»Aber man hat doch damals, als die Briten bei Princeton geschlagen wurden, wirklich große Mittel flüssig machen können!«
»Man hat jene Mittel in der Begeisterung über die damalige plötzliche Opferfreudigkeit weit überschätzt. Ihr vergesst, dass die Errichtung einer Nationalarmee von 88 Bataillonen Riesensummen verschlungen hat. Ich befürchte, es steht jetzt wieder bereits so schlimm, dass es Washington schwer werden wird, diese kaum errichtete Armee auf den Beinen zu erhalten.«
»Das wäre ein Unglück, ein großes Unglück!«
»Und es scheint leider nicht anders. Hier liegt ein Brief des Generals Schuyler, ein Schreiben, das eine einzige große Klage gegen den selbstsüchtigen Geist einzelner Staaten und gegen den verhängnisvollen Geldmangel bildet. Schuyler hat Berichte, dass es Washington bereits so gut wie an allem mangelt, dass ein ordentliches Paar Schuhe in seinem Lager bereits eine Seltenheit ist.«
»Dann wäre unsere Sache ja fast so gut wie verloren, dann ständen wir angesichts der englischen Truppenmassen unmittelbar vor dem Zusammenbruch!«
»Das fürchte ich nicht. Der Wagen ist schlecht geschmiert, aber er fährt doch. Washington wirft die Flinte so leicht nicht ins Korn. Er ist zäh, er wird aushalten. Er hat sich bisher trotz aller Schwierigkeiten noch immer zu halten gewusst.«
»Der Mann ist zu bewundern; der Schwierigkeiten wegen, die sich ihm entgegenstellen, doppelt zu bewundern!«
»Er ist ganz der Mann, wie wir ihn unter diesen misslichen Umständen brauchen. Er soll auch uns hier oben am Mohawk als leuchtendes Vorbild dienen. Kann man uns keine Unterstützung leihen, so müssen wir uns eben, so gut es geht, selber zu helfen suchen.«
»Das ist leichter gesagt als getan.«
»Und doch, es wird, es muss gehen. Unsere Miliz ist klein beisammen, aber gut. Wohin man kommt, überall Begeisterung für die große Sache, alles voll Kampfesmut.«
»Daran fehlt es allerdings nicht, aber – Ihr versteht mich – es gehört auch Pulver auf die Pfanne.«
»Wir werden mit den vorhandenen Mitteln gut haushalten, wir werden uns durchbeißen, so gut wir uns durchzubeißen vermögen. An Opferfreudigkeit hat es in schweren Zeiten entlang des Mohawk noch nie gefehlt. Das Notwendigste wird sicher beschafft werden. Vergesst nicht: Die Begeisterung tut viel, die Sorge um Haus und Hof tut alles.«
»Möchtet Ihr recht behalten. Will nur wünschen, dass Ihr kein Wort zu viel gesagt habt.«
»Ich bin kein Prophet, weit davon entfernt; aber ich bin erfüllt von dem, wovon ein Führer erfüllt sein muss: vom Vertrauen zu seinen Leuten. Wir verfügen über etwas, das uns die Menge zum guten Teil ersetzt, wir verfügen über einen kernigen deutschen Menschenschlag. Unsere Farmer sind ganze Männer, sie sind mutig und zäh; sie sind gute Schützen und von jung auf mit der Waffe wohlvertraut. Es sind nur eine Handvoll Leute, aber ich hoffe, es wird sich Großes mit ihnen ausführen lassen. Wenn wir nicht durch die Übermacht der britischen Söldnerheere einfach erdrückt werden, dann ist mir nicht bange, dann sollen die Englishmen einen harten Stein in dem Bissen vorfinden, der ihnen das Verschlucken sauer macht. Wer, wie unsere Bauern, mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch so vielem Ungemach getrotzt hat, die werden, denke ich, auch dem neuesten Gewittersturm zu trotzen wissen und ihn überdauern.«
In diesem Augenblick schlugen wieder die Hunde an. Kurze Zeit darauf erdröhnten wuchtige Schritte im Hausflur.
Schnell erhob sich der General, selber die Zimmertür zu öffnen.
Ein robust gebauter, hoher Dreißiger mit dunkelgebräunten, verwitterten Gesichtszügen erschien im Rahmen des Einganges. Auf seinem Kopf saß schiefgerückt ein breitrandiger, verschossener Filzhut. Der Oberkörper war bekleidet mit einem fransenbesetzten Jagdwams. Die Beine steckten in ledernen Kniehosen und hohen Leggings. An der Seite trug er eine Jagdtasche und ein Pulverhorn.
»Gott zum Gruß!«, sagte der Mann schlicht und einfach und streckte dem General die derbknochige Rechte entgegen, die dieser erfasste und kräftig schüttelte. »War unnötig, dass Ihr mich habt rufen lassen; wäre ganz von selbst gekommen.«
»Da muss es wohl etwas Wichtiges sein, Addy«, entgegnete der General, im Begriff, eine darauf sich beziehende Frage zu stellen. Er führte diese Absicht aber nicht aus, denn ein großer, im schönsten Ebenmaß gebauter Indianer betrat mit stummem Gruß das Zimmer.
»Ah, noch ein Besuch – hier haben wir ja auch den Oneida? … Bereits habe ich von Eurem gemeinsamen Eintreffen vernommen.«
»Ganz recht – hier bringe ich Euch den Flinken Biber, einen noch jungen Häuptling, aber schon hoch angesehen im Rat seines Stammes.«
Der General war zu dem Indianer getreten und auch der Obristleutnant hatte sich erhoben, den roten Mann zu begrüßen, der die wenigen schmeichelhaften Worte, welche die beiden Offiziere an ihn richteten, mit würdiger Gelassenheit, doch mit Höflichkeit entgegennahm.
»Welcher Ursache verdanke ich die Ehre des Besuches?«, fragte der General, indem er Stühle anbot, Addy zugleich einen stummen Wink gebend, Pfeifen und Tabak umherzureichen, die in einem kleinen Wandschränkchen bereitstanden.
»Trafen uns draußen im Wald, wo unsere Wege oftmals kreuzen. Diesmal jedoch nicht, wie mir scheinen will, aus bloßem blindem Zufall«, berichtete der Jäger, nachdem er dem Wunsch des Generals willfahrt und den Inhalt der eigenen Pfeife in Brand gesetzt hatte.
»Ihr seid auf der Jagd gewesen? Ihr hattet Glück?«
»Nicht der Rede wert und auch mein roter Freund hat seine Kugel noch im Lauf. Er war diesmal auf einer anderen Fährte.«
»Ihr erregt unser Interesse; lasst hören!«
»Nun, alle Welt weiß, dass wir einer bösen Zeit entgegengehen, dass die Englishmen Ernst machen. Bereits soll ein großer Heerhaufen im Norden gerüstet stehen, um hereinzubrechen über unsere Fluren und Felder.«
»Die Wetterwolken ballen sich allerdings immer dichter; doch man muss sich sagen, dass der Weg von der kanadischen Grenze bis herab zum Mohawk reichlich weit ist.«
»Er ist weit, zugegeben, aber das Unglück, sagt man, schreitet schnell. Eine Frage: Weiß man schon von den Plänen der Briten, weiß man, welchen Weg Bourgoyne nehmen wird?«
»Sicheres ist nicht bekannt, doch will mir scheinen, dass sein Vormarsch zunächst den östlichen Hudsondistrikten gilt. Eine unmittelbare Gefahr wäre für das Mohawktal dann also noch nicht vorhanden.«
»Und dennoch will mich bedünken, dass es höchste Zeit ist, auch hier allenthalben nach dem Rechten zu sehen. Wenn die britischen Heerhaufen auch noch weit weg sind, der Oneida hier kann Euch sagen, dass die Arme der englischen Generale bereits hereinreichen in die benachbarten Wälder.«
Die beiden Offiziere fuhren erschrocken auf und sahen betroffen und fragend auf den Indianer.
Dieser saß still und gelassen auf seinem Stuhl, seine Glutaugen dem Inhalt seiner Pfeife zugewendet, den er soeben entzündete. Mächtig paffend erhob er das scharfgeschnittene Angesicht, dicht umwallt von langsträhnigen schwarzen Haaren. Oben auf dem Scheitel waren sie zu einem bänderdurchflochtenen Schopf zusammengebunden, aus dem die drei Häuptlingsfedern steil emporragten. Das wilde Aussehen des Mannes wurde noch gehoben durch ein vorn offenes, mit allerlei seltsamen Figuren besticktes Jagdhemd aus Büffelleder. Seine Beine steckten in langen, reich mit Fransen verzierten Pantalons. Im Gürtel trug er das Jagdmesser und den Tomahawk, über seinen Knien lag die Büchse.
»Addy, mein weißer Bruder, sehr richtig sprechen«, versetzte, jedes Wort wägend und betonend, langsam der Häuptling. »Überall weiße Sendlinge auf den Wegen zu den Feuern der fünf Nationen.«
»Was wünschen die weißen Männer? Kann und will der Häuptling der Oneida das sagen?«, fragte der General. »Ich setze voraus, dass seine Zunge nicht etwa durch irgendwelche Versprechungen oder Rücksichten gebunden ist.«
Der Oneida machte auf die letztere Bemerkung eine abwehrende, fast verächtliche Gebärde und entgegnete: »Wenn mit weißen Freunden am Mohawk sprechen, dann Oneidazunge nie gebunden.«
»Das erkenne ich im Namen der weißen Männer vom Mohawk lebhaft und dankbar an. Unsere Krieger haben, wie das der Häuptling der Oneida wissen muss, die Freundschaft der Krieger seines Stammes von jeher zu schätzen gewusst und werden sie auch fürderhin in Ehren halten. Die Oneida hingegen wissen, dass sie gegebenen Falles auch auf die Freundschaftsdienste der Mohawkkrieger rechnen können.«
Der Häuptling nickte befriedigt mit dem federgeschmückten Haupt.
»Weiße Mohawkkrieger tapfer und gute Krieger, die Oneidakrieger sehr gut wissen: weiße Krieger vom Mohawk wahre und gute Freunde.«
»Da der Häuptling der Oneida dies anerkennt, darf man wohl auch dessen sicher sein, dass die weißen Sendlinge an den Feuern seines Stammes das nicht gefunden haben, was sie suchten?«
»Nicht finden.«
»Und darf man wissen, worin ihre Wünsche bestanden?«
»Die Bleichgesichter sind gekommen, die Oneida zu beschwatzen, dass sie Kriegstanz beginnen, dass Oneidakrieger weiße Skalpe holen an den Ufern des Mohawk.«
»Da haben wir die Bescherung!«, platzte der Obristleutnant voller Entrüstung los. »Es ist schmachvoll! Statt ritterlich Mann gegen Mann zu kämpfen, scheuen sich die Briten nicht, ihr weites Gewissen ganz offen zu zeigen, verschmähen es nicht, die wildesten Instinkte der roten Leute zu entfesseln und auf die weißen Ansiedler loszulassen.«
»Ruhig Blut!«, mahnte der General. »Eure Entrüstung ist ganz am Platz, doch Ihr werdet zugeben, dass sie uns nicht viel nützen kann. Wir müssen uns vielmehr mit den Tatsachen abfinden und von Stund an selbst der schlimmsten Gefahr kalten Blutes ins Auge sehen. Was sagte Rotjacke, der Sachem der Oneida, zu diesem Ansinnen?«
Der Flinke Biber richtete den Blick seiner dunklen Augen auf den Fragesteller, fast vorwurfsvoll.
»Kann der Häuptling der Mohawkkrieger sich die Antwort nicht selber geben? Haben weiße Krieger vom Mohawk schon einmal gesehen, dass der Büffel sich in einen räudigen Präriehund wandelt? Nie werden weiße Krieger erleben, dass aus einem Oneida ein Hurone wird!«
»Der Häuptling der Oneida scheint nur sehr schlechte Botschaften für uns bereit zu haben. Soll das, was er soeben gesagt hat, etwa heißen, dass die Huronen der englischen Verführung bereits erlegen sind?«
Der Flinke Biber vollführte mit Kopf und Händen eine bejahende Gebärde, und Addy, der Jäger, sagte ergänzend: »Die Huronen sind räudige Hunde, sie sehen nur auf ihren Vorteil. Sie sind zwar tapfere Krieger, aber sie folgen ohne Skrupel dem, der ihnen einen größeren Sündenlohn verspricht.«
»Und wie steht es mit den Seneca, den Cayuga und Onondaga? Weiß der Häuptling der Oneida zu sagen, ob auch diese drei Nationen den britischen Sendlingen ein offenes Ohr entgegengebracht haben?«
Der Oneida zuckte die Achseln und entgegnete: »Der Flinke Biber das nicht wissen. Er wird gehen, sich zu erkundigen.«
»Kann sich der Häuptling an den Feuern der Brüderstämme ohne Weiteres einfinden? Hat das, nachdem die Oneida den weißen Sendlingen eine Absage erteilt haben, nicht seine Bedenken?«
»Der Flinke Biber wird und muss gehen; die Onondaga, Seneca und Cayuga werden ihn nicht sehen.«
»Ich verstehe. Der Häuptling der Oneida wird die Dörfer umschleichen. Er hat auf ganz dieselbe Weise wohl auch die Huronen belauscht?«
Der Flinke Biber nickte stolz und selbstbewusst mit dem Kopf und sagte dann: »Rotjacke ist klug und vorsichtig. Er nicht nur die weißen Sendlinge der britischen Häuptlinge nach Hause schicken, er auch die besten Krieger als Späher entsenden. Die Oneida müssen wissen, was die Nachbarvölker beginnen werden.«
»Und hat der Häuptling der Oneida beobachten können, wie weit die Vorbereitungen der Huronen gediehen sind, um den Kriegspfad zu betreten?«
»Huronenkrieger wachsam und klug. Aber das Auge der Oneida durchdringt die Wände der Wigwams und die dichtesten Büsche. Der Flinke Biber sehen ganze Tonnen Feuerwasser, er sehen ganze Tonnen Pulver. Das genug. Nicht wissen, wann Kriegspfad betreten. Aber wenn Feuerwasser trinken, dann bald die Wälder durchheulen werden.«
Der General wusste genug, und es wäre wohl auch als zudringlich und unhöflich erschienen, noch weitere Fragen an die Rothaut zu richten. Er zwirbelte eine Weile gedankenvoll an seinem Schnurrbart und sagte dann: »Nun, dann ist es allerdings höchste Zeit, dass auch wir nach unseren Pulvertonnen sehen. Es beunruhigt mich, dass die Munitionssendung aus Albany noch nicht angekündigt ist.«
»Sollte sie der Sicherheit wegen nicht den Weg über das Schenectadytal nehmen?«, fragte der Obristleutnant. »Ihr selbst habt das angeordnet.«
»Der Umweg ist groß, das wohl. Der Transport könnte aber gleichwohl schon da sein. Es müssen ungesäumt einige verlässliche berittene Boten auf den Weg.«
»Diese Sache erscheint mir überaus wichtig«, warf Addy ein. »Man muss so schnell als möglich vorwärts machen. Zudem wird es gut sein, die Boten zu ermächtigen, auf allen Stationen die kräftigsten Gäule zu requirieren. General, wollt Ihr mich damit betrauen?«
»Das wäre das Beste, man könnte dann wohl am ruhigsten sein«, meinte Herckheimer. »Aber«, fügte er nach einigem Zögern und Sinnen hinzu, »für dich habe ich bereits nicht minder Wichtiges – bist du von Stund an frei? Oder hast du etwas vor?«
»Allerdings hatte ich etwas vor. Es sind erst heute einige Pelzhändler aus Albany eingetroffen. Die fürchten den Krieg und wollen, ehe das Wetter losbricht, dass ich sie zum Ontario hinüberführe.«
»Das träfe sich nicht übel. Gerade dahin wollte ich dich senden. Wenn die Briten bereits in den Wäldern der Rothäute herumschleichen, dann fürchte ich, dass uns die eine oder andere englische Kolonne bereits näher steht, als uns lieb ist. Wir wollen uns daher auf die gewöhnlichen Nachrichtenquellen nicht mehr allein verlassen, du sollst dich vielmehr selbst einmal umsehen im Norden. Du nimmst also außer deinen Pelzhändlern auch einige Grenzer mit; wählst selbst verlässliche, erfahrene Leute. Durch die kannst du mir, je nachdem es nötig wird, Nachrichten senden.«
Da reckte sich der Oneida-Häuptling von seinem Stuhl und wandte sich Addy zu: »Wenn es meinem weißen Bruder gefällt, dann mit ihm gehen, Flinker Biber sich nach den Dörfern der Onondaga begeben. Das fast derselbe Weg.«
»Natürlich, Oneida, dann gehen wir eine gute Strecke zusammen. Deine Spürnase, die jedes Bleichgesicht auf drei Meilen riecht, kann uns nur hochwillkommen sein.«
Der Indianer nahm die Schmeichelei gelassen hin. Der General lächelte.
»Nun, dann macht euch nur ungesäumt auf den Weg«, meinte der Letztere. »Wir aber, Obristleutnant, wollen sogleich alle Kommandanten zu einer Besprechung zusammenrufen, um talauf und talab dafür zu sorgen, dass auf das erste Alarmzeichen jeder Mann auf dem Posten ist, dass bis dahin die Haubitzen bereit stehen und die Futter- und Munitionsbeutel ausreichend gefüllt sind.«
Schreibe einen Kommentar