Der Spion – Kapitel 22
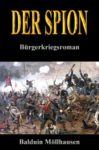 Balduin Möllhausen
Balduin Möllhausen
Der Spion
Roman aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, Suttgart 1893
Kapitel 22
Die Flucht
Den Aufenthalt auf der gastlichen Mission durfte Maurus nicht über zwei Tage hinaus ausdehnen, wollte er zu der ihm anberaumten Zeit in der Nachbarschaft von Kansas City bei seinem Regiment eintreffen, dessen Bewegungen von den in naher Aussicht stehenden Entscheidungsschlachten abhängig waren. Während dieser kurzen Frist waren sowohl er als auch Markolf in eifrigen Verkehr mit den auf der Station einquartierten Jägern und Fallenstellern getreten. Fünf oder sechs derselben erklärten sich denn auch bereit, gemeinschaftlich mit Kit Andrieux und den beiden Otoe Maurus zum Kansas hinunter zu begleiten. Alle folgten darin einer ihnen durch Andrieux übermittelten Aufforderung Kampbells, der ihnen für die zu leistenden Dienste eine entsprechende Entschädigung berechnete.
Lydia hatte sich in diesen beiden Tagen auf der Mission vollständig eingerichtet. Wohl beherrschte sie das Gefühl, ein freundliches und sicheres Asyl gefunden zu haben. Dem gegenüber aber stand das schmerzliche Bewusstsein, dass ihr Vater wieder neuen Gefahren entgegengehe. Die treue Fürsorge Mac Kinneys und seiner Gattin gereichte ihr sicher zum Trost, allein der Bann trüber Ahnungen, der auf ihrem Gemüt lastete, konnte dadurch nicht gehoben werden. In Daisy erblickte sie gewissermaßen eine Leidensgenossin und inniger schmiegte sie sich an die junge Halbindianerin an. Sie bewunderte deren ruhige Fassung, beneidete sie um ihre stille Ergebung und richtete sich an ihrem Beispiel auf, wenn Bangigkeit sie zu übermannen drohte. Zwar ruhte, seitdem die Trennung vom Geliebten beschlossen war, sanfte Schwermut auf den bräunlichen Zügen Daisys, doch nicht die leiseste Klage kam über ihre Lippen. Es war, als hätte sie mit der Kraft der Verzweiflung gerungen, nicht durch irgendwelche Kundgebungen der Trauer Markolfs ungestümen Mut, seinen unverwüstlichen Frohsinn zu umdüstern. Nur Frau Mac Kinney erblickte in ihrem Schweigen die beängstigenden Merkmale eines Grams, der, mochte er erklärlich und gerechtfertigt sein, gerade durch die gewaltsame Unterdrückung einen unheimlichen Charakter erhielt, von welchem alles zu fürchten war.
In der Frühe des dritten Tages nach Lydias Eintreffen bei ihren Verwandten war es, als die zu einer anstrengenden Reise gesattelten und ausgerüsteten Pferde der beiden Brüder von Nestor vor dem Missionshaus bereit gehalten wurden. Der Verabredung gemäß sollte der Abschied ein kurzer sein. Lydia und Maurus waren zuerst ins Freie hinausgetreten. Nachdem Erstere dem Captain einen Brief für ihren Vater ausgehändigt hatte, gab es noch manches, was sie ihm zur mündlichen Übermittlung anzuvertrauen wünschte.
»Sie werden ihn wiedersehen«, sprach sie mit erzwungener Fassung. »Sie werden in seine treuen Augen blicken, den Ton seiner Stimme hören, während ich selbst in der Ferne weile, um gewissermaßen an meinen Sorgen zu zehren. So sagen Sie ihm denn, in meiner Herzensangst flehte ich ihn an, sich, wenn auch nur um meinetwillen, zu schonen, nicht zu vergessen, dass ich im Fall seines Todes allein auf Erden stände …« Sie lauschte flüchtig auf das im Inneren des Hauses sich erhebende Geräusch, welches von der Annäherung der Freunde zeugte, und hastiger fuhr sie fort: »Doch auch an Sie richte ich diese Bitte. Versuchen Sie sich dem Leben zu erhalten. Sie besitzen Geschwister, ein süß klingendes Wort, welches ich nur in Beziehung zu anderen kennen lernte; Geschwister, die mit unendlicher Liebe an Ihnen hängen. Ich beobachtete es ja an Ihrem Bruder. Beteiligt er sich ebenfalls an einem gefährlichen Unternehmen, dessen Folgen nicht absehbar, so sind Sie der schutzbedürftigen Schwester gegenüber doppelt verpflichtet. Ich sage es, ohne Ihren Mut einschränken zu wollen, sich dem Leben zu erhalten. Doch auch um einer aufrichtigen Freundin, um meinetwillen, die ich von endloser Dankbarkeit gegen Sie erfüllt bin, sollten Sie ein wenig Rücksicht auf sich selbst walten lassen.« Mit dem letzten Wort reichte sie Maurus die Hand.
Einige Sekunden stand dieser betroffen. Ängstlich spähte er in Lydias von Tränen umflorte Augen. Er gewahrte, dass ihre Wangen tiefer erglühten, gleichviel ob über die sichtbare Wirkung ihrer Worte auf ihn, ob in dem Argwohn, in schmerzlicher Erregung zu viel gesagt zu haben, oder in der Besorgnis, missverstanden worden zu sein. Näher kamen die Stimmen der im Inneren des Hauses zögernd Einherschreitenden. Nur noch wenige Minuten, und den letzten Abschiedsgruß sandte er vom Sattel rückwärts. Da hob er Lydias Hand an seine Lippen.
»Ich gehe, wohin die Ehre mich ruft«, sprach er tief bewegt. »Ob ich je zurückkehre, ruht verborgen im Schoß der Zukunft. Sollte es mir aber beschieden sein, wie schon so viele, auch die wahrscheinlich letzten Kämpfe zu überleben, darf ich dann – ich frage nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen – noch einmal an unser heutiges Gespräch anknüpfen?«
Er fühlte, dass Lydias Hand in der seinen zitterte, sah, dass die liebliche Glut ihrer Wangen erlosch. Flehend klang seine Stimme, indem er vor Innigkeit gedämpft hinzufügte: »Das Freundschaftsband, welches sich während der gemeinsamen Erfahrungen zwischen uns webte, wie die letzten Minuten des Beisammenseins entschuldigen, rechtfertigen gewiss Worte, welche unter anderen Verhältnissen vermessen erscheinen müssten.«
Heftiger zitterte Lydias Hand. Auf ihrem guten Antlitz kämpfte es seltsam. Wie ersterbend blickten ihre Augen, indem sie zwei heiße Tränen über die nunmehr wieder erglühenden Wangen hinab sandten. Worte schwebten ihr auf den Lippen, allein die Stimme versagte ihr. Da traten Markolf und Daisy, gefolgt vom Missionar und seiner Familie, in die Haustür. Flüchtig sah Lydia zu ihnen hinüber, dann mit eigentümlicher wehvoller Ruhe in Maurus‘ ernste Augen. Zugleich breitete die Glut der Wangen sich über ihr ganzes Antlitz aus.
»Ich wiederhole«, sprach sie mit bebenden Lippen, »ich wiederhole es aus vollem Herzen im Augenblick des Scheidens, in welchem wir nicht wissen, wo das Wiedersehen liegt: Erhalten Sie sich auch um meinetwillen. Wollen Sie dann aber zu seiner Zeit an unser jetziges Gespräch anknüpfen, so tun Sie es. Gott schütze und beschirme Sie – um meinetwillen …« Sie vermochte vor tiefer Bewegung nicht fortzufahren.
»Des Himmels reichster Segen mag Ihnen beschieden sein«, antwortete Maurus ergriffen. Eine Empfindung, als ob auf schwindelnder Höhe das Auge nach einem Halt sucht, durchrieselte seine Gestalt. Noch einmal küsste er Lydias Hand. Sich straff emporrichtend, kehrte er sich den ihn umringenden Freunden zu.
Der nunmehr folgende Abschied vollzog sich mit einer gewissen Eile. Zu ihrer Befriedigung gewahrte Frau Mac Kinney, dass Daisy, für welche sie fürchtete, eine wunderbare Fassung bewahrte. Ihre Gesichtsfarbe hatte sich wohl ein wenig verändert und schwermütig blickten ihre Augen. Im Übrigen aber folgte sie in Haltung und Wesen dem Beispiel aller Anwesenden. Um ihre Lippen schwebte das gewohnte süße Lächeln, welches man als einen Ausdruck heimlich genährter freundlicher Hoffnungen hätte bezeichnen mögen.
Die Brüder schwangen sich in den Sattel.
»Auf Wiedersehen!«, schallte es immer wieder herüber und hinüber. Als die Stimmen den wachsenden Zwischenraum nicht mehr übertönten, da übertrug man die letzten Grüße geschwungenen Tüchern und Hüten.
Eine halbe Stunde später standen die Bewohner der Mission auf dem Rand des Abhangs, um die Scheidenden unten auf dem Weg vorüberreiten zu sehen. Nur Daisy fehlte. Zu ihrer Warte hatte sie sich begeben. Von dort aus überwachte sie die Reiter, mit der flatternden Scharlachdecke ihnen immer wieder ihr banges Lebewohl nachsendend. Erst nachdem sie aus ihrem Gesichtskreis gewichen waren, ließ sie sich auf den gewohnten Sitz nieder. Ihr Antlitz hatte sich eigentümlich verhärtet. Starr blickten die dunklen Augen ins Leere vor dem Eifer, mit welchem ihr junger Geist arbeitete. Erst um die Mittagszeit kehrte sie zur Mission zurück. Anstatt aber, wie man befürchtete, die Einsamkeit zu suchen, um sich ungestört dem in ihr tragenden Jammer hinzugeben, begegnete sie allen freundlich und beredsam, mochte es immerhin in der tiefsten Tiefe ihrer Augen wie verhaltenes Leid glühen. Eine andere Beruhigung gewahrte, dass sie sich Lydia zärtlich anschloss und, sie aufmerksam bedienend, fast ununterbrochen an deren Seite blieb.
So verstrich der erste Tag, so verstrich der zweite. Als man aber am dritten in der Frühe nach ihr rief, war sie verschwunden. Die Nacht hatte sie nicht mehr auf ihrem Lager verbracht. Wie es ihr gelungen war, unter den sie fortgesetzt liebevoll überwachenden Augen zu entkommen, erschien geradezu unbegreiflich.
Das Ärgste befürchtend, hatte wahres Entsetzen sowohl Lydia als auch die Familie des Missionars ergriffen. Boten wurden in der ersten Bestürzung in alle Richtungen entsendet. Alle kehrten zurück, ohne auch nur die leiseste Spur von ihr entdeckt zu haben. Erst folgenden Tages geriet man auf den Gedanken, in den benachbarten Indianerdörfern Nachforschungen nach ihr anzustellen. Das Dorf der Pawnee war das abgelegenste. Einen vollen Tag brauchte der berittene Bote, um dasselbe zu erreichen. Dort, wo die Verwandten ihrer verstorbenen Mutter lebten, erfuhr er, dass Daisy nach mühevoller nächtlicher Wanderung in der Frühe des vorhergehenden Tages vollständig erschöpft eingetroffen sei. Anstatt zu rasten, hatte sie von ihren Verwandten eines der zähesten und ausdauerndsten Pferde gesattelt und aufgezäumt erbeten. Gern wurde es ihr überlassen, zumal sie sich auf einen bösen Traum berief, der sie in ihrem Entschluss bestimmt habe. Das lange Kleid vertauschte sie darauf mit einem mehr für den Sattel berechneten faltenlosen indianischen Rock und einer weiten Kattunjacke. So bestieg sie das Pferd, mit dessen Führung sie schon im zartesten Jugendalter vertraut geworden war. Hinter dem Sattel hatte man einen Ledersack mit ausgekörntem Mais befestigt, vorn am Sattelknopf dagegen einen Beutel mit den notdürftigsten Lebensmitteln für sie selbst. Die Scharlachdecke über ihren Schoß werfend, war sie ohne ein weiteres Wort der Erklärung in scharfer Gangart davongeritten. Niemand wusste, wohin sie sich wendete, niemand befragte sie um ihr Ziel. Es genügte, zu wissen, dass sie einem durch Träume erzeugten Zauber folgte. Gebahnte Wege lagen nicht vor ihr. Trotzdem verriet sie keinen Zweifel über die innezuhaltende Richtung. Sie glich einem Zugvogel, der, seinem Instinkt folgend, über hunderte von Meilen hinweg unbeirrt die bestimmte Bahn hält. Auf die Frage, weshalb man sie nicht zurückgehalten habe, erfolgte die geheimnisvoll erteilte Antwort, dass den Eingebungen eines Traumes nicht zuwidergehandelt werden dürfe.
Auf der Mission hatte Daisys Flucht tiefe Trauer hervorgerufen, und in umso höherem Grad, weil man die Unmöglichkeit einsah, ihrer wieder habhaft zu werden. Wohl ahnte man, wohin sie sich gewendet habe, begriff aber zugleich, dass es vergebliche Mühe sein würde, bei dem großen Vorsprung, welchen sie notgedrungen haben musste, sie noch einholen zu wollen. Man konnte sich daher nur mit der Hoffnung bescheiden, sie eines Tages ebenso unerwartet wieder erscheinen zu sehen, wie sie verschwunden war. Für ihre Sicherheit fürchtete man weniger. Was sie im frühen Kindesalter erlernte, den Körper stählend gewissermaßen in ihr Fleisch und Blut übergegangen war, das müsste ihr auch heute noch zustattenkommen. Wer ihr aber begegnete, wer ihre Not, ihre Angst, wohl gar ihre Todesmattigkeit erkannte, der war gewiss gern bereit, sich ihrer zu erbarmen, ihr die Rückkehr zu den um sie trauernden Freunden und Beschützern zu ermöglichen, zu erleichtern. Die Sorgen um die Entflohene wuchsen aber noch, als nach lang anhaltender Dürre am vierten Tage die Wärme des sogenannten Indianersommers sich zur Bruthitze steigerte, die Atmosphäre wie mit Höhenrauch erfüllt erschien, endlich ringsum schweres Gewölk dem Horizont entquoll und binnen kurzer Frist eintönige Dunstschichten den Himmel undurchdringlich verschleierten. Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit war eines jener schweren Gewitter im Anzug, wie solche in ihrer seltenen Wiederholung umso heftiger auftreten. Bangen Herzens beschäftigte man sich mit Daisy. Wo mochte die Ärmste zurzeit weilen? Wo Schutz und Obdach finden, wenn das Unwetter sie im Freien überraschte? Wie aber mochte bei der angeborenen Furcht vor Gewittern Entsetzen sie erfüllen, wenn der Donner ihre Ohren betäubte, leuchtende Blitze ihre Augen blendeten.
*
Daisy dagegen? Was kümmerten sie jetzt noch die bedrohlichen Anzeichen? Was galten ihr auf der Flucht Regenstürme und von Flammen begleitete Wetterschläge? Sie hatte in den vier Tagen auf ihrem erprobten Renner weite Räume durchmessen. Anfänglich bedachtsam lange Zickzacklinien schlagend, war sie mit gemäßigter Eile von der Stelle gekommen. Sobald sie aber auf die unzweideutigen Fährten der südwärts ziehenden Männer geriet, beschleunigte sie ihren Ritt bis aufs äußerste Maß. Wo bei dem rastlosen Einherstürmen die Spuren verloren gingen, da stand der wunderbare, von ihren braunen Vorfahren ererbte Scharfsinn ihr zur Seite, dass ein Blick auf die im Charakter wechselnden öden Landschaften sie über die Richtung belehrte, welche berittene Reisende nur gewählt haben konnten. Immer wieder gelangte sie auf die ihr den Weg zu ihrem Ziel weisenden Fährten.
So eilte sie einher von Tagesanbruch, bis die Sonne ihr nicht mehr leuchtete, nur dann an diesem oder jenem Rinnsal rastend, wenn die Sorge um das Pferd sie dazu zwang. Ein frischer Trank, eine Stunde der Rast auf grasreicher Fläche, und fort ging es wieder, als sei ein Versäumnis von den weittragendsten Folgen einzuholen gewesen. Ob ebener Prärieboden vor ihr lag, ob zerrissenes Hochland oder in der Nähe des Stroms an Tiefe gewinnende Bäche: Vorwärts, vorwärts stand ihr Sinn, nach vorn richteten sich ihre beinahe starren Blicke, als hätte sie die Fähigkeit besessen, mittels derselben dem Pferd eine gangbare Bahn zu brechen. Vorwärts mit nur selten verminderter Hast! Fort durch Schluchten und auf schroffen Abhängen! Fort durch Gewässer, welche der erprobte Renner schwimmend kreuzte. Fort durch Waldungen und Haine und über gefährliche Moore hin. Wo ihr selbst die Prüfung des vor ihr liegenden Bodens unmöglich war, da fand das Pferd seinen Weg, ähnlich einem auf der Flucht vor dem es verfolgenden Jäger befindlichen Wild. Sicher trug es seine leichte Last über alle Hindernisse hinweg, als ob es Verständnis für die Empfindungen seiner Reiterin besessen, wie sie sein Leben als Preis für das Erreichen eines bestimmten Ziels eingesetzt hätte, wenn auch nur, um angesichts desselben mit einem letzten Todesseufzer zusammenzubrechen. Die ihm des Abends nach zurückgelegtem Lauf und in der Frühe vor Antritt desselben von schlanken Händen gereichten Maiskörner schienen noch eine besondere Zauberkraft in sich zu bergen, dass es sich immer wieder aufraffte. Die Scharlachdecke um die Schultern, den Rücken an einen Baumstamm oder eine Unebenheit des Bodens gelehnt, verbrachte sie selbst die wenigen Stunden der Rast in Halbschlaf. Während das Pferd, von ihr an langer Leine gehalten, in der Nähe zwischen Kraut und Gräsern seine erträgliche Nahrung fand, genügten ihr einige Bissen gedörrten Fleisches und ein Trunk aus klarem Bach. Befand sich der schlanke, zerschlagene Körper aber erst wieder im Sattel, dann kümmerten sie die Leiden nicht, welche ihr aus der heftigen Bewegung erwuchsen. Sie konnte alles ertragen, wenn nur die Meilen unter ihr gleichsam fortflogen. Ob beim Hindurchdringen durch Haine und Waldstreifen Zweige ihr flatterndes Haar gierig packten und ihr Antlitz peitschten, mit Dornen besetzte Ranken ihre Bekleidung zerrissen und die nur dürftig geschützten Glieder ritzten, dass das helle Blut an ihnen niederrieselte: Was fragte sie nach solchen Schmerzen? Was fragte sie nach einigen Tropfen Blut? Ihr Herz bereitete neues und erhielt sich dadurch warm und regsam, dass es in seiner Beängstigung nicht brach und stillstand.
Weiter und immer weiter trug sie das zähe, ausdauernde Tier, weiter an besäten Gefilden und abwärts versteckt liegenden Blockhütten vorbei. Wo aber Merkmale von der Nähe von Menschen in ihrem Gesichtskreis auftauchten, da spähte sie argwöhnisch um sich. Schärfer trieb sie das Pferd an und Umwege beschrieb sie in der unbestimmten Furcht, aufgehalten und zu ihren Freunden aus der Mission zurückgebracht zu werden.
So war Tag auf Tag hingegangen. Fahler wurde die Farbe ihrer Wangen, matter der Glanz ihrer Augen, schlaffer ihre Haltung. Nach einem bezeichnenden Ausdruck hätte man in dem vor Kurzem noch in üppiger Jugendfrische blühenden lieblichen Antlitz vergebens gesucht. Es erinnerte vielmehr an das Bild einer Schlaftrunkenen, die traumbefangen ihre Bewegungen ausführt. Und doch entging ihren Blicken nichts, was in irgendeiner Weise fördernd oder hemmend auf ihre Flucht hätte einwirken können. Sie erspähte die Gelegenheiten durch Abschneiden von Winkeln ihren Weg abzukürzen oder ihren Renner weiter ausgreifen lassen zu dürfen. Sie sah aber auch endlich, dass die Sonne ihr Antlitz verhüllte und düsteres Gewölk einen Kampf der Elemente verkündete. Das Pferd schäumte unter der drückenden Glut. Große Schweißtropfen perlten auf Daisys Stirn. Wie die Zeit berechnend, binnen welcher das Unwetter auf sie hereinbrechen sollte, spähte sie um sich. Abwechselnd ruhten ihre unsteten Blicke auf den von Staub und Grasteilen gebildeten geisterhaften Säulen, die von den dem Sturm vorauseilenden Wirbelwinden hoch emporgedreht wurden, dann wieder stumpf auf den Baumwipfeln, wenn sie hier und da vor einer verirrten heftigen Luftströmung sich neigten, um bald wieder in ihre Regungslosigkeit zurückzusinken. Stumpf auch auf dem schwarzen Gewölk, welches, einen unheimlichen, finsteren Kragen voraussendend, sich dem Zenit näherte. Nur wenn ein Blitz aus demselben hervorzuckte, schloss sie wie geblendet die Augen. Tiefer beugte sie den schlanken Nacken, wenn dumpfe Schläge ihr Ohr erreichten, gefolgt von lange anhaltendem Rollen und Grollen. Es mochten zu solcher Zeit in ihrer Erinnerung die Erklärungen der weisen braunen Männer erwachen, welche in dem Gewitter das Zürnen des großen guten Geistes erkannten, Lehren, welche selbst durch die liebevollen Einflüsse des Missionars und seiner Gattin nicht ganz hatten verwischt werden können und sie daher jetzt mit Schrecken erfüllten. Doch stärker als diese Schrecken war der unwiderstehliche Trieb, der in ihrem fieberhaft pochenden Herzen lebte, stärker die Sehnsucht, welche das erhitzte Blut durch die Adern jagte.
Sie befand sich auf einer baumlosen Wiesenniederung, als der erste Windstoß sie mit einer Gewalt traf, dass sie sich kaum im Sattel zu halten vermochte. Ängstlichen Blickes maß sie die Entfernung bis zum nächsten Hain. Eine Viertelstunde scharfen Reitens betrug es bis dahin. Ein greller Blitz, der in Form einer Säule beinahe eine Sekunde lang Himmel und Erde miteinander vereinigte, scheuchte sie aus ihrem Berechnen auf. Dann folgte betäubendes Krachen und Knattern. Zugleich fühlte sie die ersten schweren Regentropfen. Sie hielt das Pferd an.
Die Scharlachdecke vor sich vom Sattel nehmend, schlang sie dieselbe um die Schultern. Mittels einer Drahtnestel befestigte sie das obere Ende unterhalb des Kinns, worauf sie das untere mit einem Riemen um ihre Hüften fest zusammenschnürte. Dann trieb sie das Pferd wieder an, dass es in einen gestreckten Galopp verfiel. Es war ein Rennen auf Leben und Tod. Das Pferd keuchte, gepresst entwand der Atem sich Daisys Brust; aber ihre Lebenskraft schien unerschöpflich zu sein. Immer wieder traf sie mit der geschwungenen zusammengerollten Leine die Weichen des Pferdes. Den Sturm im Rücken, war es, als ob beide von ihm davongetragen worden wären. Der Regen prasselte in Strömen auf sie nieder. Durch schwarzgraue Wände wurde die Fernsicht auf einen geringen Umkreis begrenzt. Vom Wind voraus gejagt, peitschte das lang flatternde feuchte Haar das in geisterhafter Ruhe verharrende bräunliche Antlitz. Wasserschwer schmiegten Kleidung und Decke sich an die gemarterten schlanken Glieder an. Hoch auf spritzte das auf dem ausgedörrten Erdboden sich ansammelnde Wasser unter den flüchtigen Hufen. Doch vorwärts ging es unermüdlich mit dem Wind um die Wette, weiter auf Leben und Tod mit dem Mut der Verzweiflung, mit qualvoll zuckendem Herzen. Länger stützten die bläulich leuchtenden Feuersäulen den niedrig hängenden Himmel, lauter krachten die Wetterschläge und in kürzeren Pausen aus dem unablässigen Rollen hervor. Matter wurden die Bewegungen des Pferdes und tiefer neigte die jugendliche Reiterin ihr Haupt über die flatternde Mähne hin. Der ersehnte, Schutz verheißende Hain war hinter der Regenwand verschwunden. Die Erde schien ihn verschlungen zu haben. Endlich tauchte er wieder, einem düsteren Schatten ähnlich, aus dem eintönigen Grau hervor. Mit dem Keuchen des Pferdes einte sich heftiges Schnauben. Noch einige lange Sätze, und das vom Sturm unheulte Gehölz nahm Ross und Reiterin in sich auf. Eine kurze Strecke nur drang Daisy in dasselbe ein, nur so weit, bis die zwischen Bäumen und Buschwerk sich brechende Luftströmung sie nicht mehr fand. Dort glitt sie vom Sattel. Todesmatt, das Pferd am Zügel führend, suchte sie eine Stätte auf, die ihr ein wenig mehr Schutz versprach. Einen mächtigen Baumstamm mit dicht verzweigtem Wipfel wählte sie zum Obdach. Nachdem sie die Leine des abgezäumten Pferdes um den Stamm geschlungen hatte, ließ sie sich hart an dessen Fuß nieder. Die triefende Decke über das Haupt gezogen, neigte sie dasselbe auf die von den Armen umschlungenen emporgezogenen Knie, um, was nun auch kommen mochte, stumm und ohne Klage über sich ergehen zu lassen. Ein neuer Tag musste ja heraufziehen. Der Sturm musste sich endlich austoben, er konnte nicht ewig dauern. Und wie sie, verharrte auch das Pferd ohne Bewegung, nur seine Seiten schlugen mächtig. Bis zur äußersten Grenze abgetrieben und erschöpft, galt es ihm nur allein, die erhitzten Lungen zur Ruhe gelangen zu lassen.
Das Unwetter dagegen schien kein Ende nehmen zu wollen. Indem die Nacht hereinbrach und die Blitze an Leuchtkraft gewannen, erzeugte es den Eindruck, als habe es seine Wut verdoppelt. Schlag folgte auf Schlag.
In elektrischem Feuer schwamm gleichsam die verdichtete Atmosphäre Die Bäume ächzten und stöhnten. Heulend und brausend fuhr der Wind durch die schwankenden Wipfel, dass sie die kaum in Empfang genommene Wasserlast bald wieder abschüttelten. Hin und wieder krachte und splitterte es auch, wenn es dem unwiderstehlichen Luftdruck gelungen war, einen Stamm zu entwurzeln oder morsches Geäst aus den Wipfeln herauszubrechen und zur Erde zu senden.
Unter der erkältenden Nässe zitterte das Pferd. Fröstelnd kauerte Daisy sich enger zusammen. Schauder auf Schauder erschütterte die sonst so geschmeidige Gestalt. Entsetzen und körperliche Qualen einten sich, um des armen gemarterten Herzens Schlag bis zum Ersticken zu beschleunigen. Wie war die Nacht doch so lang, die Atmosphäre so schwarz und doch wieder so blendend hell!
Eine Stunde verrann noch im wilden Aufruhr der empörten Elemente. Dann wurden die Wetterschläge matter. Gedämpfter und hohler grollte der abwärts eilende Donner. Das Wetterleuchten dagegen und das Strömen des Regens erlitten keine Abschwächung oder Unterbrechung. Jenes sah Daisy nicht, während dieser keinen Eindruck mehr auf die unter der triefenden Decke Verborgene ausübte. Aber als habe das mehr und mehr schwindende Donnern eine einschläfernde Wirkung besessen, senkte Müdigkeit sich auf ihre Augenlider. Wärme entwickelte sich unter der feuchten, dicht geschlossenen Hülle. Kurze Zeit wehrten der zerschlagene Körper und der gefolterte Geist sich noch, dann umfing wohltätige Bewusstlosigkeit ihre Sinne. Sie war eingeschlafen. Freundliche Träume mochten sich in ihren Schlummer eingeschlichen haben, dass sie so still dasaß. Das Pferd hatte begonnen, an den in seinem Bereich herunterragenden Zweigen zu nagen.
Schreibe einen Kommentar