Felsenherz der Trapper – Teil 9.2
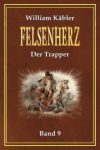 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 9
Die belagerte Hazienda
Zweites Kapitel
Die List des blonden Trappers
In derselben kleinen Lichtung, wo in der verflossenen Nacht die Vaqueros gelagert hatten, saßen am Morgen acht Apachen mit unterschlagenen Beinen in einem Halbkreis um den Eingang eines ledernen Jagdzeltes herum, das für den Großen Bär, den Oberhäuptling der Apachenstämme, errichtet worden war.
Die acht Rothäute waren die ältesten und erfahrensten Leute der fünfhundert Mann starken Abteilung, mit der der Große Bär vor zwei Wochen die Dörfer der Apachen verlassen hatte, um durch einen kühnen Raubzug zu den texanischen Ansiedlungen seinen Kriegern Pulver, Blei und die am meisten begehrten Büchsen zu verschaffen.
Damals waren die westlichen Indianerstämme Nordamerikas zumeist noch mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Die Schusswaffen, die sie besaßen, waren schlechte Steinschlossflinten. Nur wenige hatten neuere Gewehre mit Zündhütchen, die ja weit sicherer schossen als die sogenannten Indianerflinten, die den Rothäuten von gewinnsüchtigen Händlern angeboten wurden.
Vor dem Zelt saß auch der Große Bär, ein riesiger, wirklich bärenstarker Indianer, dessen narbenreicher Oberleib und mit den Kriegsfarben bemaltes Gesicht ihn noch wilder und furchtbarer erscheinen ließen.
»Meine roten Brüder haben abermals erkannt«, sagte er mit unheilverkündender Ruhe, »dass Felsenherz und Chokariga wie der Wind sind, der uns durch die Finger streicht und der sich nicht fassen lässt. Droben in den Gila-Bergen sind sie uns bereits einmal entkommen. Ihre Pferde und Chokarigas Waffen mussten sie zurücklassen. Meine jungen Krieger haben ihre Fährte gesucht und hatten sie auch gefunden. Ein Bote meldete nur vor drei Tagen, gerade als wir die den Bleichgesichtern geraubte Rinderherde auf Flößen über den Rio Grande schafften, dass die beiden zu Fuß gen Westen wanderten, ihre Spuren aber stets sorgfältig verwischten. Wir haben dann schnell das für den Kriegszug gegen die Ansiedlungen nötige Fleisch gewonnen, das uns die Rinderherde bequemer gab als eine Büffeljagd, zu der uns Pulver und Blei fehlten. Hier gelang es uns, Felsenherz und Chokariga einzukreisen, nachdem noch der Fliegende Pfeil mit zweihundert Kriegern wieder zu uns gestoßen war. Wirr wussten, dass der Hund von einem Comanchen und der blonde Trapper dort nördlich lagerten, und wir hatten unsere Krieger so verteilt, dass die beiden uns nicht entrinnen konnten. Wir waren hinter ihnen, als sie, durch den Schein des Lagerfeuers der sechs Vaqueros angelockt, hierher schlichen. Wir haben die Vaqueros bis zum Hügel dort drüben flüchten lassen, um Chokariga und Felsenherz desto sicherer zu fangen, denn auch der Hügel war bereits umstellt. Und trotz alledem sind sie jetzt verschwunden. Nur Felfenherz’ Büchse fiel uns in die Hände.
Der Große Bär hat selbst in der Nacht den Hügel umschlichen. Dort befinden die beiden sich nicht. Meine roten Brüder, denen bereits der Schnee des Alters die Skalplocke gefärbt hat, mögen mir helfen, die Entflohenen irgendwo zu entdecken. Der Große Bär gibt zu, dass er nicht begreift, wo sie sich verborgen halten können. Sie haben diese Büsche nicht verlassen und doch sind sie verschwunden wie die feigen Krähen, die vor dem Adler in die Wolken flüchten.«
Der älteste Krieger erklärte nun: »Der Große Bär hat nichts versäumt, um den beiden jeden Fluchtweg abzuschneiden. Selbst der Bach war oberhalb und unterhalb dieser Büsche durch zwei Ketten unserer jungen Männer abgesperrt, sodass jene selbst schwimmend und tauchend nicht fliehen konnten. Den Großen Bär trifft keine Schuld, wenn die beiden schlimmsten Feinde der Apachen abermals entwichen sind. Sie müssen sich durch die Linie unserer Krieger in der Prärie hindurchgewunden haben wie die Klapperschlange, die blitzschnell zwischen den Steinen durchschlüpft, wenn sie sich bedrängt sieht. Der Große Bär möge die ganze Umgegend sofort nach Spuren zweier Männer zu Fuß absuchen lassen. Felsenherz und Chokariga können in der Nacht ihre Fährte nur schlecht verwischt haben.«
Auch die anderen Stammesältesten gaben denselben Rat.
So geschah es denn, dass die sechs Vaqueros auf ihrem Hügel nun Zeugen wurden, wie sämtliche Apachenkrieger die ganze Umgegend bis zum Abend unermüdlich nach allen Richtungen hin durchstreiften und nach Sonnenuntergang die einzelnen Trupps teilweise aus weiter Ferne zurückkehrten und den Hügel wieder einkreisten.
»Sie haben Felsenherz und den Comanchenhäuptling gesucht«, sagte Sancho, der Indsmenfresser, zu Benito, der dicht neben ihm lag.
Der alte Vaquero schüttelte wie verwundert den Kopf. »Ich verstehe nicht, wohin sie geflüchtet sein können. Die Rothäute sind ja in solcher Zahl hier auf dem Kriegspfad, dass sie doch fraglos uns in der Nacht schon völlig eingekreist hatten. Felsenherz muss dies gewusst haben. Daher befahl er uns auch so energisch, hier auf diesem Hügel uns zu verteidigen. Ich glaube fast, dass die beiden berühmten Westläufer irgendetwas Besonderes planen …«
»Benito, da sprichst du ganz meine Gedanken aus«, meinte der breitschultrige Sancho eifrig. »Man hat von Felsenherz und seinem roten Freund schon so vielerlei gehört, dass man ihnen alles Mögliche zutrauen kann, selbst das, dieser Teufelsbrut von Apachen ein Schnippchen zu schlagen. Ah … da nähert sich ja unserem Hügel ein einzelner Roter, der ohne Waffen ist und einen Zweig schwingt. Ein Unterhändler also!«
Der Apache, kein anderer als der Unterhäuptling, der Fliegende Pfeil, blieb am Fuß des Hügels stehen und rief Benito und Sancho, die sich furchtlos erhoben hatten, mit lauter Stimme zu: »Die sechs Bleichgesichter mögen uns Felsenherz und Chokariga ausliefern. Dann sollen sie freien Abzug gewährt erhalten.«
Sancho lachte grimmig: »Du erkennst mich wohl von früher her wieder, Fliegender Pfeil, so gut, wie ich dich kenne! Deine Zunge ist gespalten. Dein Mund trieft von Lügen! Ihr wisst nicht genau, ob Felsenherz und der Comanchenhäuptling sich hier befinden. Aus unserer Antwort wollt Ihr dies nun entnehmen. Unsere Antwort ist folgende: Hier befinden sich sechs Männer mit je einer Doppelbüchse und je zwei doppelläufigen Pistolen! Weiter seht Ihr selbst, dass wir den Tag über nicht untätig gewesen waren, sondern aus Buchenästen einen Verhau um die Bäume errichtet haben, der den Hügel zur Festung macht. Versucht es, diese Festung zu erobern! Das ist unsere Antwort! So spricht Sancho, der Indsmenfresser!«
Der Fliegende Pfeil hatte den früheren Gambusino mit einem Blick tödlichen Hasses gemustert.
»Die sechs Vaqueros werden am Marterpfahl sterben!«, rief er zurück.
»Das sollte ich schon einige Male, roter Halunke!«, brüllte Sancho, dem die schnell auflodernde Wut schon wieder die ruhige Überlegung trübte. »Glaubst du, wir haben Angst vor euch, weil ihr euch da in der Prärie zu Hunderten umhertreibt? Ihr irrt euch! Felsenherz und Chokariga werden euch schon einen Denkzettel geben! Sie sind ja frei! Und wenn du jetzt nicht sofort verschwindest, puste ich dir ein rundes Stück Blei durch dein rotes Fell.«
Der Fliegende Pfeil machte darauf schweigend kehrt und schritt zum Bach zurück, durchwatete ihn und meldete dem Oberhäuptling, dass Sancho, der alte Todfeind der Apachen, sich mit auf dem Hügel befinde und dass der einstige Goldsucher sich soeben insofern verraten habe, als er zugab, Felsenherz und Chokariga seien dort nicht mit umzingelt, sondern frei.
Der Große Bär, der wieder vor seinem Zelt saß und dumpf vor sich hin gebrütet hatte, sprang auf.
»Dann haben unsere Krieger heute wie triefäugige Weiber gesucht!«, stieß er wütend hervor. »Sie hätten die Fährte finden müssen! Die beiden können nicht lautlos wie Nachteulen entflohen sein. Nur hundert Mann bleiben setzt zur Bewachung des Hügels hier! Die anderen verteilen sich in Trupps zu zwanzig und suchen weiter nach den Flüchtlingen! Wer sie fängt, ob tot oder lebendig, erhält von mir einen Beutel mit Pulver und Blei!«
Gleich darauf brach die Hauptmasse der Apachen abermals zur Verfolgung auf.
»Aha!«, gab Sancho lachend von sich, der beim Licht des scheidenden Tages zusammen mit den Gefährten die sich in die Ferne zerstreuenden Reitertrupps beobachtete. »Aha, die roten Banditen beginnen die Jagd von Neuem! Viel Vergnügen! Ihr werdet jetzt genau so wenig Erfolg haben wie am Tage, selbst wenn heute Nacht der Himmel klar bleiben und der Vollmond scheinen sollte!«
Es wurde rasch dunkel. Die Vaqueros brannten vor ihrem Astverhau vier mächtige Feuer an. Dann legten sich vier von ihnen zum Schlafen nieder. Für einen Tag hatten sie noch Lebensmittel und Trinkwasser gehabt. Aber morgen würden dann für sie die furchtbaren Qualen des Hungers und des Durstes beginnen, würden sich immer mehr steigern. Was dann geschehen würde, wenn sie kraftlos und matt zu jeder Verteidigung unfähig waren, das wussten sie nur zu genau. Und doch – alle sechs waren keineswegs bedrückt oder sorgenvoll! Sie rechneten ebenso bestimmt auf Felsenherz’ und des Comanchenhäuptlings Hilfe wie auf eine ruhige Nacht ohne feindlichen Angriff, da sie ja sehr wohl feststellen konnten, dass von den Apachen nur etwa hundert Krieger hier zurückgeblieben waren.
Juan und Sancho hatten beim Auslosen die erste Wache von 10 bis 1 Uhr morgens erhalten. Sie waren jeder auf eine Buche hinaufgestiegen, von wo sie die Prärie weithin übersehen konnten. Die Rothäute hatten im Kreis um den Hügel ebenfalls zahlreiche Feuer angezündet. Dieser Kranz von flackernden Flammen berührte an zwei Stellen den Bach, und zwar dort, wo jenseits des etwa zwanzig Meter breiten, an den Ufern verkrauteten und mit Wasserpflanzen teilweise dicht bedeckten Gewässers in der Buschlichtung vor dem Zelt des Großen Bären gleichfalls ein Feuer brannte.
Hier saßen der Oberhäuptling, der Fliegende Pfeil und die acht ältesten Krieger wieder beisammen und rauchten schweigend ihre Pfeifen. Diese stillen, fast regungslosen Rothäute, deren bemalte Gesichter der flackernde Feuerschein hin und wieder greller beleuchtete, machten in ihrer ehernen Ruhe einen fast unheimlichen Eindruck.
Dann kam ein langer Apache über den Bach und brachte ihnen zwei frisch gebratene Rehkeulen als Nachtessen.
Nachdem er das Gewässer wieder durchwatet hatte, ereignete sich an einer steilen Uferstelle dicht bei den Büschen etwas sehr Seltsames.
Ein Teil der Wasserpflanzen hob sich von der Oberfläche des Baches langsam empor, und Felsenherz’ Kopf wurde sichtbar. Im Mund hielt der blonde Trapper noch das hohle, dicke Stück Schilfrohr, mit dessen Hilfe ihm wie auch Chokariga unter Wasser das Atmen ermöglicht worden war.
Die beiden Westmänner, deren Taten vom Felsengebirge im Norden bis hinab zu den Sandebenen Mexikos an allen Lagerfeuern stets neuen Stoff zur Unterhaltung gaben, hatten in der verflossenen Nacht nach einem wohlüberlegten Plan gehandelt, als sie, um wieder in den Besitz ihrer wertvollen, treuen Pferde und Chokarigas Waffen zu kommen, sogar noch Felsenherz’ Büchse preisgaben und sich in der unterwaschenen Uferböschung hinter dem Vorhang von Wurzeln und herabhängenden Grashalmen verborgen. Die Apachen hatten natürlich auch hier schon in der Nacht nach ihnen gesucht.
Die beiden Freunde waren jedoch rechtzeitig untergetaucht, tiefer in den Bach hineingekrochen und hatten so lange unter Wasser durch die Schilfröhrchen geatmet, bis die Gefahr vorüber war und sie wieder ihr erstes Versteck aufsuchen konnten, wo sie dann unbelästigt blieben. Felsenherz hatte sich wieder hervorgewagt. Mit äußerster Vorsicht musterte er die beiden Bachufer, ahmte dann das Zirpen einer Grille nach und rief so den Comanchenhäuptling zu sich, der nun gleichfalls nur mit dem Kopf über den Schlingpflanzen aufmerksam umherspähte.
Das nächste Wachtfeuer der Apachen brannte etwa achtzig Schritte entfernt am Bachufer. Sein Schein reichte nicht bis hierher. Lautlos bewegten die beiden sich nun dem Nordufer zu, krochen auf allen vieren, Felsenherz ein Stück voraus, in die Prärie hinein und näherten sich so den in einem Tal weidenden Pferden der beiden Häuptlinge und der acht ältesten Krieger. Die Tiere standen hier von zwei jungen Apachen bewacht, während ein Dritter das Buschwerk als Posten umschritt.
Felsenherz und der Häuptling stellten zu ihrer Freude fest, dass auch ihre beiden Pferde, ein Brauner und ein Rappe, dicht neben den Indianergäulen angepflockt waren.
»Mein Bruder Harry hat wieder einmal den richtigen Weg gefunden, unser Eigentum zurückzuerlangen«, flüsterte der Comanche. »Die meisten Apachen sind, wie mein Bruder dies voraussah, auch jetzt nachts in der Prärie verteilt, um uns zu suchen. Wir werden sehr bald unsere Pferde und Büchsen wiederhaben.«
Nach kurzer leiser Zwiesprache bewegten sie sich auf die Büsche zu, wichen dem Posten, der unaufmerksam auf und ab schlenderte, aus und schoben sich Zentimeter für Zentimeter näher an das Zelt heran.
Der Große Bär sagte gerade, ohne seine Stimme irgendwie zu dämpfen, da er sich völlig sicher wähnte: »In der Hazienda Lago del Parral werden wir gute Beute machen. Der Besitzer ist reich. Die beiden Späher, die ich vorausgeschickt hatte und die nachmittags zurückgekehrt sind, meldeten, dass dort noch zehn Vaqueros verweilen, die als Verteidiger der Hazienda in Betracht kommen, außerdem das reiche Bleichgesicht Señor Alvaro und fünf Diener. Die nächste Hazienda aber ist Tagesritte entfernt, sodass wir dort leichtes Spiel haben werden und niemand dem Señor zu Hilfe kommen kann.«
Die vor dem Zelt sitzenden Apachen besprachen den Überfall nun in ihrer bedächtigen Art mit allen Einzelheiten, wobei der Große Bär noch erwähnte, dass er gar nicht daran denke, seine Krieger durch einen offenen Angriff auf den Hügel zu opfern, sondern die Vaqueros aushungern wolle, indem er hundert Mann zurücklassen würde, falls bis morgen Mittag der Trapper und der Comachenhäuptling nicht gefunden seien.
All dies hörten Felsenherz und Chokariga, der Schwarze Panther, mit an. Geduldig warteten sie, bis die zehn Apachen gegen Mitternacht sich trennten. Hier in der Lichtung blieben nur der Große Bär, der Fliegende Pfeil und die beiden ältesten Krieger zurück, die mit dem Oberhäuptling das Zelt teilten.
Das Feuer brannte immer mehr herab. Nur der Große Bär war noch im Freien geblieben. Die drei anderen schliefen bereits. Der hünenhafte, herkulische Häuptling schritt durch die Büsche dem Bachufer zu und schaute zum Hügel hinüber. Seine Gedanken waren dort drüben, wo unter den Bäumen vor dem Verhau die Feuer der Vaqueros flackerten. Dort also befand sich der Gambusino Sancho, der Indsmenfresser, der Mann, den der Große Bär neben Felsenherz und dem Schwarzen Panther am meisten hasste.
Diese Todfeindschaft war gegenseitig. Als der riesige Apachenhäuptling nun an all die Krieger dachte, die des Gambusinos sichere Büchse nacheinander ausgelöscht hatte, zuckte seine Hand unwillkürlich nach dem Gürtel, der mit den Skalpen erschlagener Feinde geschmückt war. Nur ein einziger Skalp war darunter, der einem noch Lebenden, dem Gambusino, gehörte.
Dann reckte der Große Bär den muskelstrotzenden Arm zu einer drohenden Gebärde gegen den Hügel hoch.
»Ihr werdet am Marterpfahl sterben, Ihr sechs!«, sagte er halblaut. »Und auch der Hund von Comanche und der blondbärtige Jäger …«
Da – eine Hand hatte sich leicht auf seine Schulter gelegt.
Er fuhr herum.
Das Licht des soeben aufgegangenen Mondes beschien das edle, ernste Gesicht des Trappers Felsenherz.
Der Große Bär war geistesgegenwärtig genug, sofort mit beiden Händen nach des verhassten Feindes Kehle zu greifen.
Doch dieser Abwärtsbewegung seiner Arme kam der Jagdhieb des Trappers zuvor, dessen rechte Faust den Apachen blitzschnell gegen die Herzgrube traf, während die Linke gleichzeitig fast dessen Hals umspannte.
Der halbe Aufschrei des bewusstlos Umsinkenden erstickte in einem dumpfen Gurgeln.
Felsenherz hatte den Apachen aufgefangen, legte ihn in das Gras und band ihn schnell mit den bereitgehaltenen Riemen, zwängte ihm auch einen Knebel in den Mund.
Dann schleppte er den schweren Körper mühelos seitwärts zu einem einzelnen Busch und schlüpfte zu der Lichtung zurück, wo inzwischen auch der Posten, der bisher nach der Prärie zu das Buschwerk umrundet hatte, von Chokariga überwältigt und gefesselt worden war.
Die beiden Freunde nahmen mit Bestimmtheit an, dass ihre Büchsen und des Comanchen sonstige Waffen sich im Zelt befänden. Es galt nun, auch den Unterhäuptling und die beiden alten Apachenkrieger unschädlich zu machen. Das Feuer glimmte nur noch. Das Mondlicht aber wurde durch die hohen Büsche abgeschirmt, sodass es auf der Lichtung recht dunkel war.
Felsenherz schob sich allmählich in das Zelt hinein. Die tiefen Atemzüge darin bewiesen, dass die drei fest schliefen. Und trotzdem war es ein äußerst gefährliches Unterfangen, hier in dem stockfinsteren Zeltinnern den Boden nach den Waffen abzutasten.
Der blonde Trapper befühlte behutsam jeden Gegenstand, jeden der lang ausgestreckt ruhenden Körper. Links war ein Platz für den Oberhäuptling freigelassen worden. Und hier lagen wirklich die beiden Büchsen, lagen Chokarigas Tomahawk, Jagdmesser, Pulverhorn und Kugelbeutel.
Felsenherz reichte die Waffen, nachdem er das Zelt ein Stück an der Seite aufgeschnitten hatte, seinem roten Freund hinaus.
Alles schien gut zu gehen. Doch da – ein unglücklicher Zufall wollte es, dass gerade jetzt ein Apache über den Bach gekommen war, um den bereits von Chokariga überwältigten Posten abzulösen. Als dieser Krieger den Wächter nirgends fand, drang er in die Büsche ein, erkannte sofort den Comanchen an dem langen Haar und den Adlerfedern im Haarschopf, zog das Messer und sprang Chokariga von hinten lautlos an.
Doch des Comanchen feines Gehör hatte sehr wohl das leise Knacken eines unter dem flüchtigen Fuß des Feindes brechenden Astes vernommen.
Er schnellte sich zur Seite, und der ihm zugedachte Messerstich traf nur noch das rechte Schultergelenk, lähmte aber immerhin den rechten Arm derart, dass der Schwarze Panther mit der Linken nun den neuen Angriff abwehren musste.
Der Apache, ein noch sehr junger Krieger, stieß einen schrillen Schrei aus, um seine Stammesgenossen zu alarmieren. Im selben Moment hatte Chokariga schon sein Handgelenk gepackt und versetzte ihm mit dem rechten Knie, indem er ihn zu sich heranriss, einen solchen Stoß gegen die Magengrube, dass der Apache stöhnend umsank und sich vor Schmerzen am Boden wälzte.
Felsenherz war auf den gellenden Ruf des Feindes rasch aus dem Zelt hervorgekrochen. Mit einem Blick überschaute er die Lage. Der Schwarze Panther hob soeben seine Waffen auf, wobei er sich nur des linken Armes bedienen konnte.
»Zu den Pferden«, brüllte Felsenherz und fasste nach den Zeltstangen, brachte das schwere Vorderzelt zu Fall und begrub so den Fliegenden Pfeil und die beiden alten Krieger unter der Last der faltenreichen Hirschhäute.
Dann bückte er sich, raffte seine doppelläufige Flinte auf und sprang hinter dem Comanchen drein.
Die beiden Wächter bei den Pferden im nahen Tal sahen im Mondlicht den Schwarzen Panther herbeistürmen. Sie waren nur mit Bogen und Pfeilen bewaffnet, erkannten gleichfalls des berühmten Häuptlings schlanke Gestalt und wenige Schritte zurück den gefürchteten Trapper. Auch dies waren noch recht junge Leute, die erst ihren ersten größeren Kriegszug mitmachten. In ihrer Brust stritt für Sekunden die Liebe zum Leben mit dem Pflichtgefühl des Kriegers. Dann spannten sie fast gleichzeitig ihre Bogen. Beide Pfeile verließen im gleichen Augenblick die Sehnen. Auf diese kurze Entfernung musste der Comanche getroffen werden. Aber er wich nur kaum merklich zur Seite aus, schwang mit der Linken, die anderen Waffen fallen lassend, den Tomahawk.
Das nie fehlende Schlachtbeil schwirrte durch die Luft. Der eine der Apachen floh. Der andere wollte dem Wurf entgehen, duckte sich, sprang nach links. Um den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Die Schneide des Tomahawks schmetterte ihm gegen die Stirn. Er breitete die Arme aus und schlug rücklings in das Gras.
Gleich darauf saßen Felsenherz und Chokariga auf ihren Pferden, die ihre Herren mit freudigem Wiehern nach so langer Trennung begrüßt hatten.
Auch die zehn Indianergäule nahmen sie mit, sprengten nun in Karriere nach Norden zu, wo ein dünner Waldstreifen sich im Bogen bis an den Bach hinzog.
Hinter dieser Baumkulisse änderten sie die Richtung, bogen nach Südwest ab und erreichten den Bach zu derselben Zeit, als ein Apachenschwarm von etwa vierzig Reitern im Mondlicht ihre Fährte aufgenommen hatte und ihnen ebenfalls in gestecktem Galopp folgte.
Die Stelle, wo die beiden Freunde nun den Bach überschritten, lag etwa tausend Meter westlich vom Hügel mit den drei Buchen. Da sich inzwischen der auf der Lichtung von Chokariga niedergeworfene Apache so weit erholt gehabt hatte, dass er den anderen, die auf seinen schrillen Schrei hin über das Gewässer gekommen waren, mitteilen konnte, Felsenherz und der Schwarze Panther seien soeben erst nach Norden zu entwichen, war diese Kunde wie ein Lauffeuer bis zu den Wachen gedrungen, die den von den Vaqueros besetzten Hügel einkreisten.
Sancho, der Indsmenfresser, und der junge Juan beobachteten zu ihrem Erstaunen, dass die meisten Apachen in wilder Hast ihre Pferde bestiegen und dem Bache zujagten.
»Ah – da haben fraglos Felsenherz und der Comanche der Satansbrut etwas zu raten aufgegeben!«, rief Sancho lachend. »Wusst ich’s doch, dass die beiden noch irgendwo in der Nähe steckten! Juan, wecke mal schnell die Übrigen. Ich muss mit Benito schleunigst beraten, ob wir diese gute Gelegenheit nicht benutzen sollen …«
Schreibe einen Kommentar