Xaver Stielers Tod – Kapitel 6
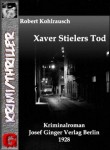 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Sechstes Kapitel
Stefan ging durch den mittäglich stillen Wald rasch auf nächstem Wege dem Bahnhof zu. Nicht nur durch Eile war sein Fuß beflügelt. Er fühlte sich immer so gehoben, des Erdengewichtes entkleidet, von aller Nachlässigkeit und Schlaffheit befreit, wenn er mit Hanna beisammen gewesen war. Der elektrische Strom, der von ihr ausging und Lebens- und Liebeskraft in ihm merkte, wirkte stets noch eine Weile nach. Seine Zufriedenheit mit sich selbst freilich bekam dabei jedes Mal einen Stoß. Er sah dann im Geist vor sich einen anderen Stefan Hersberg, der etwas dazu tat, um das in Hanna für ihn verkörperte Glück zu verdienen. Der arbeitete, schaffte, strebte, dies hohe Ziel zu erreichen. Manchmal empfand er in solchen Augenblicken auch in sich die Kräfte, dieser andere Graf Stefan zu werden. Es wäre wunderschön gewesen, es ihm gleichzutun, gewiss, – nur, – freilich, – bequemer war es, wenn er der alte Stefan blieb.
Auch heute machten seine Gedanken diesen Weg, ein Lächeln ging über sein Gesicht, und er sagte halblaut: »Ein Faultier bin ich und bleib ich, ein unverbesserliches.«
Dann trat ihm die Situation vor die Seele, der er entgegenging. Wie würde das Wiedersehen mit seinem Vater sich gestalten? Wie würde sich der alte Mann in den Tod seines ältesten Sohnes finden, der von ihm enterbt und verflucht worden war und nun, als er eben reuevoll ins altehrwürdige Vaterhaus hatte heimkehren wollen, auf so geheimnisvoll schreckliche Weise vom Leben hatte scheiden müssen? Wie würde dieser Vater ihm selbst gegenübertreten, der ihm – es war leider nicht abzuleugnen – so viel Verdruss und Kummer bereitet hatte, dass er nun von ihm in derselben leidenschaftlichen, unbeherrschten Art sich wie vor Jahren von seinem anderen Sohn hatte loslösen wollen?
Es war Stefan bei diesen Gedanken und Fragen unbehaglich zumute, aber etwas von der elastischen Leichtigkeit in seinem Gang und von dem Sonnenschein auf seinem Gesicht, die Hanna geweckt hatte, begleiteten ihn doch bis an sein Ziel.
Im Bahnhof angelangt, las er auf einer schwarzen Tafel am Bahnsteig, dass der Zug seines Vaters fast eine halbe Stunde Verspätung haben würde. Nun hieß es warten. Langsam ging er auf dem grauen Pflaster des Bahnsteigs hin und her, wo durch die mächtige, von unzähligen Maschinen verräucherte Glaswölbung ein fast ebenso graues Licht herabrieselte. Je näher der Augenblick der Begegnung mit seinem Vater kam, umso mehr verdüsterte sich auch seine Seele mit solch hässlichem Grau. Das Totenantlitz des auf geheimnisvolle Weise gestorbenen Bruders erschien vor seinen Augen, der Schmerz um den Gestorbenen wurde zum ersten Mal tief und groß.
Das langsam ermattende Fauchen eines einlaufenden Zuges auf der linken Seite des Bahnsteigs – das rechte Gleis blieb für den von Stefan erwarteten Schnellzug frei – klang ihm störend in sein ernstes Nachdenken hinein. Er trat beiseite, den Strom der Angekommenen vorüberfluten zu lassen, und hielt seinen Blick auf den Boden geheftet. Plötzlich klang sein eigener Name, laut von einer Frauenstimme gerufen, ihm ins Ohr.
»Graf Stefan, Graf Stefan!«
Er fuhr herum. Ihm gegenüber stand Afra Baratta mit verzerrtem Gesicht und weit aufgerissenen Augen. Sie fasste seinen Arm so gewaltsam, dass er schmerzte, während ein halbirres Lachen von ihren Lippen kam.
»Sie sind hier, haben auf mich gewartet, Gott sei gedankt! Es ist mir ein Zeichen, dass das Grässliche nicht Wahrheit sein kann, sonst wären Sie nicht gekommen. Er lebt, nicht wahr, er lebt?«
Stefan schüttelte langsam den Kopf. »Sie sprechen von meinem Bruder. Nein, leider muss ich Ihnen die traurige Nachricht bestätigen. Er ist gestern Abend gestorben.«
»Tot, Xaver tot!« Sie schrie die Worte mit so lauter Verzweiflung, dass eine neugierige Menschengruppe sich um sie bildete. Stefans Gesicht verfinsterte sich. Diese geräuschvolle, theatralische Trauer war ihm höchst unsympathisch.
»Bitte, beruhigen Sie sich. Kommen Sie mit mir in einen geschlossenen Raum, dort will ich Ihnen alles berichten, aber nicht hier.«
Die leisen, doch mit starkem Nachdruck gesprochenen Worte taten ihre Wirkung. Afra sandte noch einen verzweifelten Blick zu der Glaswölbung der Halle hinauf, dann klammerte sie sich mit um seinen Arm zusammengekrampften Händen an ihn und stammelte mit gebrochener Stimme: »Ja, kommen Sie, kommen Sie.« So ging sie mit mehrfach einknickenden Knien langsam an seiner Seite dahin.
Ein kleines Damenzimmer neben dem Warteraum Erster Klasse war leer, und Stefan führte seine Schwägerin dort hinein. Seine Schwägerin! Mitten in Unbehagen, Trauer und Aufregung fuhr es ihm durch den Sinn, wie sonderbar das Leben spielte, dass dies innerlich und äußerlich ihm so fremde Wesen ihm so nahe verwandt war.
Afra hatte sich gleich nach ihrem Eintreten auf die Knie geworfen, ihr Gesicht in den Händen verborgen und so den Kopf auf den Sitz eines Diwans gepresst. Ein hysterischer Weinkrampf durchbebte den zusammengesunkenen Körper.
Ihr haltloses Betragen weckte bei Stefan einen leisen Trieb zur Grausamkeit. Seine Stimme klang härter als gewöhnlich, indem er sagte: »Sparen Sie noch etwas an Schmerz auf. Ich glaube, Sie wissen bisher noch nicht alles. Man sagte mir wenigstens, Ihnen sei nur eine ganz kurze Nachricht vom Tod meines Bruders telegrafiert worden. Er ist aber keines natürlichen Todes gestorben. Man hat ihn vergiftet.«
Sie fuhr empor und herum. Ein Furienantlitz war es, das den Grafen anstarrte. »Vergiftet, ihn? Wer hat es getan, wer hat es getan?«
»Das liegt bis jetzt noch völlig im Dunkeln. Die Gerichtskommission ist eifrig an der Arbeit, hat aber, soviel ich weiß, vorläufig absolut keinen bestimmten Verdacht. Nach der Sektion …«
»Sektion!«, schrie die Baratta. »Sein himmlischer göttlicher Körper zerschnitten, zerfleischt, entstellt …«
»Er wird bald noch entstellter sein, wenn er unter der Erde liegt«, sagte Stefan hart, mit gerunzelter Stirn. Afras Art war ihm unerträglich. »Nach dem Ergebnis der Sektion soll er an einem langsam wirkenden indischen Gift gestorben sein, das ihm schon ein paar Stunden vor seinem Tod kann beigebracht worden sein. Darum ist es doppelt schwierig …«
»Ein paar Stunden, ein paar Stunden? Wann ist Xaver gestorben? Sagen Sie mir das ganz genau.«
»Sein Auftreten gestern Abend begann wie gewöhnlich um acht und ein Viertel. Ungefähr eine halbe Stunde darauf erfolgte die Katastrophe.«
»Stimmt, stimmt, stimmt«, murmelte die Baratta. Sie war aufgesprungen und ging mit großen, raschen, schleifenden Schritten in dem kleinen Raum hin und her.
»Aber das Gericht soll es wissen, sein Mord soll gerächt werden.« Sie blieb jäh vor Stefan stehen und packte seine Hand. »Ich kenne die Mörderin.«
»Sie?«
»Fragen Sie mich nicht weiter. Wir dürfen keinen Augenblick verlieren. Sagen Sie mir nur schnell, wer Untersuchungsrichter in dieser Sache ist?«
»Der Amtsgerichtsrat Germelmann.«
»Wo kann ich ihn finden?«
»Im Justizgebäude. Sein Zimmer hat Nummer 145.«
»Gut. Ich fahre dorthin. Sofort. Nein, ich habe vorher noch einen anderen Weg. Erst muss ich wissen … leben Sie wohl, Graf Stefan. Wenigstens rächen will ich meinen Xaver. Ich liefere die Mörderin dem Gericht in die Hände.«
Sie stürzte hinaus. Er machte keinen Versuch, ihr zu folgen, strich sich nur mit einer Hand über die heiße Stirn. Ein paar Mal hatte sein Blick sich bereits auf den mit lautem Ticken sein Amt erfüllenden Regulator an der Wand gerichtet, um den Zug seines Vaters nicht zu versäumen. Er ging schnell zur Tür, die zu den Bahnsteigen führte.
Die Zeit war abgelaufen, um die sich der Zug verspätet hatte. Stefan sah die Silhouette der schwarzen Maschine, langsam größer werdend, bereits aus der weißen Helle draußen in die Dämmerung unter dem rauchgeschwärzten Gewölbe einlaufen. Mit einem beklommenen Aufatmen ging er dem Zug entgegen.
Eilig schritt er an der nur noch matt sich bewegenden Wagenreihe hin, die Fenster mit raschem Blick überfliegend. Ein Gesicht, eine Hand gaben ihm Zeichen, es war sein Vater, der mit verzweifelten, verweinten Augen nach ihm suchte.
Als der junge Graf die Wagentür aufriss, gab der Vater ihm einen Wink, dass er die Mitreisenden erst hinauslassen wolle, bevor er sprach. Dann, als er allein im Abteil zurückgeblieben war, hob er zweimal mit einer Geste der Verzweiflung die rechte Hand, um sie jedes Mal schwer auf sein Knie zurückfallen zu lassen.
»Stefan, Stefan!«
Das war alles, was er hervorbrachte. Vergeblich rang er um andere Worte, sie wurden immer wieder von aufquellenden Tränen ausgelöscht.
»Komm, Vater«, sagte freundlich der Sohn. »Steig erst einmal aus, ich helfe dir. Quäle dich nicht mit reden, wir wollen sprechen, wenn wir allein und in Ruhe sind. Ich habe dir ein Zimmer im Palasthotel bestellt, hier dicht beim Bahnhof.« Er winkte zugleich einem Träger, dem er das Handgepäck seines Vaters übergab. Dann half er dem alten Herrn, der beim Versuch, aufzustehen, zunächst noch einmal auf die Polster zurücksank, behutsam aus dem Wagen. Es war etwas Weiches, fast weiblich Zartes in seinen Bewegungen bei diesem Tun.
Auf Stefans Arm gestützt und seinen Stock mit schwarzer Krücke bei jedem Schritt fest auf den Boden stoßend, ging der alte Graf zum Ausgang hin. Er war sehr groß, noch größer als der Sohn, aber in diesem Augenblick durch den schweren Gram tief niedergebeugt. Auf dem hohen Körper saß ein weißhaariger Kopf mit schönem Greisenantlitz, durch die Form von Bart und Haar nach der Weise Kaiser Wilhelm des Ersten an vergangene Zeiten gemahnend.
Ohne zu sprechen, gingen sie nebeneinander. Das laute Hasten der Menge ringsumher machte sie stumm. Im Hotelzimmer, dessen durch doppelte Türen geschützte Ruhe sie gegensätzlich und wohltuend umfing, sank der alte Graf schwer auf einen Sessel und sagte mit mühsamer Stimme zu Stefan, der sich neben ihn setzte: »Nun erzähle mir alles.«
Es war nicht viel Neues, was der Sohn in Ergänzung seines ausführlichen Telegramms noch zu berichten hatte, doch wirkte das lebendige Wort mit aufregender Kraft. Über die Wangen des alten Herrn liefen häufige Tränen in seinen weißen Bart. Er griff nach Stefans Hand und presste sie fest in die seine.
Das alles war natürlich und menschlich, nur eins fiel Stefan auf. Die Vergiftung seines Bruders, dieser mutmaßliche geheimnisvolle Mord berührte den Vater scheinbar am wenigsten. Sein Gefühl blieb ganz in den Kreis des eigenen Selbst gebannt, und ihm gab er Ausdruck in beweglichen Klagen, als der Sohn geendet hatte.
»Mein Junge, mein Botho! Wenn ich ihm nur einmal noch die Hand hätte drücken können! Unrecht hab ich an ihm getan, schweres, unverzeihliches Unrecht! Es ist nur gerecht, wenn ich dafür gestraft werde. Warum aber hat er dafür büßen müssen, mein lieber, guter, schöner Junge?«
Voller Staunen und Mitleid schaute der Sohn auf den Vater. Wie sehr war dieser alte Mann verwandelt! Verschwunden scheinbar und ausgelöscht all die jähzornige Heftigkeit, unter der Botho schwer gelitten hatte, die Stefans eigenem Leben fast auch schon verderblich geworden war. Dass diese Gefahr – für den Augenblick wenigstens – nicht mehr drohte, sagten ihm schon des Vaters nächste Worte. Doch sein Mitleid war zu stark, als dass er sich darüber schon jetzt hätte freuen können. Wie mussten die Schmerzen brennen, in deren Feuer das Erz dieses früher so harten Mannes geschmolzen war.
»Nun hab ich nur noch dich, Stefan. Du musst bei mir bleiben, darfst mich nicht verlassen. Ich will versuchen, an dir wieder gut zu machen, was ich an Botho gesündigt habe. Hab mich lieb, mein Junge, hab du mich lieb!«
Dem Sohn kamen bei diesem hilflosen Flehen des Vaters die Tränen ins Auge. Und ein Gefühl wuchs in seinem Herzen auf, das jenem durch Hanna mit unter in ihm geweckten Empfinden verwandt war, wenn er sich stark und mutig fühlte, sich in den anderen, festeren, besseren Stefan zu verwandeln, der ihm zuweilen vor Augen schwebte.
Sein Gefühl trieb ihn empor. Er beugte sich über den Alten und küsste leise seine heiße Stirn. »Ich habe dich lieb, Vater, heute lieber denn je.« Dann, als ob er sich der weichen Regung schämte, trat er schnell zurück und versuchte, den gewohnten lässigen Humor wieder aufzuwecken.
»Aber nun ist’s genug. Wir wollen doch keine Tränenweiden werden, Vater, nicht wahr? Jetzt gehen wir zusammen zum Essen …«
Der Alte wehrte lebhaft ab. »Essen kann ich nicht. Ich habe im Speisewagen gefrühstückt. Nur müde bin ich, sehr müde.«
»Das ist famos. Der Schlaf ist noch bessere Medizin. Komm, leg dich hierher, die Chaiselongue scheint mir bequem, – so, da wären wir. Ich setze mich zu dir, halte deine Hand, – so hat es keine Gefahr, dass ich dir davonlaufe. Nun aber schnell geschlafen. Wer ein Wort spricht, kommt in Verruf.«
Er hatte den Vater beim Sprechen auf das Lager gebettet, setzte sich neben ihn und hielt seine Hand, wie versprochen. Aus dieser Berührung des ihm gebliebenen Sohnes schien Frieden in die Seele des alten Grafen hinüberzuströmen, seine Züge glätteten sich nach und nach, sein Atem ging ruhiger, und bald lag er in tiefem, festem Schlaf.
***
Amtsgerichtsrat Germelmann war am Nachmittag wieder in seinem Amtsraum des Justizgebäudes erschienen, durch ein paar Gläser guten Rotweins beim Essen und eine schwere Zigarre hinterher in seiner angeborenen Behaglichkeit und Jovialität angenehm bestärkt. Er warf einen Blick aus dem Fenster in den hellen Herbstsonnenschein und sagte mit einem Kopfschütteln zum Kommissar Bauer, der ihm gegenüberstand: »Warum nur die Menschen sich gegenseitig das Leben so schwer machen? Warum rauben sie, stehlen sie, morden sie? Das alles ist eigentlich doch ein kolossaler Unsinn.«
Der Kommissar lachte höflich, ohne viel Verständnis für diese philosophische Betrachtung aufzubringen, um dann zu sagen: »Ja, die Welt ist nun einmal so eingerichtet.«
»Leider. Und wir haben die schmutzige Wäsche von all diesen Völkern zu waschen. Was gibt es Neues in der Sache Stieler?«
Bauer öffnete den Mund eben zur Antwort, als nach einem Klopfen an der Tür einer der Gerichtsdiener hereinkam und meldete, dass ein Herr draußen sei, der den Herrn Untersuchungsrichter zu sprechen wünsche.
Germelmann warf einen Blick auf die vom Diener gereichte Visitenkarte, sein Gesicht gewann dabei wieder den Ausdruck einer starken, gespannten Erwartung, während er schnell sagte: »Lassen Sie den Herrn eintreten.« Und er fügte, zum Kommissar gewandt, halblaut hinzu: »Der Inder ist es. Was mag er wollen?«
Amaru trat ein, verbeugte sich mit seiner anmutigen Bewegungskunst und sagte: »Herr Gerichtsrat gestatten, dass ich mir habe erlaubt, noch einmal hierher zu kommen. Aber ich bin gewesen voll Gedanken wegen das, was ich habe gehört und gesagt heute Morgen. Weil wir doch haben gesprochen von mein Gift, was wir nennen würden auf Deutsch ›Der glückliche Tod‹. Und ich bin gegangen zu Haus an das kleine Schrank, wo hat immer gestanden das Gift, und habe genommen heraus das kleine Glas.«
Er hatte, während er sprach, in die Tasche seines Rocks gegriffen und einen in Papier gewickelten Gegenstand hervorgezogen. Indem er ihn jetzt von seiner Hülle befreite, kam ein ziemlich dickes Medizinglas mit eingeschliffenem Stöpsel daraus hervor. Ein Etikett, auf dem – unter dem Bild eines Totenkopfes das Wort ›Poison‹ stand, war darauf geklebt, ein weißes, die Höhlung bis etwas über die Hälfte füllendes Pulver war durch die Glaswandung sichtbar.
Amaru stellte mit sorgfältiger Vorsicht sein Glas vor Germelmann auf den Tisch und sagte: »Möchten Herr Untersuchungsrichter haben die Güte, genau zu betrachten, was ich hier habe gebracht. Sie werden sehen daran etwas Besonderes, was auch für mich selbst ist neu gewesen. Schauen Sie her: Oben über das Pulver ist am Glas rundum ein weißes Ring wie von ein – wie sagt man? – a fog.«
»Wie von einem Nebel, meinen Sie? Ja, Sie haben recht. Ich sehe jetzt, wovon Sie sprechen. Aber ich glaube, das erklärt sich sehr einfach. Es war früher etwas mehr von dem Pulver im Glas, es hat ein Stückchen höher hinaufgereicht. Infolge von irgendwelchem chemischen Prozess hat es ebenso hoch hinauf diese weißliche, nebelhafte Spur am Glas zurückgelassen. Ein Beweis also, dass ein Teil davon herausgenommen worden ist.«
Germelmann hatte beim Sprechen mit scharfer Beobachtung auf das vor ihm stehende Glas niedergeschaut, bei den letzten Worten aber den Kopf plötzlich gehoben und mit noch geschärftem Blick auf Amarus Gesicht geschaut.
»Ja, ja, gewiss. Ja, ja, ganz genau. Das ist gerade, was ich habe gemeint. Man hat mir genommen von das Gift.«
»Wer kann das getan haben?«
»Ja, wenn ich das könnte sagen! Aber ich wissen genau, das Ring von das Nebel ist nicht gewesen früher. Das Pulver hat ausgefüllt seine Platz, und ist gewesen darüber das Glas ganz rein und klar.«
»Wissen Sie das genau?«
»Ganz genau.«
»Haben Sie das Glas denn öfter in Händen gehabt und geprüft?«
»Nicht öfter, das nicht. Aber ich bin gewesen krank ein paar Wochen her, – ich glauben, dass ich schon das haben gesagt, – und weil ich bin gewesen darüber sehr betrübt und habe gedacht, wenn ich nicht wieder werde gesund und kann arbeiten in meine Fach, ich lieber will sterben durch das ›glückliche Tod‹. Und ich habe darum angeschaut so genau das Glas, und ist keine Spur in ihm gewesen von solche Nebel.«
Germelmann rieb wieder die Nase gedankenvoll an seinem Zeigefinger, um dann zu fragen: »Hat Ihre Wirtin von der Existenz dieses Fläschchens gewusst, haben Sie mit Ihren Kollegen darüber gesprochen?«
»Ich nicht haben gemacht eine Geheimnis aus mein Besitz von das Gift, aber ich nicht könnte mich erinnern, dass ich kurze Zeit her darüber hätte gesprochen mit meine Wirtin oder meine Kollegen.«
»Und wie war es mit Herrn Stieler? Hat er etwas davon gewusst?«
Amaru machte mit südlicher Lebhaftigkeit ein Zeichen der Verneinung. »Nicht er, – oh nein! Ich bestimmt wissen, dass ich mit ihm niemals habe gesprochen darüber.«
Der Ausdruck von Germelmanns Gesicht war immer sinnender und gedankenvoller geworden. Jetzt entschied er: »Nun, jedenfalls bin ich Ihnen dankbar für Ihr Kommen. Das Glas aber müssen Sie hierlassen. Der chemische Sachverständige soll den Inhalt noch mit seinem Resultat von der Leichenuntersuchung vergleichen.«
»Ich soll – das Glas nie bekommen wieder?« Amarus Gesicht hatte sich verdüstert, ein trauriger Ausdruck war in seinen Augen.
»Das ist nicht gesagt. Es ist Ihr Eigentum, wenn auch ein unerlaubt gefährliches. Aber vorläufig muss das Gericht es in Verwahrung nehmen.«
»Oh, wenn ich das hätte gewusst …« Er brach ab, es blieb unausgesprochen, was er hatte sagen wollen.
»Wie lange werden Sie noch in unserer Stadt bleiben?«, fragte der Untersuchungsrichter schnell.
»Ich hätte sollen abgehen mit Schluss von diese Monat. Aber weil Herr Stieler ist gestorben, ich bin wieder gestiegen in Wert bei dem Herrn Direktor, und er hat verlängert meine Kontrakt um eine Monat.«
»Sie haben also Vorteil von dem traurigen Todesfall, nicht wahr?« Wieder traf ein scharfer Blick Amarus Gesicht.
»Wenn man es will nennen ein Vorteil. Ich selbst aber nicht glauben, dass es kann bringen Glück, wenn man auftritt auf eine Bühne, wo geschehen ist solch ein Ding.« Er schwieg einen Augenblick, um dann zu fragen: »Haben Herr Untersuchungsrichter noch zu wünschen etwas?«
»Danke, nein. Für heute wäre wohl alles erledigt. Aber Sie werden jedenfalls bald wieder vernommen werden.«
»Ich sein immer bereit«, entgegnete der Inder und ging mit einer seiner malerischen Verbeugungen hinaus.
Germelmann sprang im selben Augenblick empor und schritt mit auf den Rücken gelegten Händen lebhaft auf und ab. »Ein toller Kerl, dieser Inder, wahrhaftig ein toller Kerl! Entweder von einer Harmlosigkeit und Unschuld, wie man sie diesen Kindern der Sonne nachsagt, oder ein ganz verteufelt geriebener Bursche.«
Der Kommissar nickte mit Nachdruck »Jawohl, jawohl, jawohl, – dass er selbst hierher kommt und uns das Gift sozusagen unter die Nase hält, – es hat beinahe den Anschein, als ob er uns verulken wollte. Wenn er nicht beim Theater wäre, man könnte noch glauben, dass, – aber Theater und Unschuld, wie reimt sich das aufeinander?«
»Das ist es ja, was mir nicht in den Kopf hinein will. Auf alle Fälle, wie schon gesagt: genau beobachten lassen, wo der Mensch verkehrt, was er treibt, mit wem er zusammenkommt, – alles kann von Wichtigkeit sein.«
»Gewiss, gewiss. Ich habe den früheren Leutnant Grabert bereits beauftragt. Er ist ein kluger Mensch und scharfer Beobachter. Ihm wird …«
Er kam nicht weiter. Abermals ein Klopfen an der Tür und gleich darauf das Eintreten des Gerichtsdieners. Doch auch seine Worte blieben unausgesprochen, denn unmittelbar hinter ihm erschien eine Frauengestalt und erzwang sich den Eintritt, ohne zu fragen. Afra Baratta war es, die so gewaltsam in ungeheurer Aufregung eindrang.
Sie warf einen raschen Blick über den Raum und ging mit hastigen Schritten auf den Untersuchungsrichter zu.
»Nicht wahr, Sie sind Herr Amtsgerichtsrat Germelmann? Ich bin Afra Baratta, die Frau des unglücklichen, schändlich hingemordeten Xaver Stieler. Sie haben mir telegrafiert …«
Germelmann, zuerst sehr überrascht, hatte seine Ruhe wiedergefunden und fiel ihr ins Wort. »Ganz recht, ich ließ an Sie telegrafieren. Der Anlass dafür war traurig.
»Oh, furchtbar, furchtbar, furchtbar! Ich bin vernichtet, ich bin gebrochen, mein Leben ist mir zerstört.
Ihr haltloses Gebaren ließ den Untersuchungsrichter die Stirn ärgerlich runzeln und in kühlem Ton sagen: »Bitte, suchen Sie sich zu beruhigen. Ihr Gefühl in Ehren, aber hier vor Gericht handelt sich’s um Tatsachen. Wir hatten Sie schon heute Morgen zurückerwartet auf unser Telegramm.«
»Ich hätte hier sein können, ich wäre hier gewesen, wenn der Mensch im Schlafwagen es mir nicht unmöglich gemacht hätte. Natürlich fuhr ich im Schlafwagen, weil ich nach Petersburg durchreisen wollte. Ich fühlte mich sehr angegriffen und hatte mir ein Abteil für mich allein genommen, auch gesagt, man sollte mich unter keinen Umständen stören. Das hat er wörtlich genommen, der Diener im Wagen, und hat mir erst heute früh das Telegramm gegeben, das pünktlich eingetroffen war. Aber das ist nun einmal geschehen und lässt sich nicht ändern. Jetzt gibt es Wichtigeres, und ich bin hier, um es Ihnen zu sagen.«
Sie hatte die Worte so hastig, überstürzt hervorgestoßen, dass ihr der Atem verjagte. Germelmann tat in das kurze, dadurch erzwungene Schweigen hinein die Frage: »Was haben Sie mir mitzuteilen?«
Afra trat mit einer so heftigen, leidenschaftlichen Bewegung auf ihn zu, dass er unwillkürlich zurückwich. Ihr Anblick war tatsächlich furchterregend. Ungeordnet hing ihr das Haar, an die Schlangen der Medusa gemahnend, um das gelblich blasse Gesicht, in dem alle sonst sorgsam verborgenen Falten und Schattenlinien deutlich hervor traten und ihre schönen Züge plötzlich gealtert erscheinen ließen. Ein wildes Feuer war in ihren Augen, und ihre geballten Hände zitterten, indem sie ganz leise, zwischen den Zähnen die Worte hervorstieß: »Ich will Ihnen sagen, wer meinen Mann ermordet hat.«
»Sprechen Sie.«
»Gestern gegen Abend war mein Mann bei mir …«
»Um welche Zeit war das?«
»Ich war von der Salome-Probe nach Hause gekommen, die nach fünf Uhr vorüber war. Von dort bin ich im Auto zu meiner Wohnung gefahren. Ein paar Minuten später ist Xaver gekommen, es muss gegen halb sechs gewesen sein.«
»Haben Sie irgendetwas Ungewöhnliches an ihm bemerkt?«
»Nein, – ich wüsste nicht. Er hat längere Zeit mit mir gesprochen, dann ist er gegangen. Und ich, – weshalb ich es getan habe, geht nur mich an, – ich bin ihm gefolgt.«
Der Amtsgerichtsrat öffnete die Lippen, als ob er sprechen wollte. Doch besann er sich anders und wartete schweigend, bis die Baratta nach kurzer Pause wieder begann.
»Ich bin ihm nachgegangen, heimlich, ohne dass er mich sah, gegenüber auf der anderen Seite der Straße, wo die Bäume tiefen Schatten warfen. So bin ich ihm gefolgt bis in die stille Heidingerstraße, wo noch viele große Gärten sind. Vor einem dieser Gärten ist er stehen geblieben, dann ist ihm die Pforte von einer Dame geöffnet worden. Sie hat ihn dort in der Dunkelheit erwartet, ist mit ihm in einen Pavillon dort im Garten gegangen. Es war Licht im Pavillon, ich habe das Profil der Dame deutlich am herabgelassenen Fenstervorhang erkannt und ich weiß, wer es war.«
»Dann sagen Sie’s mir.«
»Seit heute weiß ich, wer es gewesen ist. Ich habe sie getroffen, vorige Woche war es, in meines Mannes Wohnung. Ich habe gesehen, dass er sie gestern bei der Salome-Probe grüßte. Nur war mir da noch unbekannt, wer sie war. Aber ich habe mir den Garten, den Pavillon gestern genau gemerkt und bin heute gleich nach meiner Ankunft hingefahren. Ich habe festgestellt, zu welchem Haus dieser Garten gehört, habe gefragt in der Nachbarschaft und erfahren, dass nur eine Dame sich unter den Bewohnern des Hauses befindet. Und so weiß ich, wer sich heimlich gestern Abend mit meinem Xaver im Pavillon getroffen hat: Hanna Rainer, die Tochter des Kommerzienrats Rainer, ist es gewesen.«
Mit einer Bewegung des Erschreckens und Unwillens hob Germelmann eine Hand empor und öffnete die Lippen, um zu sprechen. Aber die Baratta fiel ihm ins Wort in rascher Leidenschaft. Wieder trat sie schnell ganz nahe vor Germelmann hin, wieder zitterten ihre geballten Hände, wieder kamen die Worte zischend von ihren Lippen.
»An einem Gift soll mein Xaver gestorben sein, das ihm ein paar Stunden vor seinem Tod beigebracht worden ist. Ein paar Stunden vor seinem Tod ist er dort im Pavillon zu heimlichem Stelldichein mit Hanna Rainer zusammen gewesen. Hanna Rainer hat ihn vergiftet. Wie sie sein Herz mir geraubt hat, so hat sie sein Leben genommen.«
Sie hatte die Fäuste in wildem Drohen erhoben, in furienhafter Schönheit stand sie vor dem Richter.
Sein Gesicht hatte sich mehr und mehr verfinstert, er sprach lauter und heftiger als gewöhnlich. »Kommen Sie zu sich, Sie fantasieren.«
»Ich weiß, was ich weiß. Ich habe gesehen, was ich sah.«
»Jawohl, einen Schatten haben Sie gesehen auf einem beleuchteten Vorhang. Das ist alles. Denn Sie selbst haben gesagt, es wäre tief dunkel gewesen dort unter den Zweigen der Bäume. Sie können unmöglich in solcher Finsternis von der anderen Seite der Straße her jemanden erkannt haben, der im Garten jenseits der Pforte stand. So bleibt nur der Schatten, den Sie gesehen haben. Daraufhin beschuldigen Sie die Tochter eines angesehenen Mannes.«
»Auch in angesehenen Häusern gibt es Verbrechen.«
»Machen Sie sich doch einmal den Widerspruch in Ihrem Gedankengang klar. Warum sind Sie gestern Ihrem Mann nachgegangen? Offenbar doch aus Eifersucht. Sie bildeten sich ein, dass er zu einer Geliebten ginge …«
»Jawohl, und ich hätte das Weib in Stücke reißen können.«
»Sie bestätigen mit Ihren Worten eine bekannte Regel: Man tötet aus Hass, nicht aus Liebe. Warum denn sollte diese Frau den Mann getötet haben, den sie liebte?«
»Fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht. Aber dort ist er gewesen, dort hat man ihn vergiftet, hat sein Leben und mein Leben mit dem seinen vernichtet.«
»Sie sagen, das Gift ist ihm ein paar Stunden vor seinem Tod eingegeben worden, und weil er dort war, soll es dort geschehen sein. Aber ein paar Stunden vor seinem Tod war Xaver Stieler auch noch an einem anderen Ort. Er war in Ihrer Wohnung, Frau Baratta.«
»Was … ich … bin ich rasend geworden, dass ich Worte höre, die nicht möglich sind …?«
»Beantworten Sie mir die Frage: Hat Ihr Mann in Ihrem Zimmer etwas genossen, getrunken?«
»Nein, ich weiß es nicht …«
»Besinnen Sie sich, vielleicht fällt es Ihnen doch noch ein. Ihre Wohnungsgeberin ist vernommen worden. Sie hat von einem leeren Glas gesprochen, das in Ihrem Zimmer stand, und worin ein Rest von einem weißlichen Pulver war …«
»Ja, jetzt weiß ich’s wieder. Mein Mann hat auf mein Zureden zur Beruhigung der Nerven eines von meinen Pulvern genommen. Er hatte lebhaft gesprochen …«
»Jawohl, sehr lebhaft. Einen Streit hat es zwischen Ihnen gegeben, den man draußen auf dem Korridor deutlich gehört hat. In solcher Stimmung haben Sie den Beruhigungstrank für Ihren Mann gemischt.«
Er sprach laut, mit bitter scharfem Hohn. Und Afras Verhalten zeigte, dass ihr deutlich bewusst war, was an verstecktem Vorwurf hinter seinen Worten lauerte. Das Beben der Hände pflanzte sich in ihren ganzen Körper fort, ein Phosphorglanz kam in ihre Augen.
»Sprechen Sie’s doch aus«, rief sie beinahe schreiend. »Sagen Sie mir’s ins Gesicht, ich habe meinen Mann ermordet! Haben Sie den Mut auszusprechen, was Sie zu denken wagen. Ich ihn getötet, ich ihn vergiftet! Ihn, der so herrlich und edel und gut war. Aber ich kenne Sie jetzt. Wir beide haben in Zukunft nichts mehr miteinander zu schaffen.«
Sie schüttelte die hocherhobenen Fäuste wütend gegen ihn, wandte sich dann plötzlich um und stürzte zur Tür hinaus.
Der Kommissar, der beobachtend beiseite gestanden hatte, trat eilig vor. »Soll ich ihr nicht nachgehen, sie festhalten, sie verhaften?«
Germelmann schüttelte den Kopf. Sein Gesicht war heiß und rot geworden. »Lassen Sie, nein, dafür haben wir noch nicht Anhalt genug.«
Er schöpfte tief Atem, blies die Luft hörbar von sich. »Donnerwetter, das ist ein Weib! Scheinbar Hysterikerin erster Klasse. Die wird uns noch schön zu schaffen machen. Es ist eine verteufelte Geschichte.«
»Herr Amtsgerichtsrat meinen …?«
»Ich meine, dass die Person mit ihrer Eifersucht uns eine höchst unangenehme Sache eingebrockt hat. Kommerzienrat Rainer ist einer von den angesehenen, reichen Bürgern unserer Stadt. Und ausgerechnet seine Tochter wird von dieser Kinoprinzessin verdächtigt.«
»Immerhin dürfte das eine doch wohl sicher sein, dass dieser Xaver Stieler gestern Abend im Garten der Villa Rainer gewesen ist.«
»Das ist es ja, was mir die Geschichte so fatal macht.
Wenn ich auch noch so sehr von Fräulein Rainers Unschuld überzeugt bin, bei der Wahl zwischen ihr und solch einer Theaterdame spricht nach meinem Urteil von vornherein alles für sie. Wir werden doch nicht umhin können, dort in der Villa Rainer Nachfrage zu halten.«
»Das wird sich allerdings nicht vermeiden lassen.«
»Wir müssen es natürlich möglichst diskret machen in der Form. Ich will Fräulein Rainer nicht hierher zitieren, sondern selber in ihre Villa gehen. Und ich bitte Sie, mit mir zu kommen.«
Bauer verbeugte sich militärisch. »Wie Herr Amtsgerichtsrat wünschen. Wann sollen wir gehen?«
»Wir müssen rasch sein. Ich denke, heute Nachmittag um fünf Uhr wird passen. Ich habe bis dahin noch zu tun. Wenn Sie mich hier abholen wollen, können wir zusammen hinausfahren.«
»Gewiss, Herr Amtsgerichtsrat.«
»Und Gott soll uns in Gnaden vor noch mehr Theatervolk bewahren. Dem wird ja die Lüge durch seinen Beruf zur zweiten Natur. Bei dem Inder so gut wie bei dieser Baratta muss ich mich immer wieder fragen: Ist alles das nun Wahrheit oder ist es Komödie, was ich da vor mir sehe?«
Schreibe einen Kommentar