Die Trapper in Arkansas – Band 3.3
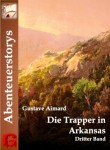 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 3
Zweiter Teil – Waktehno – der, welcher tötet
Kapitel 6 – Der letzte Sturm
Die hinter den Verschanzungen aufgestellten Lanceros hatten die Piraten energisch empfangen.
Der General, den der Tod des Captains Aguilar erbittert hatte und der einsah, dass einem solchen Feind gegenüber au keine Gnade zu rechnen sei, hatte beschlossen, sich aufs Äußerste zu verteidigen und lieber zu sterben, als in ihre Hände zu fallen.
Die Mexikaner waren Peons und Führer, auf welche man kaum rechnen konnte, und Frauen mit inbegriffen, nur siebzehn an der Zahl.
Die Piraten waren wenigstens dreißig Mann stark.
Es war mithin zwischen den Belagerern und Belagerten eine große Ungleichheit, doch vermöge der günstigen Lage der Verschanzungen, die sich auf der Höhe einer chaotischen Felsenmasse befanden, wurde dieses Verhältnis ziemlich ausgeglichen und man konnte annehmen, dass sich die Kräfte beinahe gleich seien.
Der Hauptmann Waktehno hatte sich über die Schwierigkeiten des Angriffes, welchen er wagte, – Schwierigkeiten, die bei einem offenen Sturm unüberwindlich waren, – keinen Augenblick getäuscht und deshalb auf einen Überfall und besonders auf die Treulosigkeit Schwätzers gerechnet. Nur die Gewalt der Umstände und die Erbitterung, die er über die Verluste empfand, die ihm der Captain Aguilar verursacht hatte, konnte ihn bestimmen, einen Sturm zu wagen. Aber nachdem sich die erste Hitze gelegt hatte und er sah, wie seine Leute, gleich reifen Früchten, rings um ihn fielen, ohne dass er sie rächen konnte, oder auch nur einen Fußbreit Terrain gewonnen hatte, entschloss er sich zwar nicht zum Rückzug, doch dazu, die Belagerung in eine Blockade zu verwandeln, in der Hoffnung, dass es ihm gelingen werde, in der Nacht einen Handstreich auszuführen oder im schlimmsten Fall die Belagerten durch Hunger zu zwingen.
Er glaubte die Gewissheit zu haben, dass sie von keiner Seite Hilfe erwarten könnten, da die Indianer jeden Weißen stets für einen Feind halten und die Trapper und Jäger nicht geneigt sind, sich in Angelegenheiten zu mischen, die sie nichts angehen und man sonst in jenen Prärien keinem Menschen begegnet.
Sobald sein Entschluss gefasst war, führte ihn der Hauptmann alsbald aus.
Er warf einen Blick um sich. Die Lage der Dinge war noch immer dieselbe, trotz der übermenschlichen Anstrengungen, welche die Piraten machten, um die steile Anhöhe, die zu den Verschanzungen führte, zu erklimmen, waren sie doch nicht um einen Schritt vorwärtsgekommen.
Sobald sich ein Mann frei zeigte, schickte ihn eine mexikanische Kugel in den Abgrund.
Der Hauptmann gab das Zeichen des Rückzuges, das heißt, er ahmte das Bellen des Präriehundes nach.
Der Kampf hörte sogleich auf.
Der Ort, der noch so eben das Geschrei der Kämpfenden und das Knallen der Schüsse belebt hatte, war plötzlich wieder von Schweigen umgeben.
Sobald die Menschen ihr Werk der Zerstörung eingestellt hatten, begannen die Kondore, Geier und Urubus das ihre.
Den Piraten folgten die Raubvögel, das war in der Ordnung.
Ganze Scharen Kondore, Geier und Urubus umkreisten die Leichen, auf welche sie mit gellendem Geschrei hernieder stießen, eine reichliche und schreckliche Mahlzeit von Menschenfleisch hielten, und zwar unter den Augen der Mexikaner, die sich aus den Verschanzungen nicht herauswagten und daher genötigt waren, Zuschauer des scheußlichen Festes der wilden Tiere zu sein.
Die Räuber versammelten sich in einer Schlucht, wo sie sicher vor den Kugeln aus dem Lager waren und zählten, wie viele von ihnen noch am Leben waren.
Ihr Verlust war ungeheuer, von vierzig Mann waren nur noch neunzehn übrig.
Es waren einundzwanzig Mann in weniger als einer Stunde getötet worden, mehr als die Hälfte der Truppe.
Die Mexikaner zählten, außer dem Captain Aguilar, weder Tote noch Verwundete.
Die Räuber wurden infolge ihres Verlustes bedenklich.
Die Mehrzahl stimmte für den Rückzug und wollte dem Ertrag eines Unternehmens, das mit so viel Gefahr und so großen Hindernissen verbunden war, entsagen.
Der Hauptmann war noch mutloser als seine Begleiter.
Wenn er weiter keine Absicht gehabt hätte, als Gold und Diamanten zu erbeuten, so würde er seinen Plan ohne Bedenken aufgegeben haben, aber ein anderer, stärkerer Grund trieb ihn zum Handeln an und reizte ihn, das Abenteuer bis ans Ende zu bestehen, welches auch immer der Erfolg desselben sein möge.
Das Kleinod, nach welchem er trachtete, war ein unschätzbares, es war Donna Luz, dasselbe junge Mädchen, welches er schon einmal in Mexiko aus den Händen der Räuber befreit, und für welches er, ohne dass sie es wusste, eine zügellose Leidenschaft empfand.
Er folgte Ihr von Mexiko an, Schritt vor Schritt, und lauerte wie ein Raubtier auf die Gelegenheit, seine Beute zu fassen, für deren Besitz ihm kein Opfer zu groß, keine Schwierigkeit unüberwindlich, keine Gefahr zu drohend war.
Daher suchte er seine Piraten durch alle Mittel, die die Sprache einem leidenschaftlichen Herzen bietet, bei sich zurückzuhalten, ihren Mut zu beleben, sie endlich zu bewegen, noch einen Angriff zu wagen, ehe sie sich entfernten und das Unternehmen ganz aufgäben.
Es kostete ihm viel Mühe, um sie zu überzeugen. Wie es bei ähnlichen Gelegenheiten zu gehen pflegt, waren es auch hier die Tapfersten, welche getötet worden waren; die noch Lebenden waren wenig geneigt, sich einem gleichen Schicksal auszusetzen.
Endlich gelang es dem Hauptmann, halb durch Drohungen, halb durch Versprechungen, ihnen das Zugeständnis zu entlocken, dass sie bis zum anderen Tag bleiben und in der Nacht einen entscheidenden Überfall wagen wollten.
Nachdem die Räuber sich darüber geeinigt hatten, befahl Waktehno seinen Leuten, sich so gut wie möglich zu verstecken und sich besonders nicht ohne Befehl von der Stelle zu rühren, welche Bewegungen die Mexikaner auch unternehmen mochten.
Der Hauptmann hoffte, wenn sie sich nicht zeigten, den Belagerten Glauben zu machen, dass die Piraten, abgeschreckt durch den ungeheuren Verlust, welchen sie erlitten hatten, sich zum Rückzug entschlossen und wirklich entfernt hätten.
Der Plan war gut genug ersonnen und führte in der Tat beinahe zu dem Resultat, welches der Hauptmann von demselben erwartet hatte.
Der rötliche Schein des Abendhimmels malte die Gipfel der Bäume und Felsen mit seinen letzten Strahlen, der Abendwind erhob sich und kühlte die Luft ab, die Sonne verschwand eben am Horizont hinter einem Schleier purpurner Nebel.
Nur das betäubende Geschrei der Raubvögel, welche noch immer ihr blutiges Fest hielten und sich mit wilder Gier um die Fetzen Fleisch stritten, die sie den Leichen abgerissen hatten, unterbrach das allgemeine Schweigen.
Der General, den der traurige Anblick tief erschütterte, besonders wenn er daran dachte, dass der Captain Aguilar, der Mann, dessen heldenmütige Aufopferung sie alle gerettet hatte, derselben Entweihung ausgesetzt sei, beschloss, seine Leiche nicht zu verlassen, sondern dieselbe, koste es, was es wolle, zu holen und beerdigen zu lassen; als eine letzte Ehre, die er dem unglücklichen, jungen Mann, der nicht gezögert hatte, sich für ihn aufzuopfern, zu erweisen gedachte.
Donna Luz, der er sein Vorhaben mitteilte, hatte, trotzdem sie die damit verbundene Gefahr einsah, nicht den Mut, ihn davon abzuhalten.
Der General wählte vier entschlossene Männer seiner Begleitung ans, erkletterte die Schanzen und ging mit ihnen in die Richtung, wo die Leiche des unglücklichen Hauptmanns lag.
Die in dem Lager zurückgebliebenen Lanceros beobachteten die Ebene und hielten sich bereit, ihre kühnen Kameraden bei ihrem frommen Vorhaben zu unterstützen, im Fall man sie stören wolle.
Die in den Felsenspalten lauernden Räuber verloren keine ihrer Bewegungen hüteten sich aber wohl, ihre Gegenwart zu verraten.
Der General konnte daher die Pflicht, die er sich auferlegt hatte, ungestört erfüllen.
Die Leiche des jungen Mannes war nicht schwer zu finden.
Sie lag halb rückwärts gebogen am Fuß eines Baumes. In der einen Hand hielt er noch die Pistole, in der anderen die Machete, der zurückgeworfene Kopf, starre Blick und lächelnde Mund schien noch im Tod denen, die ihn umgebracht hatten, zu trotzen.
Sein Körper war buchstäblich mit Wunden bedeckt, doch hatten ihn die Raubvögel durch einen seltsamen Zufall, den der General mit Freuden bemerkte, bis dahin verschont.
Die Lanceros legten die Leiche auf ihre gekreuzten Flinten und eilten im Sturmschritt in das Lager zurück.
Der General folgte ihnen in geringer Entfernung und beobachtete und überwachte das Dickicht und die Gebüsche.
Es regte sich nichts, die größte Ruhe herrschte allenthalben, die Räuber waren verschwunden und hatten keine andere Spur hinterlassen als ihre Toten, die sie verlassen zu haben schienen.
Der General gab sich der Hoffnung hin, dass sich seine Feinde zurückgezogen hätten, und seufzte erleichtert.
Die Nacht brach mit gewohnter Schnelligkeit herein, alle Blicke waren aufmerksam auf die Lanceros, die ihren toten Offizier trugen, gerichtet. Niemand sah, dass zwanzig Schatten schweigend über die Felsen glitten und sich allmählich dem Lager näherten, sich in der Nähe desselben auf die Lauer legten und dessen Verteidiger mit glühenden Blicken maßen.
Der General ließ die Leiche auf ein Ruhebett legen, welches in der Eile errichtet worden war, nahm ein Grabscheit und schickte sich an, das Grab, das den jungen Mann aufnehmen sollte, selbst zu graben.
Alle Lanceros scharten sich um dasselbe und lehnten sich auf ihre Waffen.
Der General entblößte sein Haupt, nahm ein Gebetbuch zur Hand und las das Totenamt mit lauter Stimme vor, auf welches seine Nichte und die Anwesenden mit Andacht die Responsorien gaben.
Es lag in dieser einfachen, inmitten der Wildnis abgehaltenen Feier, welcher sich die tausend Töne der Prärie im Gebet anzuschließen schienen, etwas Großartiges und Rührendes.
Angesichts jener großartigen Natur schien der Geist Gottes sichtbar zu walten.
Der Greis mit dem weißen Haar, der über der Leiche eines Jünglings, beinahe noch eines Knaben, das Totenamt hielt, indessen ihn das junge Mädchen und traurige, in gedankenverlorene Soldaten, denen vielleicht bald ein gleiches Schicksal beschieden war, die aber ruhig und ergeben für denjenigen beteten, der gestorben war, umstanden. Das feierliche Gebet, das in der Nacht und vom Abendwind, der rauschend durch das Laub der Bäume strich, begleitet, zum Himmel aufstieg, erinnerte an die ersten Zeiten des Christentums, wo der verfolgte und flüchtige Gläubige sich in die Wildnis zurückzog, um Gott näher zu sein.
Die heilige Handlung wurde durch nichts unterbrochen.
Nachdem alle Anwesenden noch einen letzten, traurigen Abschied von dem Toten genommen hatten, wurde er, in seinen Mantel gehüllt, in die Gruft gesenkt. Man legte seine Waffen neben ihn und schüttete das Grab zu.
Bald bezeichnete nur noch eine leichte Erderhöhung, die auch bald verschwunden sein würde die Stelle, wo die Leiche eines Mannes, dessen ungekannter Heldenmut diejenigen, die ihm die Sorge für ihr Wohl anvertraut hatten, durch ein großmütiges Opfer gerettet, für die Ewigkeit ruhte.
Die Anwesenden trennten sich mit dem Versprechen, den Toten entweder zu rächen oder vorkommenden Falls wie er zu sterben.
Die Dunkelheit war vollständig hereingebrochen. Nachdem der General noch eine Runde gemacht und sich überzeugt hatte, dass die Wachen auf ihrem Posten waren, wünschte er seiner Nichte eine Gute Nacht und lagerte sich auf dem Boden quer vor dem Eingang des Zeltes derselben.
Es verstrichen drei Stunden in der größten Ruhe. Plötzlich erkletterten etwa zwanzig Mann, lautlos wie eine Truppe Dämonen, die Befestigungen, und ehe die, von dem unerwarteten Angriff überraschten Wachen, den geringsten Widerstand leisten konnten, wurden sie gefasst und umgebracht.
Das Lager der Mexikaner war von den Räubern besetzt und Mord und Plünderung folgten ihnen auf dem Fuß.
Schreibe einen Kommentar