Die Trapper in Arkansas – Band 2.11
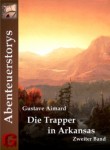 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 2
Erster Teil – Treuherz
Kapitel 20 – Die Martern
Sobald der Skalptanz beendet war, stellten sich die angesehensten Krieger mit den Waffen in der Hand vor den Pfahl, indessen die Frauen, besonders die älteren, die sich über die Verurteilte herwarfen, sie stießen, an den Haaren zogen und schlugen, ohne dass sie den geringsten Widerstand leistete, oder auch nur versuchte, sich der schlechten Behandlung, der man sie aussetzte, zu entziehen.
Die unglückliche Frau ersehnte nur eins, die Marter beginnen zu sehen.
Sie war den Fortschritten des Skalptanzes mit fieberhafter Ungeduld gefolgt, so groß war ihre Angst, dass ihr geliebter Sohn sich zwischen sie und ihre Henker stellen könne.
Wie die Märtyrer der alten Zeit warf sie den Indianern vor, dass sie die kostbare Zeit mit überflüssigen Zeremonien verlören. Sie hätte sie, wenn sie die Kraft dazu gehabt hätte, zurechtgewiesen und wegen der Langsamkeit und Flauheit, mit der sie ihr Opfer zu betreiben schienen, verspottet haben.
Die Wahrheit zu sagen, war es den Comanchen, trotzdem ihnen die Strafe gerecht schien, doch unwillkürlich zuwider, eine wehrlose, alte Frau zu quälen, die ihnen niemals weder direkt noch indirekt geschadet hatte.
Sogar Adlerkopf empfand, trotz seines Hasses, etwas wie einen geheimen Vorwurf wegen des Verbrechens, was er beging. Statt die letzten Vorbereitungen zu betreiben, traf er sie mit einem Widerwillen und einer Lässigkeit, die er nicht überwinden konnte.
Es ist für tapfere Männer, die daran gewöhnt sind, sich den größten Gefahren auszusetzen, immer eine ehrlose Handlung, wenn sie ein schwaches Geschöpf, eine Frau, das keine anderen Waffen hat als ihre Tränen, zu martern. Wenn es ein Mann gewesen wäre, so würde der ganze Stamm einstimmig verlangt haben, dass man ihn an den Pfahl binden müsse.
Die indianischen Gefangenen spotten der Qualen, sie schmähen ihre Henker und werfen ihren Siegern in ihren Sterbegesängen vor, dass sie feige und ungeübt in der Art, ihre Opfer zu quälen seien. Sie zählen ihre Heldentaten auf und nennen, ehe sie selbst unterliegen, die Zahl derjenigen, deren Haar sie geraubt haben, sie reizen überhaupt durch ihre Spöttereien und ihre verächtliche Haltung den Zorn ihrer Henker, entflammen ihren Hass von Neuem und rechtfertigen dadurch gewissermaßen die Grausamkeit derselben.
Doch welches Interesse konnte die Hinrichtung einer schwachen, ergebenen Frau haben, die bereits halb tot sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen ließ.
Dabei war nicht nur kein Ruhm zu erwerben, sondern man setzte sich noch dem allgemeinen Tadel aus.
Das sahen die Comanchen ein und handelten deshalb mit so großem Widerwillen und Unentschlossenheit, aber die Sache musste ein Ende nehmen.
Adlerkopf trat zu der Gefangenen und befreite sie von den Harpyien, die sie quälten.
»Frau«, sagte er in dumpfem Ton, »ich habe mein Wort gehalten. Dein Sohn ist nicht gekommen, du wirst sterben.«
»Dank«, sagte sie mit gebrochener Stimme und lehnte sich gegen einen Baum, um nicht zu fallen.
Der indianische Häuptling sah sie an, er hatte sie nicht verstanden. »Fürchtest du den Tod nicht?«, fragte er sie.
»Nein«, erwiderte sie und blickte ihn mit der Sanftmut eines Engels an, »er wird mir willkommen sein. Mein Leben ist nur ein langer Todeskampf gewesen, es wird eine Wohltat für mich sein, wenn ich sterbe.«
»Aber dein Sohn?«
»Mein Sohn ist gerettet, wenn ich sterbe. Du hast es bei den Gebeinen deines Vaters geschworen.«
»Ich habe es geschworen.«
»So überliefere mich doch dem Tode.«
»Sind denn die Weiber deines Volkes wie die indianischen Squaws, welche die Marter sehen, ohne zu beben?«, fragte der Häuptling erstaunt.
»Ja«, antwortete sie bewegt, »alle Mütter verachten sie, wenn es sich um ihre Kinder handelt.«
»Höre«, sagte der Indianer, der sich unwillkürlich von Mitleid ergriffen fühlte. »Auch ich habe eine Mutter, welche ich liebe. Wenn du es wünschst, kann ich deine Hinrichtung aufschieben bis zum Sonnenuntergang.«
»Warum das?«, antwortete sie mit rührender Naivität, »nein, Krieger, wenn dich mein Schmerz wirklich rührt, so kannst du mir eine Gnade, nur eine, gewähren.«
»Sprich«, sagte er eifrig.
»Lass mich sogleich sterben.«
»Wenn aber dein Sohn käme?«
»Was kümmert es dich? Du musst ein Opfer haben, nicht wahr? Nun wohl, dieses Opfer steht vor dir. Du kannst es nach Gefallen quälen. Warum zögerst du? Lass mich sterben, sage ich dir.«
»Dein Wunsch soll erfüllt werden«, antwortete der Comanche traurig. »Weib, bereite dich darauf vor.«
Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken und wartete.
Auf ein Zeichen Adlerkopfs fassten zwei Krieger die Gefangene und banden sie mitten um den Leib an den Pfahl.
Nun begann das Spiel mit dem Messer. Es besteht aus Folgendem: Jeder Krieger fasst sein Skalpiermesser mit dem Daumen und Zeigefinger bei der Spitze an und wirft es nach dem Opfer, aber so, dass ihm nur leichte Wunden beigebracht werden.
Die Indianer suchen bei ihren Hinrichtungen die Marter so lange wie möglich auszudehnen. Sie geben ihrem Feind den Gnadenstoß erst dann, wenn sie ihm das Leben allmählich, sozusagen stückweise, entrissen haben.
Die Krieger warfen ihre Messer mit so wunderbarer Geschicklichkeit, dass sie alle die Unglückliche streiften, ohne ihr etwas anderes als leichte Wunden zu verursachen.
Doch floss ihr Blut, sie hatte die Augen geschlossen, und ganz in sich gekehrt, betete sie inbrünstig und flehte um den Todesstoß.
Die Krieger, denen ihr Körper als Ziel diente, erhitzten sich allmählich. Die Neugier, der Wunsch, ihre Geschicklichkeit zu zeigen, waren bei ihnen an die Stelle des Mitleidens, welches sie anfangs empfunden hatten, getreten. Die Geschicktesten wurden mit lautem Geschrei und Gelächter für ihre Heldentaten belohnt.
Mit einem Wort, es geschah was immer, sowohl bei zivilisierten als bei wilden Völkern geschieht. Das Blut berauschte sie, ihr Ehrgeiz kam ins Spiel. Jeder strebte danach, es seinem Vorgänger zuvorzutun, und jede andere Rücksicht war vergessen.
Als alle ihre Messer geworfen hatten, nahm eine kleine Anzahl der geschicktesten Schützen ihre Flinten zur Hand.
Dies Mal galt es, einen sicheren Blick zu haben, denn eine schlecht gezielte Kugel konnte der Marter ein Ende machen und den Anwesenden das anziehende Schauspiel, von dem sie so viel Vergnügen erwarteten, entziehen.
Das arme, zusammengebückte Geschöpf gab bei jedem Schuss kein anderes Lebenszeichen, als ein nervöses Zittern, welches ihren ganzen Körper erschütterte.
»Lasst uns enden«, sagte Adlerkopf, dessen eisernes Herz von so viel Mut und Entsagung erweicht wurde. »Die Krieger der Comanchen sind keine Jaguare. Die Frau hat genug gelitten, sie sterbe und damit gut.«
Unter den Squaws und Kindern, welche der Marter der Gefangenen am gierigsten gefolgt waren, entstand ein Murren des Missvergnügens.
Die Krieger hingegen waren der Ansicht des Häuptlings. Diese Hinrichtung, welcher die Schmähungen fehlten, die das Opfer gewöhnlich an seine Sieger richtet, hatte keinen Reiz für sie und sie schämten sich innerlich, eine Frau so hartnäckig zu quälen.
Man schenkte der Unglücklichen daher die hölzernen Stäbchen, welche unter die Nägel geschoben werden, die Schwefellunte, die man zwischen die Finger bindet, die Honigmaske, mit der das Gesicht überzogen wird, damit es die Bienen zerstechen und noch andere Martern, die einzeln aufzuzählen zu lange währen würden, und man bereitete den Scheiterhaufen, auf welchem sie verbrannt werden sollte.
Doch bevor man zum letzten Akt dieser scheußlichen Tragödie schritt, band man die arme Frau los. Man ließ sie einige Augenblicke zu Atem kommen und sich von den fürchterlichen Erschütterungen, welche sie ertragen musste, erholen.
Die Arme fiel erschöpft, beinahe ohnmächtig hin.
Adlerkopf näherte sich ihr. »Meine Mutter ist mutig«, sagte er, »mancher Krieger hätte die Prüfungen nicht mit so viel Mut bestanden.«
Ein mattes Lächeln flog über ihre bläulichen Lippen. »Ich habe einen Sohn«., sagte sie mit einem unaussprechlich sanften Blick, »ich leide für ihn.«
»Ein Krieger, der eine solche Mutter hat, ist glücklich.«
»Warum wird mein Tod verzögert? Es ist grausam, so zu handeln. Die Krieger sollen nicht grausam gegen Frauen sein.«
»Meine Mutter hat recht, ihre Qualen sind beendet.«
»Werde ich endlich sterben?«, sagte sie mit einem Seufzer der Erleichterung.
»Ja, der Scheiterhaufen wird errichtet.«
Die arme Frau fühlte sich bei dieser grässlichen Nachricht unwillkürlich erbeben. »Mich verbrennen«, rief sie voll Entsetzen, »warum will man mich verbrennen?«
»Es ist so Brauch.«
Sie ließ den Kopf in ihre Hände sinken, doch bald richtete sie sich wieder auf, sandte einen begeisterten Blick gen Himmel und murmelte mit Ergebenheit: »Mein Gott, dein Wille geschehe.«
»Fühlt sich meine Mutter stark genug, um an den Pfahl gebunden zu werden?«, fragte der Häuptling mitleidig.
»Ja«, sagte sie und stand entschlossen auf.
Adlerkopf konnte eine Gebärde der Bewunderung nicht unterdrücken. »Kommt!«, sagte er.
Die Gefangene folgte ihm mit festem Schritt. Ihre ganze Kraft war wiedergekehrt, denn sie sollte endlich sterben!
Der Häuptling führte sie zum Blutpfahl, an welchen sie zum zweiten Mal festgebunden wurden. Man häufte Stücken grünen Holzes vor ihr auf und brannte sie auf ein Zeichen Adlerkopfs an.
Anfangs entzündete sich das Feuer, wegen der Feuchtigkeit des Holzes, welches einen dicken Rauch entwickelte, nur sehr langsam. Endlich, nach einigen Sekunden, blitzte die Flamme auf, verbreitete sich allmählich und gewann in wenigen Minuten eine bedeutende Kraft.
Die unglückliche Frau konnte einen Schrei des Entsetzens nicht unterdrücken.
Im selben Augenblick erschien ein Reiter, der mit verhängtem Zügel heransprengte, mitten im Lager. Mit einem Sprung war er abgestiegen, und ehe man Zeit gewonnen hatte, ihn daran zu verhindern, begann er das Holz des Scheiterhaufens auseinanderzureißen und zerschnitt die Fesseln des Opfers.
»Ach! Warum bist du gekommen?, murmelte die unglückliche Frau und fiel ihm um den Hals.
»Meine Mutter! Verzeih mir!«, rief Treuherz verzweiflungsvoll. »Großer Gott! Was hast du leiden müssen.«
»Geh! Geh, Rafael!«, wiederholte sie und überhäufte ihn mit Liebkosungen, »lass mich statt deiner sterben. Soll eine Mutter nicht für ihr Kind ihr Leben lassen?«
»Ach! Sprich nicht so, Mutter! Du machst mich wahnsinnig!«, sagte der junge Mann und drückte sie verzweiflungsvoll ans Herz.
Indessen hatte sich die Bewegung, welche Treuherz’ plötzliches Erscheinen im Lager verursacht hatte, wieder gelegt. Die indianischen Krieger zeigten wieder den Gleichmut, den sie bei jeder Gelegenheit zur Schau trugen.
Adlerkopf näherte sich dem Jäger.
»Mein Bruder ist willkommen«, sagte er, »ich erwartete ihn nicht mehr.«
»Hier bin ich, es war mir unmöglich, eher zu kommen. Meine Mutter ist vermutlich frei?«
»Sie ist frei.«
»Sie kann gehen, wohin sie will?«
»Wohin sie will.«
»Nein«, rief die Gefangene aus und trat dem indianischen Häuptling entschlossen entgegen, »es ist zu spät, ich muss sterben, mein Sohn hat nicht das Recht, an meine Stelle zu treten.«
»Mutter, was sagst du? …«
»Was gerecht ist, Rafael«, fuhr sie lebhaft fort, »die Stunde, zu welcher du kommen solltest, ist vorüber. Du hast nicht das Recht, hier zu sein und meine Hinrichtung zu verhindern. Geh fort, geh, Rafael, ich beschwöre dich. Lass mich sterben, um dich zu retten«, fügte sie hinzu, indem sie in Tränen ausbrach und sich in seine Arme warf.
»Mutter«, erwiderte der junge Mann und überhäufte sie mit Liebkosungen. »Deine Liebe zu mir verblendet dich. Ich kann einen solchen Frevel nicht zugeben, nein, nein, ich allein werde hier bleiben.«
»Mein Gott, mein Gott«, sagte die arme Frau schluchzend. »Er will nichts hören! … Es würde mich so glücklich machen, zu sterben, um ihn zu retten.«
Von einer Rührung überwältigt, die über ihre Kräfte ging, sank die arme Mutter ohnmächtig in die Arme ihres Sohnes.
Treuherz drückte einen langen, zärtlichen Kuss auf ihre Stirn und übergab sie dann Eusebio, der vor wenigen Augenblicken angekommen war.
»Geht!«, sagte er mit vor Schmerz erstickter Stimme, »meine Mutter! Möge sie glücklich sein, wenn ihr dies, ohne ihr Kind, noch möglich sein wird.«
Der alte Diener seufzte, drückte warm Treuherz’ Hand, legte dann seine Gebieterin vor sich auf den Sattel, wandte sein Pferd und verließ langsam das Lager, ohne dass jemand sein Entfernen verhinderte.
Treuherz folgte seiner Mutter mit Blicken, solange er sie sehen konnte. Als sie verschwunden und die Tritte des Pferdes, das sie trug, verhallt waren, stieß er einen unterdrückten Seufzer aus, strich sich mit der Hand über die Stirn und murmelte: »Nun ist alles vorbei! Mein Gott! Wach du über ihr!«
Dann wandte er sich zu den indianischen Häuptlingen, die ihn mit einer Mischung von Ehrerbietung und Verwunderung betrachteten.
»Krieger der Comanchen!«, sagte er mit fester, eindringlicher Stimme und einem vernichtenden Blick. »Ihr seid alle Feiglinge! Echte Männer quälen keine Frau!«
Bei diesen Worten setzte er dem unschuldigen Geschöpf eine Pistole vor die Stirn, das, als es die Kälte des Eisens fühlte, ein erbärmliches Geschrei ausstieß.
»O!«, stöhnte Adlerkopf verzweiflungsvoll, »mein Sohn! Gebt mir meinen Sohn wieder!«
»Und deine Frau, hast du die vergessen?«, antwortete Belhumeur achselzuckend und mit ironischem Lächeln.
»Welches sind Eure Bedingungen?«, fragte Treuherz.
Schreibe einen Kommentar