Über mittelalterliche Burgen – Teil 2
Über mittelalterliche Burgen – Teil 2
Joseph Edler von Scheiger sagt über die innere Einrichtung der alten Burgen nur zu wahr, dass, wer diese nicht aus mühsamen eigenen Forschungen, sondern nur aus den höchst romanhaften Beschreibungen erzählender Schriftsteller oder gar aus der ohne Beurteilung lokaler Verhältnisse sehr widersinnig zusammengestellten Dekorierung der sogenannten restaurierten Ruinen kennt, von derselben gewiss einen höchst irrigen Begriff erhalten habe.1
Jene Prunkstücke, mit denen man sich gewöhnlich das Innere einer Ritterfeste ausgeschmückt denkt, fand man selten in denselben. Nur in landesfürstlichen oder dem höchsten Adel angehörigen Burgen, und auch darunter nur in solchen, welche mehr zu vergnüglichem Aufenthalt und Geschäften des Friedens, als zur Sicherheit, zur Aufnahme von Kriegsvolk dienten. Von denjenigen Burgen, bei deren Gründung der kriegerische Zweck der Verteidigungswerke vorwiegend berücksichtigt wurde, zeichnen sich manche durch eine um glaubliche Kühnheit in der Anlage auf unzugänglichen Felsbildungen aus. So zum Beispiel die auf mehreren Felskuppen bei Sigmaringen erbaute Veste Wildenstein, die in der Tat ihrem Namen entspricht; ferner die Dagsburg im Elsass, welche auf gewöhnliche Weise so schwer zugänglich erscheint, dass die gewöhnliche Verbindung vermittelst eines Kranes bewerkstelligt werden muss. Auch die vom Bodensee rings umwogte Burg Langenargen gehört ihrer eigentümlichen Lage wegen hierher, sowie die Veste Münchenstein bei Basel, die wie aus dem Gestein emporgewachsen hervorragt.
Die Wohngemächer der Burgherren, ihrer Hauptleute usw. beherbergten gewöhnlich die ganze Familie. Mächtige zweischläfrige Bettstellen, hölzerne Truhen zur Aufbewahrung der Habseligkeiten, schwere eichene Tische bildeten die Haupteinrichtungsstücke. Erwähnenswert ist, dass der Luxus weicher Federbetten, wie uns manches alte Inventar zeigt, schon am Ende des kräftigen 15. Jahrhunderts nicht selten war. Die steinernen Fensterbänke, die in die Mauer gefügten Wandschränke oder bloße Mauerblendungen ersetzten manches andere Gerät. Geschirrstellen und Nägel an der Wand zum Aufhängen von Kleidern und Waffen fehlten beinahe nie. Eine Kunkel, ein Betschemel und ein geschnitztes Heiligenbild, vielleicht auch ein einfaches tragbares Flügelaltärchen bezeichneten den der Frau angewiesenen Platz. Mächtige Öfen, aus Ziegeln aufgetürmt oder von Töpferarbeit ausgeführt, erwärmten das Gemach. Manche Fenster hatten keinen anderen Schutz als Bretterläden, die auch nicht immer in Angeln hingen, sondern, wie deutliche Spuren zeigen, bloß angelehnt und mit Schubriegeln geschlossen oder selbst zu beiden Seiten in die Mauer zurückzuschieben waren. Die Alten waren keine Freunde vieler Fenster. Sie betrachteten ihre Wohnungen mehr als Höhlen zum Schutz vor der Witterung und vor feindlichen Angriffen, wo sie ihren Raub sicher teilen und bewahren, auch die strenge Winterzeit ausdauern konnten. Unsere Fensterscheiben waren dem Mittelalter bis zum 15. Jahrhundert unbekannt. Es wird von Chronisten als besondere Merkwürdigkeit hervorgehoben, dass im 15. Jahrhundert zu Basel bei einigen wenigen Häusern an die Stelle des geölten Papiers oder Horns Glas getreten war. Das Rathaus zu Zürich hatte noch 1402 statt der Fenster Tuchvorhänge und die Wohnungen der französischen Könige waren wie die Kirchen mit Fenstern aus buntem Glas verziert. Von dem Herzog von Northumberland, dem Reichsten in England, erzählt man, dass er in der Mitte des 17. Jahrhunderts die Fenster seines Schlosses jedes Mal herausnehmen und sorgfältig verpacken ließ, so oft er verreiste. Sogar gegen Ende des 17. Jahrhunderts waren nur die Hauptgemächer der königlichen Schlösser mit Fenstern aus farblosem Glas versehen. In den Schlössern des Adels und den Häusern der vornehmen Bürger versahen feine Darmhäute oder Flechtwerk aus Weidenruten die Stelle der Fenster. An Glas, welches damals kostspielig und selten war, darf man also bei solchen Luftlöchern nicht denken. Als im Jahre 1658 die französische Gesandtschaft ihren Einzug in Madrid hielte um die Hand der Infantin für Louis XIV. anzuhalten, wandelte sie durch viele mit Gemälden und Statuen verzierte Säle, die größtenteils dunkel waren, weil wegen der Seltenheit des Glases manche nur sehr kleine, manche gar keine Fenster hatten. Auf den Burgen waren die Fensterchen entweder mit Darmhäuten bezogen oder nur mit hölzernen Flügeln geschlossen oder sie waren bestimmt, stets offenzubleiben. In Wien datieren die ersten Glasfenster aus dem Jahr 1458. Diese waren hier wie anderwärts aus sehr kleinen, runden Scheiden, die in der Mitte bedeutende Erhöhungen hatten, zusammengesetzt. Später kamen sechs- und achteckige oder rautenförmige Scheiben zum Vorschein, die durch bleierne Einfassungen zusammengehalten wurden. Bei den Glasern gelangten erst im 16. Jahrhundert die Diamantsplitter in Anwendung. Vorher hatte man sich zum Schneiden des Glases sehr harter Stahlstifte oder eines glühenden Eisens bedient.
Die Zimmerdecken bestanden, wo sie nicht durch Gewölbe ersetzt waren, aus Balken, die man zuweilen mit Schnitzwerk zierte oder durch einen Leimanstrich bräunte; die Fußböden aus Estrich, der Kälte wegen mit Matten belegt, oder aus Steinpflaster. Später machten die einfachen Balkendecken den aus Tafeln gefügten, oft sehr zierlichen Plafonds, der Estrich den schmuckvolleren Steinfliesen, Ziegeln oder feinerer Töpferarbeit Platz. Die Wände waren nicht gemalt, sondern meistens weiß, mit jenem glänzenden, marmorähnlichen, glatten Mörtel der Alten überzogen, die Türen mit einfachen Schlössern versehen und gewöhnlich ohne Verkleidung in die Türöffnung eingehängt. Die mysteriösen Falltüren, von denen die Ritterromane vom Ende des vorletzten Jahrhunderts fabeln, finden sich höchst selten. Im Schloss Prunn an der Altmühl existierte eine solche unter dem Bett des Prokuratorzimmers. Durch sie gelangte man in ein darunter befindliches geräumiges, verborgenes Gemach.
Sehr einfach sah es in den Wohngemächern der untergeordneten Burgleute aus. Da waren Bettstellen mit Heu und Stroh gefüllt, dann mit Tierfellen überdeckt.
Die Küchen mit ihren ungeheuren Herden und Schornsteinen bildeten größtenteils den Unterhaltungs- und auch Arbeitsplatz der niederen Bergleute. Dort fand man daher außer den Kochgeschirren und mächtigen, von Holzverschwendung zeugenden Feuerherden, auch ringsum Bänke und neben dem Herd Stangen, um durchnässte Kleider zu trocknen. Zur Beleuchtung dienten Späne auf eisernen Leuchtern oder Talglampen, denn Öl und Kerzen für die Wohnzimmer waren späteren Ursprungs als jene. Man denke sich in jenen Schlossküchen, sagt Friedrich Otto von Leber2, ja keine erfreuliche Kost. Viele Menschen wurden freilich satt, aber meist auf erbärmliche Weise. An frisches Fleisch, neugebackenes Brot oder erquickende Gemüse war fast nicht zu denken. Altes Brot, das nur gebacken wurde, wenn der frühere Vorrat zu Ende ging. Gesalzene und geräucherte Fische, meist geräuchertes Rindfleisch und grobe Hülsenfrüchte bildeten die Hauptnahrung. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass heutzutage die Sträflinge eine viel bessere Kost genießen, als einst mancher Raubritter auf seinem Felsennest hatte. Die Kochkunst stand auf sehr niederer Stufe und wir würden uns eben so wohl über jene Gerichte, die man im 12. und 13. Jahrhundert in den vornehmsten Häusern aß, wie Reiher, Kraniche, Störche, Schwäne, Raben und Geier wundern als auch über die Essenzeiten. Das ganze Mittelalter hindurch wurde um zehn Uhr zu Mittag und um vier Uhr zu Abend gegessen. Taillevent, erster Koch Königs Karl VII., gab die Anweisung, die Mehrzahl dieser Geflügel zuzubereiten. Man aß viel, aber schlecht bereitet, und in den Burgen schlechter als in den Städten. Insbesondere blieb auf den deutschen Ritterburgen das gepökelte Rindfleisch an der Tagesordnung, welches so hart und schmucklos war, dass das längste Kochen es kaum genießbar machte, daher es gewöhnlich Bresil, vermutlich, weil es an Farbe und Härte jenem Holz glich, genannt wurde. Es wurde in kleine Streifen geschnitten und mit Weinessig gegessen.
Während nun auf den Burgen höchstens ein selbst erlegtes Wildbret einiges Leben in die Monotonie der Herrentafel brachte, mussten sich die Hofbedienten mit schwarzem Brot, stinkenden Fischen, zähem Kuh- oder gar Bärenfleisch und fast ungenießbaren Hülsenfrüchten begnügen. Wenn man bedenkt, was Aeneas Sylvius aus dem Geschlecht der Grafen von Piccolomini und später als Papst Pius II. verehrt, von der kaiserlichen Hofhaltung zu Wien und anderwärts erzählt, so kann man sich, selbst angenommen, dass die Schilderung übertrieben ist, einen Begriff davon machen, wie es auf abgelegenen Burgen ausgesehen haben mag. Er sagt, dass die Hofbediensteten nur verdorbenen und sauren Wein, an einigen Höfen gar nur Bier, und zwar das elendeste, erhielten. Sie bekämen bei ihren Tafeln keinen silbernen oder gläsernen Becher, denn man fürchte, dass man jenen stehlen und diesen brechen möchte. Alle müssten aus ein und demselben hölzernen Becher trinken, welcher noch überdies höchst unsauber sei. Man müsse abwarten, bis dieser Becher der Reihe nach an einen käme, da dann das Getränk sehr verunreinigt wäre. Die Speisen bestünden in einem zähen und schon halb faulen Fleisch von alten Kühen, Ziegen und Schweinen, dann in einem Obst, welches den Schweinen eben so schön vorgesetzt würde. Die Speisen seien äußerst miserabel zubereitet, mit stinkenden Ölen und Fett gekocht, sodass ihr bloßer Geruch zum Ekel und Erbrechen reize. Die Tischtücher würden nicht gewechselt, bis sie vom Tisch nicht mehr zu unterscheiden wären, und die Handtücher seien so zerrissen, schmutzig und mürbe, dass sie an den Fingern kleben blieben und dass die Gäste genötigt würden, ihre Finger mit den Kleidern abzuwischen. Das Brot wäre ganz schwarz und so hart, dass man beide Kinnladen anstrengen müsste, um etwas davon genießen zu können. Gewöhnlich müssten die Hofleute in einer Kammer und je zwei in einem Bett schlafen, dessen Leintücher nicht nur zerrissen und höchst unreinlich, sondern das noch überdies mit allen Arten von Ungeziefer angefüllt wäre usw. Auf diese Art wurde einige Zeit lang Aeneas Sylvius bewirtet, und er könne es, sagte er, dem Hofkanzler nicht genug danken, dass er ihn aus diesem Schweinstall, dessen Anblick er in die Länge nicht würde haben aushalten können, herausgenommen und an seine besser bestellte Tafel gezogen hätte.
Die Speisen der gemeinen Leute waren, wie leicht zu erachten, noch ungesünder und ekelhafter. In Bürgerhäusern kochte man gewöhnlich am Sonntag für die ganze Woche und wärmte die Speisen nur immer auf.
Die noch heutzutage in Wien üblichen Kaisersemmeln verdanken ihre Benennung dem Kaiser Friedrich IV., der im Jahre 1487 derlei Blätzlein mit seinem Bildnis unter die kleinen Kinder verteilen ließ. Dagegen erhob sich die Zuckerbäckerkunst während des gesamten Mittelalters nicht einmal zur Mittelmäßigkeit. Eigentliche Zuckerbäcker bestanden im Mittelalter nicht. Die Apotheker waren die Einzigen, welche Eingemachtes, Kandiertes (épices), getunktes Obst und Marmeladen verfertigten. Kaiser Maximilian I. brachte 1514 seine »Zuckerbläser« und Ferdinand I. im Jahr 1522 seine »Compostrey« (Zuckerbäckerei) aus den Niederlanden nach Wien mit.
Im Jahr 1407 war ein so kalter Sommer, dass alle Früchte verdarben und eine so große Hungersnot entstand, dass die Menschen Heu und Gras essen mussten und der Bissen Brot in Sachsen, so groß wie eine Walnuss, drei Pfennige – damals viel Geld – kostete. Diese kleinen Brötchen nannte man Marcusbrötchen. Man backte sie zum Andenken der betrübten Zeit in der Folge am Marcustag, wo sie dann reich gewürzt den Namen Marzipan erhielten.
Das Prunkvollste aller Burggemächer war wohl meistens die Kapelle, gewöhnlich mit einem Flügelaltar versehen und mit einigen Heiligenstatuen, Leuchtern, Rampen und Gemälden, Letztere meist in Fresko, verziert, bisweilen mit einer oder zwei Reihen Betstühlen. Nur darf man nicht glauben, dass alle Burgkapellen auch mit kirchlichen Gefäßen und Apparaten vollständig versehen waren, denn der Burgen, welche eigene Geistliche in ihren Mauern hatten und in welchen das heilige Messopfer gehalten wurde, waren nur wenig. Wo in einer älteren Burgkapelle an der Seite des Hauptaltares das bald mehr, das bald weniger zierliche, oft nur aus einer einfachen Mauerblende bestehende Sakramentshäuschen fehlt, kann man annehmen, dass auch die Berechtigung zum Messelesen fehlte. Einen vorzüglichen Schmuck der Kapellen bildeten in späterer Zeit die zierlichen Fensterrosen mit Glasgemälden. Eine der schönsten Fensterrosen in Zeichnung und kühner Anlage hat die alte Kapelle der Rosenburg, ein noch bewohntes Schloss in Österreich.

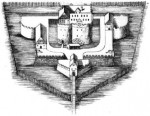

Schreibe einen Kommentar