Die Plauderstube – Die Abenteuer eines Leutnants – Kapitel 4
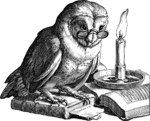 Die Abenteuer eines Leutnants
Die Abenteuer eines Leutnants
Novelle
Aus dem Schwedischen von E. Sickenberger
Sonntag, 3. März 1861
IV.
Wir lassen nur einen Monat vorübergehen. Der junge Leutnant hatte während der langen, warmen Sommertage seinen Kampf auf dem Exerzierplatz männlich ausgekämpft. Sicherlich hat der Obristleutnant kitzligen Angedenkens noch ein oder das anderes Mal versucht, ihn mit seinen Basiliskenaugen zu erschrecken, aber schließlich hatte der Leutnant seinerseits die Entdeckung gemacht, dass der Herr Obristleutnant selbst ein ganz großer Hasenfuß war, dessen einzige Stärke in seiner Mundfertigkeit und in einer guten Dosis Grobheit beruhte. Und da ein Poltron, mag er nun hoch oder niedrig sein, immer von einem Mann, der sein Herz auf dem rechten Fleck hat, einen gewissen Respekt haben muss, so gelang es auch endlich unserem Hjalmar sich mit seinem Plagegeist auf einen besseren Fuß zu setzen. Dieser beschloss, freilich noch etwas still grollend, außerdem die erste beste Gelegenheit abzuwarten, um einen deutlichen Beweis zu liefern, dass er seine kleinliche Rache aufgegeben habe.
Aber da nun das Glück wahrscheinlich die Wege unseres Helden so lenkt, dass diese Rachegedanken gänzlich verschwinden, so können wir mit gutem Gewissen und reiner Freude unseren edlen Obristleutnant, und zwar für immer verlassen.
Hjalmar hatte sich als ein großer Verehrer der Naturschönheiten gleich nach Beendigung der Exerzitien nach dem herrlichen Kinnekulle, diesem paradiesischen Lustgarten am Strand des Wenersee begeben und sich dort in einem Dorf bei einem wohlhabenden Bauern einquartiert. Es war eine liebliche Abwechselung von dem dumpfen Ton der Trommel, dem Gewehrgerassel, dem Fluch der Exerziermeister und der unfreundlichen Kaserne, sich plötzlich in die Einsamkeit der üppigen Laubwälder, unter Vogelgesang und Blütenduft versetzt zu sehen. Er beschloss deshalb, sich hier einige Wochen aufzuhalten und richtete sich zu diesem Ende, so gut er konnte, in seiner kleinen Kammer ein, von wo aus er eine entzückende Aussicht zu einer kleinen Bucht mit den reizendsten Inselchen hatte. Weiter im Hintergrund, auf der anderen Seite des Sees, tauchte Halle und Hunneberg samt der Küste von Dalsland wie lange blaue Streifen am Rand des Horizonts auf. Unzählige Segel schaukelten den ganzen Tag über auf den gelblichen Wogen des Sees, und bisweilen erblickte man auch einen schwarzen Rauch, der sicherlich aus einem Dampfschiff, diesem den Philistern so angenehmen, dichterischen Seelen aber so ungeheuer langweiligen und prosaischen Seeungeheuer aufsteigt.
Hjalmar war, als der letzteren Klasse der Sterblichen angehörend, natürlich auch mit Lektüre versehen. Die ersten Geister des schwedischen Parnasses hatten zu der auserwählten Bibliothek, die ihn in diese Einsamkeit begleitete, Beiträge geliefert, aber alle hatten nun dem unvergleichlichen Stagnelius bei Hjalmar Platz gemacht, und dieser war sein ständiger Begleiter auf seinen einsamen Promenaden. Es war auch natürlich, dass dieser schwärmende, mit Leidenschaft erfüllte und glühend heiße Dichter ein so junges und warmes Gemüt wie das Hjalmars erfüllte. In einigen Tagen war er denn auch ein kompletter Schwärmer geworden, der beständig von seiner überirdisch schönen Amanda träumte, die er sah
In Blüten, in Strahlen
Am Äther sich malen.
Hjalmar war so glücklich oder unglücklich, wie man will, bisher die Liebe noch niemals anders als aus Romanen zu kennen. Trotzdem verliebte er sich bald, Dank unserem Stagnelius, mit der ganzen Glut einer jugendlichen Seele in ein Ideal, das er endlich nach ein paar schlaflosen Nächten sich so deutlich und lebendig geschaffen hatte, dass er es mit klarem Auge vor sich sehen konnte. Dass es schön war, sehr schön, brauchen wir gewiss nicht zu sagen, da er es selbst geschaffen hatte; aber dass selbst den Schöpfer verwunderte, war der Umstand, dass das schöne Götterbild fortwährend seine Augen gesenkt hatte, und dass er beständig eine Träne in den langen Augenwimpern glänzen sah. Wie er auch sein Ideal umzuschaffen gedachte, immer hielt es die Augen hartnäckig gesenkt, und die Tränen glänzten unaufhörlich in den zauberischen Augen. War es eine Reminiszenz oder – was weiß ich! Vergeblich suchte Hjalmar sein Gedächtnis anzustrengen, ob er jemals oder irgendwo eine solch schöne wehmütige Figur gesehen habe. Aber es ging ihm, wie es uns gewöhnlich geht, wenn wir uns anstrengen, ein Bild aus der Vergangenheit in das Gedächtnis zurückzurufen. Je mehr wir denken und besinnen und nachgrübeln, desto undeutlicher wird das Bild, und endlich lässt sich alles in ein unordentliches Kaos auf. Hjalmar gab sich also alle Mühe, sein weinerliches Ideal so zu erhalten, wie es war; denn ein neues zu schaffen, hielt er, seit er manchen fruchtlosen Versuch gemacht hatte, für unmöglich.
Da nun das Ideal niedergeschlagen war, wusste sein Anbeter natürlicherweise diese Gemütsstimmung teilen, und deshalb klagte er mit Stagnelius also:
Ach! Nie wird mein Sehnen
Befriediget sein!
Bleich, seufzend in Tränen
Steh ich ewig allein.
Soll, Göttin, dich immer
als Sternbild nur seh’n,
Doch finden dich nimmer.
Oder:
Im Mondlicht ist worden
Ein Brautbett die Flur
Der Himmel ist worden
Ein Betthimmel nur;
Wenn Liebe die Schale
Der Seligkeit leert
Bin fern ich dem Mahle
Und Gram mich verzehrt.
Armer Junge! Es ist schade um ihn, dass er in der Welt der Fantasie von Ahnung und Wohnung, Entzückung und Berückung so gemartert wird. Das ging sogar so weit, dass er die delikaten Erdbeeren und den vortrefflichen Rahm, den ihm die Bauersfrau selbst eines Tages dargelegt hatte, nicht essen wollte.
»Warum machen Sie denn heute ein gar so verdrießliches Gesicht, Herr Leutnant?«, fragte die Bauersfrau, die eine gewisse mütterliche Liebe zu ihrem hübschen Gast gefasst hatte. »Warum essen Sie denn nicht; die Beeren sind so gut, dass selbst der König keine besseren bekommen kann. Ich und mein Mädchen haben sie selbst gepflückt. Aber sagen Sie in Gottes Namen, was haben Sie denn!«
»Ich bin krank. Hier fehlt mir’s, hier im Herzen«, sagte Hjalmar und seufzte.
»Sieh, deshalb sind Sie so grämlich. Da haben wir’s wieder«, rief Mutter Anderson.
»Im Herzen! Ja, den Schmerz hat das junge Volk all, aber deswegen können Sie bei uns doch essen. Aber was ist das für ein Fräulein, das dem Herrn Leutnant das Herz so schwer gemacht hat? Es wird doch keine so garstig sein, dass sie einen so hübschen Herrn so sehr quält. Freien Sie nur, freien Sie, so wird es mit dieser Krankheit bald ein Ende haben.«
»Ach nein – ich bin in keine verliebt«, unterbrach sie Hjalmar. »Ich kenne ja kein, kein einziges Mädchen auf vierzig Meilen im Umkreis, aber ich …«
»Will mich verlieben, hab ich’s erraten?«, unterbrach ihn die Frau. »Das will das junge Volk doch all, dass es sich so peinigen lässt! Aber das ist leicht geschehen, Herr Leutnant, hier auf Kinnekulle. Sie brauchen nur einmal die schönen Mädchen vom Herrenhof da drüben zu sehen, und ich schwöre darauf, dass Sie so verliebt werden wie ein junger Kater.«
»Sind junge Damen auf dem Herrenhof?«, fragte Hjalmar hastig und sprang auf.
»Jawohl, und schön, sehr schön sind sie auch. Sie heißen nicht umsonst weit und breit die Rosen von Kinnekulle. Herr, mein Gott! Wie sind diese Fräulein so hübsch, so schlank gewachsen, und obendrein sind sie so freundlich und so gemein. Das sollten Sie einmal sehen, wie sie im Garten ihre Blumen gießen und auf dem Geflügelhof ihre Tauben füttern; das ist eine wahre Freude. Sanft sind sie immer zu mir hergekommen, weil ich sie gar gut kenne, schon seit der Zeit, als sie noch als kleine Wildfänge bei mir herumsprangen, aber jetzt, seit der Herr Leutnant bei uns eingezogen ist, getrauen sie sich nicht mehr zu kommen, glaube ich; denn die Mädchen alle, hoch und niedrig, genieren sich immer etwas vor dem Mannsvolk, wissen Sie. Aber das eine Fräulein hat mir etwas gesagt – ja, als ich gestern auf dem Herrenhof war, – aber ich darf nicht – ich muss schweigen.«
»Ach nein, beste Frau Anderson, lasst mich wissen, was sie sagte«, bat Hjalmar inständig.
»Nun, weil sie gar so schön bitten, sollen Sie es wissen; aber Sie müssen erst die Erdbeeren essen«, antwortete die Frau lächelnd.
Die alte Frau setzte sich nun auf eine Kiste nieder und sah mit herzlichen Vergnügen, wie die Erdbeeren ihrem Gast auf einmal köstlich schmeckten. Auf Hjalmars erneuertes Zureden fing sie endlich in ihrer umständlichen Weise ihre Geschichte zu erzählen an.
»Ja, Herr Leutnant, wissen Sie, ich war, wie gesagt, gestern auf dem Schloss auf dem Herrnhof da drüben, und da sagte das eine Fräulein zu mir: ›Hören Sie, Frau Anderson‹, sagt sie, ›ist es wahr, was man erzählt, dass ein junger Offizier bei Euch wohnt?‹
›Ja, schönes junges Fräulein!‹, sagte ich.
›Ist er schön?‹, fragte sie.
›Oh, er ist der schönste, hübscheste junge Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe‹, sagte ich. ›Sie glauben nicht, wie sauber und artig er ist.‹
›Aber was tut er denn?‹, fragte sie.
›Ach, er rennt im Wald herum und hört dem Vogelgesang zu, oder er liest in seinen großen, langen Versbüchern‹, sagte ich.
›Aber, Frau Anderson, wie kann man ihn denn einmal zu sehen bekommen?‹, fragte sie.
›Das ist leicht geschehen‹, sagte ich.
›Wieso?‹, fragte sie.
›Ja, wenn die Fräulein morgen einmal nach Mörkellef kommen, so will ich es schon so einrichten, dass Sie ihn zu sehen bekommen‹, sagte ich.
›Ja, tut das, beste Frau Anderson‹, sagte sie, ›aber sagt um Gotteswillen dem Offizier kein Wort davon.‹
›Ach, denkt doch nicht, dass ich so ungeschickt bin‹, sagte ich.«
»Und glaubt Ihr, bestes Mütterchen, dass die schönen Mädchen nach Mörkellef kommen?«, fragte Hjalmar eifrig.
»Ja, da kann der Herr Leutnant sich darauf verlassen«, antwortete die Frau, »und das ist auch ganz in der Ordnung, dass sie einen so hübschen Herrn sehen wollen, und dass ein so hübscher Herr so schöne Mädchen sehen will. Gehen Sie nur dorthin, Herr Leutnant, und nehmen Sie Ihr Buch mit, und tun Sie, als ob Sie lesen, verstehen Sie mich.«
Hjalmar ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er halte nun so lange ein selbstgeschaffenes Ideal angebetet, dass er sich von ganzer Seele danach sehnte, ein wirklich lebendes, schönes weibliches Wesen, mit Fleisch und Blut, und vor allem mit offenen Augen, vor sich zu sehen. Mit Stagnelius unter dem Arm begab er sich also auf den Weg, denn die Sonne fing schon an sich zu senken. Langsam schritt er in der herrlichen Gegend, die an Üppigkeit der Vegetation in Nordland kaum ihres Gleichen findet, weiter.
Als er nun in die Nähe von Mörkellef kam, hörte er plötzlich einige lockende Rufe. Er blieb stehen, und sah in der Entfernung zwei Frauenzimmer in großen Sommerhüten, die auf einen einzeln stehenden Baum sahen und beständig riefen: »Mylord, Mylord!«
Sein scharfes Auge glaubte ein kleines Eichhörnchen zu entdecken, das lustig von Ast zu Ast sprang.
»Vortrefflich«, sagte er für sich selbst »Der kleine entflohene Tanzmeister gibt mir die beste Gelegenheit, mich den Schönen zu nähern, denen ich natürlicher Weise meine Hilfe anbieten werde.«
Er ging zu diesem Ende hin, grüßte die überraschten und errötenden Mädchen artig und sagte lächelnd: »Ich vermute, es ist Ihr kleiner ungetreuer Günstling, der sich dort oben herumschwingt. Mit Ihrer Erlaubnis will ich versuchen, den Treulosen, der wahrhaftig sein Glück nicht verdient, zurückzubringen.«
Die zwei schönen Schwestern dankten ihm etwas verlegen mit einer leichten Verbeugung, und in einem Augenblick war Hjalmar, behände wie eine Katze auf den Baum geklettert, wo es ihm bald geglückt war, das Band zu fassen, an dem die Mädchen ihren kleinen Ausreißer führten.
Bald hatte Hjalmar das Eichhorn in der Hand und schwang sich mit seinem Fang herab. Doch verlief dieses nicht ohne Blutvergießen, denn Mylord war ein kleiner bösartiger Herr und biss ihn ordentlich in den Finger. Ohne darauf zu achten, hielt er seinen Fang fest, den er, glücklich auf der terra firma angelangt, dem einen der Mädchen mit einer Verbeugung überlieferte.
»Ach, Sie bluten«, rief diese erschrocken, »der garstige Wicht hat Sie gewiss gebissen?«
»Mein Blut und Leben steht allezeit zu ihrem Dienst«, sagte Hjalmar lächelnd und wickelte sein Taschentuch um seinen verwundeten Finger.
»Wie ritterlich Sie sprechen!«, sagte das Mädchen scherzend, »es ist sehr schade, dass Sie nicht vor einigen Jahrhunderten lebten.«
»Ja, die Zeiten waren herrlich«, fuhr Hjalmar in demselben spielenden Ton fort, »besonders für die Damen, die uns Männer damals am Gängelband führten, wie Sie jetzt den kleinen Schlingel hier. Aber es lag doch etwas unendlich Poetisches darin, dass die Schwachen einzig und allein durch die Macht ihrer Schönheit so über die Starken herrschten. Ach! Ich wünschte, wir wären in jene goldenen Ritterzeit zurückversetzt: Ich wäre ein fahrender Ritter; die Güter die wir hier um uns sehen, wären Raubritterburgen, und Sie selbst eine geraubte Prinzessin, der ich dann meine Dienste anbieten könnte, um Sie auf des Vaters Schloss zurückzuführen.«
»Ei, wie schön«, sagte das Mädchen und sah ihn mit ihren dunklen, schelmisch lächelnden Augen an. »Aber, obwohl wir, leider keine geraubten Prinzessinnen sind, ist doch nichts, was den fahrenden Ritter hindern könnte, um zu unseres Vaters Schloss zu geleiten, wenn Sie es für gut finden.«
Wer war seelenvergnügter über diese Einladung, als Hjalmar! Noch nie hatte er so natürliche, hübsche und muntere Wesen gesehen, wie diese beiden Schwestern, die ihm, während sie uns zwischen den mythischen Linden dahinschwebten, wie Waldnymphen der Mythe vorkamen. Er sah bald auf die eine, bald auf die andere, unentschlossen, welcher er den Vorzug geben sollte. Bald war er von dem Blick der einen, in dem eine bewunderungswürdige Klarheit und Lieblichkeit lag, dahin gerissen, bald bezauberte ihn das Lächeln der anderen, welches das anmutigste schalkhafteste von der Welt war. Er war nicht imstande, sich zu entscheiden, welcher von beiden er seine Verehrung widmen sollte; doch neigte sich die Wahl etwas zum Vorteil der mit den klaren Augen, wahrscheinlich deswegen, weil sein Ideal seine Augen beständig senkte, wie wir wissen.
Unsere Gesellschaft setzte nun ihren Weg unter fröhlichem Gespräch fort, das sich allmählich den neuesten Erzeugnissen der Literatur, und zuvörderst den Romanen der Friederike Bremer zuwandte, von denen die beiden Schwestern natürlicherweise ganz bezaubert waren.
»Auch ich zolle dieser Schriftstellerin meine ganze Bewunderung«, sagte Hjalmar, »aber ich habe an ihrem, gleichwie an allen Frauenromanen im Allgemeinen, einen wesentlichen Fehler anzumerken. Ihre Helden, die sie con amore zeichnet, sind beinahe immer de politische unliebenswürdige Egoisten, wo nicht gar reine Schurken. So der Alarich in den Töchtern des Präsidenten z. B. wie hart, wie herzlos, wie eifersüchtig behandelt er nicht Adelaide, einer der liebenswürdigsten zartesten Frauencharaktere, die jemals geschildert wurden! Er war ihrer wahrhaftig nicht wert, und ich glaube nimmermehr, dass sie glücklich zusammen leben konnten, obwohl die Verfasserin uns dessen versichert. Liegt die Seligkeit in einem großen Kinderkreis, so hatte sie dieselbe sicherlich gefunden, denn in Ninna, wo wir die schöne Adelaide plötzlich wiedersehen, hat sie nicht weniger denn vierzehn lebende Kinder, was man in der Tat etwas kühn zugegriffen nennen kann, aber im Übrigen glaube ich doch, dass Adelaide recht bittere Tage gehabt haben muss.
Von Bruno in den Nachbarn will ich nicht einmal sprechen; denn er ist der kompletteste Schurke, den die neuere schwedische Literatur aufzuweisen: ein Dieb, ein Sklavenhändler und dergleichen. Und dieser mit Verbrechen besudelten Mann gibt die Verfasserin der Serena zur Frau, ein Wesen, die sie als ein wahrhaft himmlisches zu schildern versucht. Das ist ihr indessen, nach meinem Dafürhalten nicht geglückt, denn, ich kann bei Gott nichts dafür, diese Serena kommt mir immer vor wie eine weiße, lahme Ente.«
»Nein, nun sind Sie in der Tat ungerecht und – ja boshaft«, rief die älteste Schwester, die mit den schönen Augen, »was können Sie gegen Serena haben?«
»Ich habe gegen sie einzuwenden, dass sie mir nur zu himmlisch ist«, antwortete Hjalmar. »Ein solches hyperätherisches Wesen kann sich im Himmel recht gut ausnehmen, auf Erden aber taugt sie nichts, gar nichts, am allerwenigsten aber als Frau eines ci-dévant Sklavenhändlers, der allerdings zu seiner moralischen Regeneration eine gute Frau braucht, aber auch eine Frau mit Charakterfestigkeit und einer guten Portion Härte, wovon Bruno selbst einen so großen Überfluss besaß. Indessen könnte man beinahe versucht sein, gegen die Frauen eine schwere, aber doch nach meiner Überzeugung ganz und gar ungerechte Beschuldigung auszustoßen, wenn man die von ihnen verfassten Romane gelesen hat, den nämlich, dass die edelsten Frauen die charakterlosesten und niedrigsten Männer ertragen. Aber so ist es nicht, so kann es nicht sein, ich weiß es nur zu gut; und der Grund, dieser Liebhaberei für moralisch korrumpierte Helden, die sich in den Frauenromanen findet, ist in dem erhabenen, aber unsicheren Glauben der Frauen zu suchen, dass sie durch ihre nachsichtige Milde und Güte den siebenmal gefallenen Mann aufrichten und veredeln können. Das ist gewiss sehr, sehr schön gesagt, als getan, denn ein richtiger Galgenvogel bleibt Galgenvogel, auch wenn er unter den veredelnden Pantoffel gekommen ist.«
Unter diesem Gespräch war der irrende Ritter mit seinen zwei Prinzessinnen dem prächtigen Schlösschen des Herrenhofes näher gekommen, und der Ritter wollte eben, die Mütze in der Hand, sich empfehlen, als der Eigentümer des Gutes erschien. Nachdem Hjalmar gegrüßt und sich selbst vorgestellt hatte, wurde er von dem gastfreien Eigentümer zum Abendbrot eingeladen, ein Anerbieten, das er natürlich mit Vergnügen annahm.
Von diesem Tag an war Hjalmar ein oft gesehener Gast auf dem Herrenhof, und da er notwendig einmal verliebt sein wollte, schenkte er dem scheuen Fräulein mit den schönen Augen seine ungeteilte Huldigung, aber gleichwohl wollte es zum Glück für unseren Helden nicht recht gehen, denn, wie schön, lebhaft und liebenswürdig auch das schöne Fräulein war, es glich doch nicht seinem Ideal, welches sonderbar genug, sich beständig seinem geistigen Auge mit seinen niedergeschlagenen Blicken und tränenden Augen darstellte. Indessen arbeitete Hjalmar mit aller Kraft, dieses Bild mit dem seiner Amanda – so hatte er nämlich das schöne Fräulein umgetauft – zu vereinigen, und er begann schon zu träumen:
Eine Hütte und ein Herz.
Fräulein Amanda, die sich immer gleich blieb, unterhielt sich fröhlich, freundlich, ja sogar oft vertraulich mit dem jungen Mann, der, ganz erblindet in seiner aufkeimenden Liebe, einen glatten Goldring von höchst fataler Bedeutung, den das schöne Fräulein an seiner linken Hand trug, gar nicht bemerkte. Das beweist am besten, dass unser Held noch ein bedeutender Anfänger in der edlen Kunst der Courtoisie war; denn ein erfahrener Mann, der sich, zu einem unbekannten Mädchen hingezogen fühlt, durchsucht zuerst ihre Finger, um sich zu vergewissern, ob das blühende Eigentum vorher schon in den Besitz eines anderen übergegangen ist oder nicht. Dass aber ein solches Verhältnis existieren konnte, fiel Hjalmar nie ein. War er nicht bei seiner Schönen, so streifte er in den Wäldern umher und träumte der Liebe glückseligen Traum. Bald schnitt er große A in die Birken, und bald, wenn der Paroxysmus den höchsten Gipfel erreicht hatte, begann er, mit Stagneliusschen Worten, wenn auch just nicht mit Stagneliusschen Atem, der Zauberin lob zu singen; aber ungeübt, wie er war im Harfenspiel brachte er selten mehr als die erste Strophe des allerdings in der Fantasie fertig liegenden Gedichts zu Papier. Aber sogleich bestieg er unerschrocken von Neuem den ungefügen Pegasus und so ging es eine Woche lang ununterbrochen. Wohl wissend, dass alle junge Leute, der ersten Liebe süße Schmerzen in der glühenden Brust, von einer unüberwindlichen Schreibseligkeit, die all dieses Übermaß von Seligkeitsentzückung auszudrücken strebt, geplagt werden, können wir unserem Helden diese Torheit gerne verzeihen und zu unserem Vergnügen sogar einem oder dem anderen seiner poetischen Ergüsse lauschen.
Sogleich der erste:
Amanda! Selbst von himmlischer Natur
Schwebst du in dieses Edens schöner Flur
Und Blumen sprossen auf aus deiner Spur;
Und jede Laube, duftend wie von Ambra
Wird zur fantastisch strahlenden Alhambra,
Wo Mandolinen und Gitarren … schnarren.
In den Papierkorb!
Ein anderes:
Es sausen die Linden
Im schattigen Dache,
Im duftenden Laub.
Da irrt ich und weine.
Balsamischen Winden
Mein Schicksal ich klage;
Doch die Winde sind taub.
Amanda, die reine,
Die Himmelgeborne,
Die schon seit Aeoen –
So wollt es die Norne –
Im Herzen ich trage,
Ist taub meiner Klage
In den Papierkorb!
Und noch eines!
Küssen deine Lippen! Nippen
An der Liebe Festpokal!
Ach! Amanda, hehre! Kehre
Wieder! Mich verzehrt die Qual …
In den Papierkorb!
»Nein, das ist ja reine Narrheit!«, rief Hjalmar, vernünftig genug, eines schönen Morgens, als er sein neunundneunzigstes Gedicht ärgerlich vor sich warf. »Man kann ja doch ein ziemlich großer Narr sein, ohne gerade Verse zu schreiben. Wie ist es aber auch möglich, Liebesgedichte zu schreiben, da es nicht einmal auf Liebe außer dem ewigen Triebe einen passenden Reim gibt; denn was hätten die noch übrigen Diebe und Hiebe in einem Liebesgedichte zu schaffen? Nein! Keine Zeile mehr und lebte ich nach hundert Jahre – keine Zeile mehr! Das schwöre ich bei Apollo, der mich, scheint es, ganz und gar als Sohn verleugnen will. Aber sieh! Da kommt das Dampfboot! Ich will zur Brücke hinabeilen, denn sie, sie ist sicher dort, um einige Bekannte, die sie erwartet, zu empfangen.
Obwohl Hjalmar auf den Flügeln der Liebe dahinflog, hatte doch das Dampfboot vor seiner Ankunft schon angelegt, und er kam gerade recht, um zu sehen, wie seine sogenannte Amanda warm und herzlich von einem schlanken Offizier umarmt wurde. Er stand wie versteinert und wollte kaum seinen Augen trauen, vor denen es beinahe schwarz zu werden begann. Und da nun die Schöne am Arm des Offiziers munter forthüpfte, ohne unseren Helden auch nur eines Blickes zu würdigen, arbeitet sich ein grässlich schwerer Seufzer aus seiner bekümmerten Brust und Ha, Treulos! Dieser Stereotypausdruck der Eifersüchtigen schwebte auf seinen Lippen. Während er nun so, still und niedergeschlagen, blind und unzugänglich für alles außer ihm, dastand, bemerkte er plötzlich, wie eine Hand ihn leicht auf die Schulter schlug. Da er sich umwandte, sah er den schwarzbraunen Fremdling, dessen Bekanntschaft er so schnell in einem Wirtshaus an der Landstraße gleich am Anfang dieser kleinen Erzählung gemacht hatte, vor sich stehen.
»Welch angenehme Überraschung, Sie hier zu sehen!«, sagte der Fremde, Hjalmar freundlich die Hand schüttelnd. »Ich will nämlich hoffen, Sie erkennen mich wieder. Wir trafen uns in einem Gasthaus im verflossenen Frühjahr.«
»Ja, ich erinnere mich dessen«, sagte Hjalmar, der ihn in seiner augenblicklichen düsteren Gemütsstimmung dahin wünschte, wo der Pfeffer wächst. Aber der Fremde war durchaus nicht gewillt, ihn so leichten Kaufs fahren zu lassen.
»Halten Sie sich schon lange hier auf?«, fragte er.
»Ein paar Wochen«, war die kurze Antwort.
»Wie! So lange schon? Ich habe auch im Sinn, einige Tage hier zu verweilen, weil ich noch nie diese schöne Gegend gesehen habe. Wollen Sie also, der Sie den Ort näher zu kennen scheinen, nicht das Amt eines Cicerone auf sich nehmen und mir sagen, wo ich auf ein paar Tage ein einigermaßen gutes Quartier finde?«
Hjalmar war gewiss sonst der dienstfertigste Mensch auf Gottes Erden, aber … Amanda gehört ja einem anderen – wie war er da wohl imstande, einem anderen im Aufsuchen eines so äußerst prosaischen Dinges, wie ein Quartier, an die Hand zu gehen? Nach langen Besinnen antwortete er also auf das Ersuchen des Fremden: »Ich weiß wirklich nicht, das ist äußerst schwer …«
»Aber Sie müssen doch selbst irgendwo wohnen«, fiel der Fremde ein, »vielleicht findet sich dort auch für mich ein kleines Kämmerlein.«
Da Hjalmar einsah, dass er, ohne als unhöflich zu erscheinen, nun keine ausweichende Antwort mehr geben könne, sagte er: »Wenn Sie mir folgen wollen, werden wir weitersehen.«
»Ich danke Ihnen. Sobald meine Equipage und meine Effekten an Land gesetzt sind, werde ich die Ehre haben, Ihnen Gesellschaft zu leisten. Darf ich bitten, so lange zu warten?«
Hjalmar bejahte mit einer summen Verbeugung. Die Equipage wurde gelandet, ein paar schnaubende Vollblutrosse vorgespannt, und Hjalmar saß an der Seite des Fremden in dem prächtigen, englischen Reisewagen, den wir schon einmal gesehen haben. Der Kutscher sprang auf, und die mutigen Rosse, froh, einmal auf festen Boden gekommen zu sein, sausten wie im Fluge dahin.
»Wie gefallen Ihnen meine Rosse?«, fragte der Fremdling.
»Ha, die sind unvergleichlich!«, rief Hjalmar, der ein großer Pferdeliebhaber war und nun über der Schönheit dieser Tiere für einen Augenblick den Treulosigkeit seiner Schönen vergaß.
»Ja, sie sind wirklich recht hübsch. Ich kaufte sie von dem englischen Gesandten in Stockholm, woher ich eben komme.«
Das muss ein rechter Kauz sein, der da, dachte Hjalmar und betrachtete den Fremden, der ihm nun ganz und gar verändert schien; denn der herbe Ausdruck, den er früher in seinem Gesicht fand, war verschwunden und hatte einem milden, freundlichen Lächeln Platz gemacht, das man gerne sah. Aber seine Betrachtungen dauerten nicht lange, denn die raschen Pferde hatten in ein paar Minuten die kurze Entfernung zwischen der Brücke und dem kleinen Dorf zurückgelegt. Frau Andersen war nicht wenig erstaunt, einen so merkwürdig prächtigen Herrschaftswagen vor ihrer Tür halten zu sehen. Mit der Schürze in der Hand stand sie dort und verbeugte sich unaufhörlich gegen die aussteigenden Herren. Auf die Frage des Fremden, ob sie ihm noch ein Zimmer überlassen könne, antwortete sie, sie habe allerdings noch eines, es sei aber viel zu klein für einen so großen Herrn.
»Hat nichts zu sagen, gute Frau. Wenn ich nur ein etwas gutes Bett bekomme, so bin ich vollkommen mit dem Zimmer zufrieden, wenn es auch noch so klein ist.«
»Ja, Herr Baron, Federpolster habe ich genug, wenn die Ihnen recht sind«, sagte die alte Frau, »aber«, setzte sie zagend bei, »das allerschwerste ist, was soll ich denn einem so hohen Herrn zu essen geben?«
»Was Ihr wollt, gute Frau, ich bin an gute und schlechte Tage gewöhnt. Was Ihr wollt.«
Nachdem nun alle Bedenken der Alten gehoben waren, ließ der Fremde Sack und Pack in sein kleines Zimmer bringen, wobei ihm Hjalmar auf jede Weise behilflich war, wiewohl er nicht verhindern konnte, dass zuweilen ein tiefer Seufzer seiner Brust entstieg.
Die Mittagsstunde war gekommen, und da Mutter Andersen zu allem Glück am Morgen einen fetten jungen Hahn geschlachtet und gebraten, und dazu noch einen saftigen Hammelbraten mit Dillsauce zubereitet hatte, und die schönsten Erdbeeren mit dem fettesten Rahm hergerichtet waren, so konnte sie ohne Verzug eine Mahlzeit auftragen, von der kaum ein König hungrig aufgestanden wäre. Der Bedienstete des Fremden hatte auf dessen Geheiß unseren allen Bekannten den Flaschenkorb geöffnet und daraus eine Flasche echten Madeira und einen dito ausgesucht feinen Burgunder hervorgeholt.
»Ich führe gerne meinen Wein immer mit mir«, sagte der Fremde, »denn meine Kehle hat sich noch nicht an all das ungenießbare Zeug gewöhnen können, das man hier unter dem Namen von Wein in den meisten Gasthäusern unseres teuren Vaterlandes verkauft. Aber hier haben wir es wirklich vortrefflich mit unserer Herberge getroffen, und ich bin Ihnen zu vielem Dank verpflichtet, dass Sie mich hierher führten. Doch nur noch etwas, was ich beinahe vergessen hätte. Dass Sie Lingen heißen, weiß ich, weil ich Ihren Namen, nachdem Sie abgereist waren, im Postbuch las, aber wahrscheinlich sind Sie mit dem meinen unbekannt. Ich heiße Franck, bin Kaufmann, jetzt aber, seit ich eine große Besitzung hier in der Gegend gekauft habe, Proprietär, oder wie man das nennen will. Ihr Wohl, Leutnant Lingen!«
Hjalmar verbeugte sich und trank. Indessen überließ sich der Fremde mit echten Kennerblick den Freuden des Mahles, und schließlich löste sich auch bei Hjalmar das Band seiner Zunge, sei es durch die Freundlichkeit des Fremden, sei es durch die Stärke des echten Madeira. Das Bild der unschuldigen Treulosen begann allmählich zu erbleichen, und statt dessen trat das des Ideals, nach und nach um so viel klarer vor seine Seele. Seine Freude begann allmählich wiederzukehren. Er plauderte, lachte sogar, und als die zweite Flasche geleert war, schien die Wunde seines Herzens in voller Heilung begriffen.
»Es freut mich, Sie wieder fröhlich zu sehen«, sagte Herr Franck, »Sie sahen so verstimmt aus, als ich Sie vorhin unten am Strand traf. Es ist Ihnen doch nichts Unangenehmes zugestoßen.«
»Nein, gewiss nicht«, stammelte Hjalmar und errötete.
»Etwas muss es doch gewesen sein! Sie sind doch in Gottes Namen nicht verliebt?«, fragte Herr Franck und sah ruhig forschend auf Hjalmar, der nun noch mehr errötete.
»Ich weiß schon, warum der Herr Leutnant so absonderlich ist«, fiel Mutter Anderson, die gerade eintrat, dazwischen. »Mein junger Herr Leutnant ist sich gar nicht mehr gleich, seit er sich in die Fräuleins drüben auf dem Herrenhof vergafft hat.«
»Ach, still! Still!«, bat Hjalmar verlegen.
»Aber nun ist der Bräutigam der einen gekommen und der der anderen kommt auch bald, und das geht dem Herrn Leutnant so zu Herzen«, fuhr die Alte fort, ohne auf die Bitten Hjalmars zu achten.
»Aber meine beste Mutter!«, rief Hjalmar und sprang auf, »warum sagtet Ihr mir denn nicht gleich, dass sie verlobt seien?«
»Bei Gott, das hatte ich vergessen, aber was ging mich dieses auch an?«
Herrn Franck, der einige Augenblicke unruhig auf seinem Stuhl hin und her gerückt war, schien bei den letzten Worten der Frau eine schwere Last von der Brust genommen zu sein und lächelnd sagte er: »Was hör ich da? Sie gehen hierher und verlieben sich in die Braut eines anderen? Das lohnt sich wahrlich nicht der Mühe. Nein, mein junger Freund, fort mit dieser verdammten Liebe, die, wie man die Sache auch drehen und wenden mag, doch eine ewige Torheit bleibt. Doch trinken wir ein Glas darauf, oder wie?«
»Topp!«, sagte Hjalmar fröhlich und stieß an, woraus man leicht sehen kann, dass seine Liebesgedanken nicht allzu tiefe Wurzel geschlagen hatten. Dazu war diese junge Liebe kaum einige Wochen alt und mehr aus Stagnelius entsprungen, denn aus seinem eigenen Herzen. Indessen, Hjalmar hatte nun schon einmal im Feuer gestanden und beschloss, sich für die Zukunft in Acht zu nehmen; denn hätte dieses kleine Abenteuer nur einen Monat länger gedauert – wer weiß, was da die Folge gewesen wäre.
Nachdem abgetragen war, blieben unsere beiden Herren nach englischer Sitte noch eine Stunde beim Weinglas unter allerlei Gesprächen sitzen. Dabei erinnerte sich Hjalmar der beiden unglücklichen Frauenzimmer, die er im Wald getroffen hatte. Er fragte deshalb Herrn Franck nach ihnen.
»Ach, ich konnte sie nur unbedeutend unterstützen«, antwortete dieser mit gleichgültigem Ton und wandte sich ab. »Aber von Ihnen konnten sie nicht genug sprechen, Ihnen folgten ihre wärmsten Dankesbezeugungen nach und sie baten mich, Ihnen, wenn ich Sie je wiedersehen würde, nochmal ihren herzlichsten Dank auszudrücken.«
»Ach, das Wenige, was ich tun konnte, ist ja gar nicht der Rede wert!«, sagte Hjalmar. »Aber ich wäre begierig, zu wissen, wo diese beiden unglücklichen Wesen sind und wie es ihnen geht?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Franck kurz und erhob sich. »Aber«, fuhr er fort, »darf ich Sie nicht einladen, auf unser ländliches Mahl eine kleine Promenade zu setzen, um uns einmal die gepriesenen Herrlichkeiten von Kinnekulle anzusehen?«
Hjalmar nahm die Einladung mit Vergnügen an und hinaus zogen sie an den schönen Strand.
Wo jede Laube, duftend wie von Ambra,
Wird zur fantastisch strahlenden Ambra.
Mit Behagen lauschte unser Held den Erzählungen seines Begleiters, der viel von der Welt gesehen hatte und mit Leichtigkeit und Anmut zu erzählen verstand. Die ungekünstelte Herzlichkeit, womit Hjalmar außerdem von diesem Mann, für den er doch beinahe ganz und gar ein Fremdling war, behandelt wurde, erfreute sein für freundschaftliche Gefühle stets offenen Herz. Ehe der Abend kam, glaubte er in Herrn Franck einen älteren, bejahrten Freund zu sehen, zu dem er volles Vertrauen haben konnte.
Am folgenden Morgen sagte Herr Franck zu Hjalmar: »Ich habe Ihnen gesagt, dass ich hier in der Gegend eine Besitzung angekauft habe, und ich muss nun dahin reisen. Aber nun habe ich Ihnen einen Vorschlag zu machen. Sie haben mir auf unserer gestrigen Promenade erzählt, dass Sie keine bestimmte Heimat hätten, außer dem etwas vagen Logis, das Ihnen Ihr Mantelsack bietet. Ich denke mir, das müsse auf die Dauer doch etwas unangenehm sein, und da ich auf meiner Besitzung mindestens ein Dutzend leere Zimmer habe, so würden Sie mir wirklich ein großes Vergnügen machen, wenn Sie ein paar davon annehmen wollten. Allerdings kann es für einen jungen, lebhaften Mann nicht sonderlich lockend sein, mit einem alten Junggesellen zusammen zu wohnen, aber ich bin doch, darf ich hoffen, nicht gar so entsetzlich philisterhaft alt, und ich hoffe, wir werden unsere Tage ganz angenehm dahinbringen. Indessen bin ich es, armer Teufel von Einsiedler, der Ihnen für diesen Dienst verbunden sein muss, wenn Sie auf meinen Vorschlag eingehen wollten; aber ich hoffe, Sie verzeihen mir diesen kleinen Eigennutz. Kann ich mir also mit der Hoffnung schmeicheln, Sie als Gast bei mir zu sehen?«
Hjalmar hatte mit steigender Rührung den Worten des wohlwollenden Mannes zugehört. Da dieser geendigt hatte, fasste er mit Wärme seine Hand und dankte ihm in herzlichen Ausdrücken für seine Güte.
»Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich es bin, der Ihnen danken muss«, rief Herr Franck fröhlich. »Aber lassen sie uns nun abreisen, je früher, desto besser, denn ich vermute, dass Sie noch nicht den Mut haben, von den Bräuten oben auf dem Herrensitz Abschied zu nehmen.«
Bald saßen die beiden Reisenden in dem prächtigen Wagens, aber die gute Mutter Anderson hatte eine Träne im Auge, als sie ihren kleinen lieben Herrn Leutnant ihr letztes Lebewohl zuwinkte.
Schreibe einen Kommentar