Fort Wayne – Band 1 – Kapitel 4
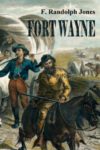 F. Randolph Jones
F. Randolph Jones
Fort Wayne
Eine Erzählung aus Tennessee
Erster Band
Verlag von Christian Ernst Kollmann. Leipzig. 1854
Viertes Kapitel
Als die aufgehende Sonne ihr Antlitz in den glitzernden Wellen des Savannah River badete, war die Reisegesellschaft bereits außerhalb des Weichbildes der Stadt Augusta. Der belebende Eindruck des herrlich klaren Äthers und der Blütenduft atmenden Morgenluft war ganz geeignet, die Bedenklichkeiten und Sorgen, welcher sich die Mitglieder der waghalsigen Expedition nicht völlig entschlagen konnten, in den Hintergrund zu drängen. In der Tat war es kein geringfügiges Unternehmen, mitten durch ein von wütenden Feinden bewohntes Land, wo jeder Busch, jeder Fels, jeder Engpass den sicheren Tod aus dunklem Versteck in ihre Reihen senden konnte, mit einer so geringen Schar zu durchziehen. Auch ist es wahrscheinlich, dass ohne die von der Volksversammlung ausgegangene Aufforderung, wodurch in die Fähigkeiten des Chevaliers ein so ehrendes Vertrauen gesetzt worden war, weder Herr de Raucourt noch Doktor Littlewood unter den obwaltenden Umständen auf ihrem Verfolgungszug beharrt haben würden. Ersterer war aber viel zu stolz und zu besorgt um seinen Ruf rücksichtsloser Kühnheit, Letzterer ein viel zu glühender Patriot, als dass beide nur einen Augenblick gezögert hätten, selbst bei der Aussicht auf das gewisseste Verderben, dem an sie ergangenen Rufe zu entsprechen.
Außer Laroche und dem Indianer, welche schweigend und ohne sich umzublicken stets etwa zwanzig bis dreißig Schritt vorangingen, hatten sich noch drei handfeste Georgiamänner dem Unternehmen freiwillig angeschlossen. Diese hielten sich möglichst nahe an den beiden berittenen Hauptpersonen und führten eine lebhafte und muntere Unterhaltung mit Littlewood, dessen geheime Befürchtungen seinem gewohnten Humor durchaus keinen Abbruch zu tun vermochten.
Der Weg führte einige Meilen dicht am Ufer des Flusses hin, bald unter dem Schatten mächtiger Tulpenbäume und Zedern, bald über kleine lachende Präriewiesen, welche der dunkle Waldsaum fast zirkelrund umkränzte. Der junge Tag hatte überall ein kräftiges Leben erweckt. Auf dem Strom, der hier und da weite seeartige Einschnitte in das Land bildete, durchfurchten Tausende von Wasservögeln die Flut und in ihr frohlockendes Geschrei mischte sich aus der Tiefe des Gebüsches der eigentümliche Ruf des Whippoorwill. Oft war der Weg von schweren blütengeschmückten Festons überwölbt, gebildet von Schlingpflanzen und wilden Weinreben. Unbeschreiblich herrlich glühte die Königin der amerikanischen Flora, die stolze Magnolia, aus dem saftigen Grün des Waldes. Trotzdem schien die Szenerie auf die Reisenden keinen besonderen Eindruck zu machen, wenn es nicht der war, dass aller Meinungen sich in der Prophezeiung eines jener drückend heißen Tage vereinigten, welche den nahenden Sommer anzukündigen pflegen. Wirklich ging diese Befürchtung bald genug in Erfüllung, und groß war das Behagen der Karawane, als nach dem Überschreiten des Cedar Creek sie jener unermessliche Urwald in seine Schatten aufnahm, der damals in fast ununterbrochener Länge sämtliche mittlere Staaten bis hinauf zu den Seen bedeckte.
Mit Ausnahme einer kurzen Rast bei Holly Springs, wo sie das Flussufer verlassen und eine westliche Richtung eingeschlagen hatten, waren Reiter und Fußgänger bisher auf den Beinen gewesen. Umso lieber folgten sie daher einem stummen Wink des Akadiers, der auf dem abgerundeten Plateau eines von Buschwerk ziemlich freien Hügels anhielt und ohne Weiteres die Vorbereitungen zum Nachtlager begann. Der Ort war äußerst lieblich und genügte allen Ansprüchen. Zerstreut stieg der Chevalier vom Pferd und ließ sich ebenso zerstreut auf die Wolldecke nieder, welche der tätige Doktor für ihn ausbreitete, während die anderen dürres Holz zusammentrugen und dann mit ihren Büchsen den Wald durchstreiften, um das Hinterwäldlermahl mit einem tüchtigen Stück Wild zu versorgen. Bald genug krachten einige Schüsse von verschiedenen Richtungen her und nicht minder rasch erschienen die glücklichen Jäger mit den Zeugnissen ihrer trefflichen Kunst. Als der Abend einbrach, war die Mahlzeit im vollem Gang, eine mächtige Whiskeyflasche, mit welcher der kluge Doktor in Augusta seine Pistolenhalfter ausstaffiert hatte, machte unter den Hinterwäldlern die Runde. Der Chevalier, der sich den derben Scherzreden und der kordialen Unterhaltung seiner Begleiter mit einem unbeschreiblichen Gefühl hochmütigen Widerwillens unterworfen hatte, sah sich keineswegs durch Bitten zurückgehalten, als er nach einer Weile aufstand und von der Gruppe entfernt einen einsamen Spaziergang begann. Noch befand man sich nicht in dem eigentlichen Indianerland, gleichwohl hatte jeder seine Rifle zur Hand und von Viertelstunde zu Viertelstunde machte einer von ihnen, – den Doktor nicht ausgeschlossen, – aufmerksam die Runde um das Bergplateau. Laroche hatte sich eben zu diesem Zweck entfernt, als der Doktor nicht umhin konnte, sich mit der Frage an seinen Nachbarn zu wenden: »Möchte wohl wissen, Mr. Brown, in welchem Wigwam die Wiege unseres Kameraden gestanden hat. Bei Jingo! Aus seinem zerfetzten Gesicht ist nichts zu mutmaßen.«
»Kein rechter Amerikaner, sage ich Euch«, meinte kopfschüttelnd der Angeredete, »die Akadier alle haben kein amerikanisches Blut, aber der ist sicher erst herübergeschneit, ob er es gleich nicht Wort haben will.«
»Ich sah ihn vor drei Wochen in Natchez«, setzte der Dritte hinzu, »ebenso bepflastert und ebenso finster und geheimtuend wie heute. Kalkuliere, die französischen Gefängnisse können die beste Auskunft über Mr. Laroche geben.«
Ein warnendes Hm! Hm! Des Doktors, der zu seinem Schrecken den Gegenstand des Gespräches plötzlich an seiner Seite sah, schnitt jede weitere Expektoration in dieser Richtung ab. Littlewood versenkte sich mit einem Gefühl unbehaglicher Verlegenheit in die Anatomie eines saftigen Rippenstücks, während er nicht umhin konnte, den Pseudoakadier mit scheuen Seitenblicken zu mustern. Und in der Tat bot dieser ein ziemlich abschreckendes Bild dar. Das magere, sonnenverbrannte Gesicht wurde durch ein breites, schwarzes Pflaster, welches von der rechten Stirnseite über die Nasenwurzel fast bis zum linken Ohr herabreichte, beinahe in zwei Hälften geteilt. Ein struppiger Bart, schwarz wie das tief in die Stirn gestrichene Haupthaar, verstellte oder verdeckte vielmehr seine Gesichtszüge so vollständig, dass nur die tiefliegenden, unruhig umherblickenden Augen seiner Physiognomie eine gewisse wilde Lebendigkeit und Schärfe verlieh. Ob er die wenig schmeichelhaften Bemerkungen seiner Reisegenossen vernommen hatte oder nicht, blieb umso mehr im Zweifel, als er sich kalt und gleichgültig neben das Feuer hinstreckte und eine kurze Gipspfeife aus seiner Ledertasche ziehend, behaglich zu rauchen begann.
»Der Herr Chevalier hat die Wache übernommen!«, begann er nach einer Weile. »Er scheint die Einsamkeit zu lieben, wenigstens unserer Gesellschaft vorzuziehen. Ich bin ihm nicht böse darüber; ein munteres Gespräch am Feuer ist mir lieber. Wie wäre es, wenn einer oder der andere ein Geschichtchen zum Besten gäbe?«
Die Aufforderung schien keinen rechten Anklang zu finden. Die Georgier brummten unverständlich einige abgerissene Brocken vor sich hin, der Indianer stierte teilnahmslos in das Feuer, und wieder war es dem gutmütigen Doktor beschieden, in die Bresche zu treten und der unbehaglichen Pause ein Ende zu machen.
»Mr. Laroche ist sicherlich ein Stück Poet«, sagte er, »denn hier auf dem grünen Hügel, von Bäumen umrauscht und das schlafende Meer von Laub und Blättern unter uns, müsste eine schauerliche und grausige Geschichte sich vortrefflich anhören. Wart Ihr jemals in Europa?«, setzte er flüchtig hingeworfen hinzu.
Laroche wandte sich rasch zu dem kecken Frager und sein Blick ruhte einen Moment mit durchbohrendem Feuer auf Littlewoods breitem, ruhigem Antlitz, auf welchem jedoch keine Spur von Absicht oder besonderer Neugier zu entdecken war.
»Freilich wohl«, sagte er lächelnd, »da ich nicht die Ehre habe, in den Staaten geboren zu sein. Ich bin ein Pariser Kind, ein Landsmann des Schur…, des Chevalier, wollte ich sagen.«
»Nun, dann kann es Euch an Stoff zu einem behaglichen Geschwätz nicht fehlen!«, sagte der Doktor, »der Chevalier hat mir manches hübsche Geschichtchen erzählt, von Versailles und Trianon.«
»Damit kann ich nicht dienen. Ohne Zweifel war der Chevalier ein vornehmer Herr am Hofe, und ich möchte wohl wissen, was den Grand Seigneur in dieses Land der Bürgerlichkeit und Freiheit getrieben hat.«
»Was Lafayette, Rochambeau, Latour-Maubourg und so viele andere Eurer Nation während des Unabhängigkeitskrieges herüberbrachte, Liebe zu Kampf und Ruhm und die Ahnung der Freiheit, welche jetzt erst in Eurem Frankreich sich zu verwirklichen beginnt.«
»Sans doute!«, sagte Laroche mit einem leichten, spöttischen Lächeln, »und die Freiheit hatte so viel Reize für ihn, dass er nach Abschluss des Friedens sich von dem Schauplatz seiner Taten nicht mehr zu trennen vermochte?«
»Nein«, sagte der Doktor, »er ging wie die anderen nach abgeschlossenem Frieden nach Frankreich. Da aber der Hof die Freiheitskämpfer mit nicht besonders günstigen Blicken betrachtete, sie vielmehr auf alle Weise hintenansetzte, kehrte er vor etwa zwei Jahren wieder zurück und kaufte seine prächtige Pflanzung am Edisto.«
Laroche stieß ein kurzes Gelächter aus, dessen unheimlicher Ton selbst die teilnahmslosen Hinterwäldler aus ihrer Apathie riss. »Also, weil er sich zurückgesetzt sah, weil man seine Heldentaten mit Undank belohnte, kehrte er la belle France den Rücken? Er hat wohl getan; mancher Edelmann hatte schlimmere Gründe, das Land seiner Geburt zu verlassen.«
»Ihr meint Ehrenhändel, Bastille und lettres de cachet?«, fragte der Doktor. »Ich habe unter den Truppen des General Gates manchen Baron und Grafen gekannt, der ohne diese Erfindungen der Tyrannei das Straßenpflaster von Paris sicherlich nicht mit unseren Wildnissen vertauscht hätte.«
»Das meinte ich – und manches andere. Ich hörte vor meiner Abfahrt von Brest eine Erzählung, deren Held nicht minder unfreiwillig diesen Küsten entgegensegeln musste. Wollt Ihr hören, wie es damit zuging?«
Die Ankündigung einer spannenden Geschichte verfehlt selten auch auf die teilnahmsloseste Gesellschaft ihren Zweck, wie vielmehr hier, wo die Individualität des Erzählers eine so markierte und gewissermaßen geheimnisvolle war. Die Georgier richteten sich auf ihren Ellenbogen empor, Matti-cho-wuh glotzte den Akadier mit weit aufgerissenen Augen an und der Doktor beförderte ein mächtiges Stück Kautabak in seinen wohlwollend und erwartungsvoll lächelnden Mund.
Nachdem Laroche sich mit einem raschen Blick überzeugt hatte, dass der schweigsam mit der Büchse im Arm auf- und abwandelnde Chevalier sich außerhalb der Hörweite befand, tat er ein Paar mächtige Züge aus seiner Pfeife und begann.
»Vor einigen Jahren wohnte in Paris ein Juwelier Namens Rossin, dem von früherer Wohlhabenheit zuletzt nichts mehr geblieben war, als seine bildschöne und tugendhafte Tochter Madelon. Rossin war von je ein leichtfertiger Bursche gewesen, der es gar zu gern den reichen Pflastertretern und faulenzenden Edelleuten gleichtun wollte. Besonders war es das Spiel, welches seinen Ruin vorbereitet und ihn endlich nach dem Tod seiner Frau so weit gebracht hatte, dass er sein glänzendes Verkaufsgewölbe im Palais Royal mit einer dunklen und schmutzigen Höhle in der Rue St. Martin vertauschen musste. Da es schon mehrmals vorgekommen war, dass er die ihm zum Fassen oder Ausbessern anvertrauten Schmucksachen ins Leihhaus getragen hatte, anfangs um Mittel zur Fortsetzung seines wüsten Lebenswandels, zuletzt um die Befriedigung der notwendigsten Lebensbedürfnisse zu erlangen, so sah er sich ohne Kredit, ohne Kunden und ohne Arbeit. Sehr verwundert und höchlich erfreut war er daher, als eines Tages ein vornehmer Herr aus dem Gefolge des Grafen von Artois durch die unscheinbare Glastür, hinter welcher so oft das wunderschöne, aber kummervolle Gesicht Madelons auf die Straße schaute, in den Laden trat und ihm einige Schmucksachen von nicht unbeträchtlichem Wert übergab, mit dem Auftrag, sie neu zu fassen. Er sah in dem jungen Mann einen Rettungsengel aus der höchsten Not, denn seit zwei Tagen hatten Vater und Tochter nur von Brot und einigen gerösteten Kartoffeln gelebt. Der Edelmann zog die Tochter mit in die Unterhaltung und zeigte sich äußerst geschmeichelt, als ihm diese unbefangen erzählte, dass sie ihn schon oft im Vorübergehen bemerkt und seinen Gruß mit Vergnügen erwidert habe.
Nach einigen Tagen kam der Edelmann wieder, bezahlte freigebig, ohne zu handeln, die gelieferte Arbeit und übergab dem glücklichen Meister eine Menge an derer Kleinodien zu demselben Zweck. Es versteht sich von selbst, dass Madelon, die ihren Vater bis zur Aufopferung liebte, sich in der glücklichsten Stimmung dem flüsternden Geschwätz des großmütigen Wohltäters hingab und – um kurz zu sein – je öfter der Edelmann in den Laden trat, desto mehr verbesserten sich die Umstände des Juweliers, desto freundlicher und zuvorkommender empfing ihn das arglose Mädchen.
Nun aber hatte Madelon einen Bräutigam, einen geschickten und nicht mittellosen Waffenfabrikanten, namens Renaudot, der einige Male mit dem Edelmann in dem Laden zusammengetroffen war und die Courmacherei desselben nicht mit gleichgültigen Blicken ansehen mochte. Der brave Bursche kannte die Welt besser als das unerfahrene Mädchen. Seine Warnungen, die sich endlich in heftige Drohungen und Ausfälle gegen den Edelmann verwandelten, bewirkten indessen nichts, als dass sie Madelon Tränen und Beteuerungen, dem alten Rossin aber Beleidigungen und gräuliche Flüche auspressten, sodass der verzweifelnde Bräutigam eines Tages mit der Versicherung, nimmer wiederzukehren, den Laden verließ. Tränen und Verwünschungen verwandelten sich in eitel Lächeln und heitere Mienen, als bald darauf der Edelmann erschien, ein Maroquin-Kästchen unter dem Mantel hervorzog, dasselbe öffnete und vor den geblendeten Blicken des Juweliers ein prachtvolles Collier von Diamanten in der Sonne spielen ließ. ›Sie haben mir bisher so treffliche Arbeit geliefert, Herr Rossin‹, sagte er, ›dass ich dieses Halsband, dessen Wert mindestens fünfzigtausend Franc beträgt, in keine besseren Hände als die Ihren zu legen weiß. Sie sehen die altmodische geschwärzte Fassung. Ich habe die Ehre, bei dem von Ihrer Majestät der Königin, Marie Antoinette, in Trianon arrangierten Liebhabertheater mitwirken zu dürfen, und ich wünsche heute über acht Tage den Effekt meiner Rolle durch den Glanz dieses Halsbandes zu erhöhen. Ich werde‹, sagte er zu Madelon gewendet, ›den schwarzen König Rhadamisus vorstellen. Nichts würde mich glücklicher machen, wenn Sie, schöne Dame, auf die Prinzess von Lamballe, welche ich im Verlaufe des Stückes zu lieben und zu entführen genötigt bin, ein wenig eifersüchtig sein möchten.‹
Madelon errötete, Herr Rossin aber betrachtete den herrlichen Schmuck mit funkelnden Augen und versprach, in der Fassung ein Meisterstück der Goldschmiedearbeit zu liefern. Die Nacht, welche diesem Tag folgte, brachte weder dem Juwelier noch seiner Tochter eine Stunde Schlaf. Madelon dachte an den verlorenen Bräutigam, den sie im Grunde ihres Herzens treu und innig liebte, und konnte dennoch nicht umhin, sich wieder und immer wieder die zärtlichen, sanften Liebesworte des Edelmanns ins Gedächtnis zurückzurufen. Rossin aber wälzte sich auf seinem Lager wie auf einem glühenden Rost. Der Schmuck lag vor ihm auf der Bettdecke und die Mondstrahlen glitzerten und flimmerten über ihn hin, dass ihm das diamantene Band zu einer prächtigen Schlange zu werden schien, die Worte der Verlockung zu ihm redete.
›Der Schatz könnte dein werden!‹, sprach die höllische Sirene, ›wenn du willst, vervielfältige ich mich und öffne dir die Pforten des Glanzes und des Reichtums.‹«
Ein missvergnügtes Gemurmel seiner Zuhörerschaft belehrte glücklicherweise den Erzähler, der in eine Art finsterer Ekstase geraten war, dass der Ton, welchen er angeschlagen hatte, keineswegs für ein Biwakfeuer im Urwald passend sei. Nur der Doktor schien gefesselt und hatte alles vergessen, was ihm Laroche früher widerwärtig oder gar verdächtig gemacht hatte. Er lauschte seinen Worten so andächtig und so gespannt, dass es ihn unangenehm berührte, als der Akadier kurz abbrechend in einen leichteren Ton fiel und – um gewissermaßen diesen Wechsel auch äußerlich zu markieren – mit großem Geräusch seine Pfeife ausklopfte und sie nebst dem Tabakbeutel dem halb schlafenden Indianer hinwarf, um sie aufs Neue zu füllen.
»Nun, um die Geschichte zum Schluss zu bringen, denn meine Kameraden sind müde und der Herr Chevalier sieht sich nach der Ablösung um«, fuhr Laroche endlich fort, »der Teufel nahm Besitz von des Juweliers armer Seele. Anstatt den Fünfzigtausend-Franc-Schmuck zu fassen, spazierte Mr. Rossin Abend für Abend erst zu einem Kaufmann in der Rue Tiquetonne, der ihm für sechs oder acht Steine ebenso viele hundert Franc auszahlte, und dann in die Spielhöllen des Palais Royal, aus denen er nach Mitternacht regelmäßig mit leeren Taschen und in schrecklicher Stimmung nach Hause zurückkehrte. Am Morgen des achten Tages war der letzte Diamant verspielt. Mr. Rossin ging zum Pont Neuf, in der löblichen Absicht, sich zu ersäufen. Da es aber mitten im Winter und verzweifelt kalt war, zog er es nach einiger Überlegung vor, sich in das Hotel des Edelmannes zu begeben und ihm ein reumütiges Sündenbekenntnis abzulegen. Groß und angenehm war seine Überraschung, als dieser ihm weder an die Gurgel fuhr noch nach der Polizei rief, sondern ihm ganz einfach erklärte, er möge sich niedersetzen und ein schriftliches Bekenntnis seines Diebstahls aufsetzen, da es seine – des Edelmannes – Absicht keineswegs sei, einer Unbesonnenheit wegen einen so geschickten Meister auf die Galeeren zu bringen. Freilich sah Mr. Rossin ein, dass er durch dieses Blatt Papier, welches der Edelmann sorgfältig in sein Portefeuille verschloss, gänzlich in dessen Gewalt gegeben war, sein Leichtsinn aber schloss ihm die Augen. Entzückt, von einer Zentnerlast befreit, kehrte er in seinen Laden und zu der betrübten Madelon zurück.
Als ein paar Tage später der großmütige Edelmann in einem prächtigen Kabriolett vor der Tür des Juweliers erschien und diesen in fast demütig ehrerbietigem Ton um die Erlaubnis bat, mit Fräulein Madelon eine Spazierfahrt nach Mont-Fermeil machen zu dürfen, konnte Rossin, obwohl ein schrecklicher Verdacht wie ein Blitzstrahl seine Seele durchzuckte, nicht umhin, sich durch die Herablassung des gnädigen Herrn sehr geehrt zu fühlen. Derselbe Schreck schien sich Madelons bemächtigt zu haben. Ihr flehender Blick suchte vergebens das abgewandte Antlitz ihres Vaters, und als sie nun an der Seite des ihr brennende Liebesworte zuflüsternden Edelmannes durch unbekannte Straßen und Gässchen dahinrollte, fühlte sie sich dem Tode nahe. Als sie, rückwärts blickend, das finstere, gramvolle Antlitz ihres Bräutigams der Spur des Wagens folgen sah, schrie sie laut auf um Hilfe und versuchte aus dem Wagen zu springen. Endlich hielt dieser an einem einsamen Haus in einer der Vorstädte. Halb bewusstlos trug sie der Edelmann hinein in ein prächtiges, wollüstig ausgestattetes Gemach. Hier endlich gab er seinen verbrecherischen Wünschen und Plänen Worte, Worte, vor denen Madelon erstarrte.«
»Schändlich!«, murmelte der Doktor, »das sind die Folgen der Sittenverderbnis und Tyrannei. Und wie weiter? Wurde das unglückliche Opfer gerettet?«
»Nun ja, sie floh, obwohl ihr der Edelmann das schriftliche Sündenbekenntnis des Vaters vor die Augen hielt. Sie schleuderte den Wahnsinnigen, – selbst fast wahnsinnig, – zurück und eilte nach Hause, wo ein Gehirnfieber sie aufs Krankenlager warf und zehn Tage in wohltätiger Bewusstlosigkeit fesselte. Als sie erwachte, befand sie sich im Spital der Salpetrière unter verworfenen Weibern, dem Abschaum des Pariser Pöbels. Auf die erste Frage, welche ihre zitternden Lippen hervorzubringen vermochten »Wo ist mein Vater?«, wurde ihr die Antwort gegeben: »Im Gefängnis La Force und zur Galeere verurteilt!«
Noch halb tot, und mehr einem Gespenst als einem lebenden Wesen gleich, schleppte sie sich nach ihrer Entlassung bis zur Tür ihres einstigen Bräutigams. Mit Ingrimm und Spott warf sie der Unglückliche auf die Straße, sie wankte einige Schritte weiter, und ein daher rollender Wagen hätte sie fast zermalmt. Es war der Graf von Artois, der nach Versailles fuhr. Sein Scharfblick hatte des Mädchens Schönheit trotz der Verwüstungen des Kummers entdeckt. Er ließ sie an einen sicheren Ort bringen.
Als sie ihm unter tausend Tränen ihre Geschichte erzählt hatte, dachte der Prinz nicht mehr daran, sie zu verführen, sondern gelobte ihr, dem König die Schändlichkeit des Edelmannes mitzuteilen. Noch an demselben Abend wurde sie in dem Kloster der Nonnen von Sacré-Cœur untergebracht. Unbeschreiblich, obwohl seltsam mit Trauer und Wehmut gemischt, war ihre Freude, als sie vernahm, dass das Urteil ihres Vaters durch die Gnade des Königs in lebenslängliche Landesverweisung verwandelt und ihr gestattet sei, den unglücklichen Greis über das Meer zu begleiten. Unter Bedeckung wurden beide nach Brest geführt, von wo ein eben absegelndes Transportschiff bestimmt war, sie nach Louisiana zu führen.«
»Nun, und der Edelmann?«, fragte mit unverkennbarem Interesse einer der Hinterwäldler. »Beschreibt nur recht ausführlich, wie er gehenkt oder doch geteert und gefedert wurde.«
»Tout a son tour!«, fuhr der Franzose bitter lächelnd fort, »erst muss ich Euch doch sagen, dass Jaques Renaudot, der Bräutigam des armen Kindes, bald genug seine rachgierige Härte bereute, zumal als er nach einiger Zeit erfuhr, wie unwürdig sein Verdacht gewesen war. Mit dem brennenden Wunsch, sein Unrecht womöglich wiedergutzumachen und sich der Geliebten zu Füßen zu werfen, eilte er nach Brest.
Das Erste, was er im Hafen erfuhr, war die Kunde vom Schiffbruch des Fahrzeuges, auf welchem Rossin mit seiner Tochter abgesegelt war. Das Schiff war an der Mündung des Mississippi gescheitert und so viel man wusste, mit Mann und Maus zu Grunde gegangen. Verzweiflung im Herzen, war der junge Mann im Begriff, nach Paris zurückzukehren, als er zu seinem Erstaunen unter den Passagieren eines eben nach Amerika abgehenden Schiffes, jenen Edelmann bemerkte, dem er mit den feierlichsten Schwüren in der Stille der Nacht unversöhnliche Rache geschworen hatte. Seine hastigen Nachfragen unterrichteten ihn, dass derselbe – niemand wusste eigentlich, warum – bei Hofe in völlige Ungnade gefallen war, dass selbst seine Standesgenossen seinen Umgang vermieden und sein Plan, in Amerika eine neue Heimat zu suchen, nicht das Ergebnis eines freien Entschlusses, sondern bitterer Notwendigkeit war. Der junge Mann allein wusste sich dies alles zu deuten. Da ihn der Gedanke, den Elenden mit Reichtümern beladen dem Schauplatz seines Verbrechens ungestraft entrinnen zu sehen, mit Wut und Ingrimm erfüllte, beschloss er, mit der nächsten Gelegenheit ihm zu folgen und sich, wie der Dämon der Rache, an die Fersen dessen zu heften, in dem er den Mörder seiner Braut, den Zerstörer all seines Lebensglückes sah.«
Es erfolgte eine lange Pause. Der Erzähler zog dichte Dampfwolken aus seiner Pfeife und hüllte sich fester in seine Wolldecke.
»Ich bin am Ende!«, versetzte Laroche, stand auf und schickte sich an, den Feuerplatz zu verlassen. »Ob der betrogene Pariser seine Absicht ins Werk gesetzt, ob er den Edelmann wiedergefunden und bestraft hat, könnte nur er selber euch erzählen. Ich wenigstens bin keinem von beiden auf meinen Streifzügen begegnet.«
Damit schritt er hinweg und ließ die Gesellschaft in jenem Gefühl unbefriedigter Erwartung zurück, welches stets das Ergebnis einer schlecht erzählten oder unvollendet gelassenen Geschichte zu sein pflegt. Seine breite düstere Gestalt verschwand im Dunkeln. An ihrer statt tauchte die des Chevaliers auf, der sich schweigend und anscheinend ermüdet am Feuer niederließ und wie vom Schlaf befangen die Augen schloss. Nach und nach folgten die anderen seinem Beispiel und bald beleuchteten die verglimmenden Kohlen mit unsicherem Licht die Gruppe der schlummernden Abenteurer.
Schreibe einen Kommentar
Schreibe einen Kommentar