Aus dem Wigwam – Vater und Sohn
Karl Knortz
Aus dem Wigwam
Uralte und neue Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer
Otto Spamer Verlag. Leipzig. 1880
Vater und Sohn
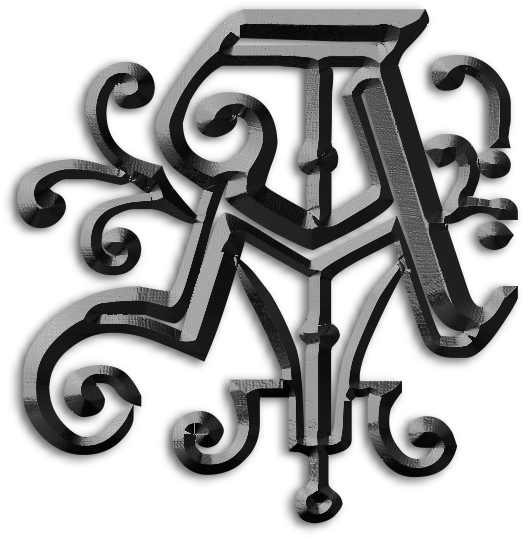 uf einem schmalen Sandstriche zwischen zwei stürmischen Seen lebte ein junger Mann, namens Tschappewi, dessen Vater der Erste aller Menschen war. Als dieser zuerst auf der Stelle, wo sich nun die Jagdgründe der Hundsrippen-Indianer befinden, die Welt betrat, fand er die Täler voller Tiere, die Flüsse voll schmackhafter Fische und die Seen voll großer Walfische. Da sich sonst weder Mann noch Frau noch Kinder auf der Erde befanden, so schuf er gleich einige Menschen und gab ihnen zwei Sorten Früchte, eine schwarze und eine weiße, zu essen, verbot ihnen aber, die Erstere zu genießen. Nachdem er ihnen sonst noch allerlei angenehme Dinge geschenkt hatte, steckte er tausend gebratene Meerschweinchen, einen Ozean voll gebackener Fische, dreißig große Walfische und einen hohen Berg von Tabak in seine geräumige Tasche und machte sich auf, um die Sonne zu besuchen, die damals die Erde noch nicht mit ihren Strahlen erwärmte.
uf einem schmalen Sandstriche zwischen zwei stürmischen Seen lebte ein junger Mann, namens Tschappewi, dessen Vater der Erste aller Menschen war. Als dieser zuerst auf der Stelle, wo sich nun die Jagdgründe der Hundsrippen-Indianer befinden, die Welt betrat, fand er die Täler voller Tiere, die Flüsse voll schmackhafter Fische und die Seen voll großer Walfische. Da sich sonst weder Mann noch Frau noch Kinder auf der Erde befanden, so schuf er gleich einige Menschen und gab ihnen zwei Sorten Früchte, eine schwarze und eine weiße, zu essen, verbot ihnen aber, die Erstere zu genießen. Nachdem er ihnen sonst noch allerlei angenehme Dinge geschenkt hatte, steckte er tausend gebratene Meerschweinchen, einen Ozean voll gebackener Fische, dreißig große Walfische und einen hohen Berg von Tabak in seine geräumige Tasche und machte sich auf, um die Sonne zu besuchen, die damals die Erde noch nicht mit ihren Strahlen erwärmte.
Als er nach langer Abwesenheit wieder zurückkehrte, brachte er das helle Auge mit, das seit jener Zeit die Welt erleuchtet. Seine Kinder hatten inzwischen seinen Rat befolgt und nur weiße Beeren gegessen und waren daher
auch immer munter und gesund geblieben. Kurz danach däuchte es ihm, als sei das Licht der Sonne doch nicht das, für was er es gehalten hatte, denn es erhellte ihm die Erde nur auf kurze Zeit. Da er, als er sie holte, in ihrer Nähe noch ein ähnliches Auge gesehen hatte, so machte er sich abermals auf die Reise, um auch das andere zu holen. Diesmal aber hatten seine Kinder vergessen, sich genügenden Vorrat weißer Beeren anzulegen. Eine allgemeine Hungersnot stellte sich ein, die zuletzt so schrecklich wurde, dass sie das Gebot ihres Vaters nicht mehr beachteten und schwarze Beeren aßen.
Als der alte Tschappewi zurückkam und den Mond, welcher am Abend die Sonne ablöst, mitbrachte, bemerkte er zu seinem großen Leidwesen, dass jedem Menschen der Tod aus den Augen sah. Er sprach daher zu ihnen: »Da ihr mein Gebot nicht gehalten habt, so sollt ihr in Zukunft ein Leben der Mühe führen und allerlei schmerzlichen Krankheiten und zuletzt dem Tode unterworfen sein!«
Dann ruhte der Alte von seinen beschwerlichen Reisen aus und überließ die Menschen ihrem ferneren Schicksal. Die Bäume, die früher gerade gewachsen waren, wuchsen nun krumm, und die Tiere, die früher wurden so mager und schwach, dass sie sich kaum noch fortbewegen konnten. Mit der Zeit wurde er so alt, dass ihm die Zähne den Dienst versagten und sich sein Schlund ganz abgenutzt hatte. Da er sich aber trotz alledem doch nicht
gern vom Leben trennte, so rief er einen Verwandten aus der zwanzigsten Generation zu sich und sprach zu ihm:
»Geh, mein Sohn, an den Fluss des Bärensees und hole mir einen Mann aus dem Geschlecht der kleinen klugen Leute (Biber). Derselbe muss einen braunen Ring um das Schwanzende und einen weißen Flecken auf der Nasenspitze haben. Er darf nur zwei Monate alt sein. Dann sieh auch zu, dass sein Bauch nicht zu dick ist und seine Zähne scharf sind. Aber laufe, so schnell du kannst.«
Dieser ging und kam bald mit einem vorschriftsmäßigen Biber zurück.
»Trage ihn«, sprach er darauf, »an die Quelle des Kupferminenflusses und lass ihn ein wenig Neschkaminnik trinken. Dann kämme sein Haar und kitzle ihn ein wenig am Bauch, damit er guter Laune wird, und sage ihm, er möge seine Nation nicht durch unmännliches Weinen und Klagen beschimpfen, wenn du ihm sieben seiner besten Zähne aus der rechten Kinnlade ziehst.«
Der Indianer tat es.
Da der Biber sah, dass er gute Miene zum bösen Spiel machen musste, sagte er: »Diesen Gefallen will ich dem alten Tschappewi gern tun. Tue also, wie er dir befohlen hat.«
Darauf führte der Indianer ohne Mühe seine Aufgabe aus und brachte dem Alten die verlangten sieben Zähne.
Dieser rief darauf alle seine Nachkommen zusammen und sprach: »Ich bin alt und meine Kehle hat sich abgenutzt. Meine Zunge ist aus den Fugen und mehr als hundertmal habe ich mir neue Zähne eingesetzt. Ich habe alle Schönheiten der Welt gesehen und will nun sterben. Nehmt also die sieben scharfen Zähne des klugen kleinen Mannes und schlagt mir zwei davon in die Schläfe, einen in die Stirn, einen in jede Seite der Brust, einen in meinen Rücken und den letzten in die große Zehe meines rechten Fußes.«
Sie folgten seinem Befehl. Als sie den letzten Zahn in die große Zehe seines rechten Fußes geschlagen hatten, starb er.
Der junge Tschappewi ernährte sich und seine Familie mit Jagen und Fischen. Wenn er sein Netz ins Wasser warf, so zog er es stets mit reichlicher Beute gefüllt heraus. Wenn er seinen Speer aufs Geratewohl ins Wasser stieß, so traf er jedes Mal den fettesten Fisch.
Nun geschah es eines Tages, dass das Wasser infolge eines Dammes, den er gebaut hatte, aus den Ufern trat und seinen Wohnsitz gänzlich überschwemmte. Um sich daher zu retten, ließ er alle seine Haustiere und die Mitglieder seiner Familie in ein großes Kanu gehen und überlieferte sich dem Element, das immer höher und höher stieg und mehr als zwei Monate die ganze Erde bedeckte. Da inzwischen seine Nahrungsmittel ausgingen und jede Hoffnung auf Rettung geschwunden war, so sagte er zu den Tieren, dass eins untertauchen und Erde holen müsse, wenn sie nicht alle umkommen wollten. Der Ochse erwiderte, dass er dies nicht gut tun könne, da ihm sein Schwanz im Wege sei. Der Hirsch entschuldigte sich ähnlicher Weise mit seinem Geweih. So fanden zuletzt alle Tiere mit Ausnahme des Bibers eine wohlbegründete Ausrede. Letzterer tauchte denn auch unter, aber er kam nie wieder zum Vorschein. Danach ließ sich die Moschusratte zu diesem Wagstück bereden, aber sie blieb so lange aus, dass man befürchtete, sie habe ebenfalls das Leben dabei eingebüßt. Doch als man daran war, ein anderes aufopferungsfähiges Geschöpf auszufinden, erschien sie todmüde auf der Oberfläche und hielt einige Bröcklein nasser Erde in ihren Klauen. Aus diesen machte nun der junge Tschappewi einen kleinen Ball und warf ihn ins Wasser, wonach er immer größer wurde und zuletzt wie eine Insel aussah, sodass er seine Tiere und Menschen ausladen konnte. Einen Wolf, der ihm beständig in seinem Kanu im Wege war, setzte er zuerst darauf, aber dieser war so schwer, dass er die Erde ganz auf eine Seite drückte, wodurch er gezwungen war, ein ganzes Jahr lang so schnell wie er konnte von einem Ende zum anderen zu laufen. Nach dieser Zeit war auch die Insel so groß geworden, dass alle anderen Geschöpfe landen konnten.
Da Tschappewi sah, dass nirgends ein Baum war, so steckte er einen Stock in den Grund, und bald wurde derselbe zum Tannenbaum und wuchs so hoch, dass die Spitze bis in den Himmel reichte. Kurz danach bemerkte er ein flinkes Eichhorn und versuchte es zu fangen, aber es kletterte auf jenen Baum hinauf, und zwar so hoch, dass es in das Reich der Sterne kam. Doch der furchtlose Indianer folgte ihm und fand sich bald von allerlei merkwürdigen Dingen,
von Meteoren, Wolken und tanzenden Geistern umgeben. Kalte und warme Winde, Blitze, Donner, Hagel und Schnee umspielten ihn. Endlich kam er so hoch, dass er das Paradies betreten konnte. Aber das Eichhorn war nirgends zu sehen. Da er es jedoch um jeden Preis fangen wollte, so kletterte er wieder auf die Erde zurück, um sich aus dem Haar seiner Schwester eine Schlinge zu flechten. Nachdem er dies getan und sie in den Himmel gelegt hatte, wartete er das Weitere in aller Gemütlichkeit in seiner Wohnung ab.
Am nächsten Mittag aber verschwand plötzlich die Sonne und es wurde mit einem Mal stockfinstere Nacht.
Da dies die ältesten Leute noch nie erlebt hatten, so sagte die Frau Tschappewis: »Du hast sicherlich irgendein Unglück angerichtet, als du oben im Himmel warst, denn die Sonne, die uns dein Vater gebracht hat, verbirgt sich nun vor uns!«
»Ich habe leider einen großen Fehlgriff begangen«, erwiderte er, »aber ich kann nichts dafür, dass die Sonne in der Schlinge hängen geblieben ist. Sie muss unter jeder Bedingung wieder befreit werden!«
Danach rief er eine wilde Katze herbei und befahl ihr, in den Himmel zu klettern und die Schlinge durchzuschneiden. Dieselbe versuchte es auch, wurde aber von den heißen Sonnenstrahlen zu Asche verbrannt. Der Wolf und der Panther versuchten danach ihr Glück, aber es ging ihnen ebenso, und der junge Tschappewi wusste zuletzt keinen Rat mehr. Da kam endlich der Maulwurf herbei und sagte, er wolle die Sonne losbinden. Doch als die anderen Tiere das hässliche Geschöpf sahen, lachten sie alle laut auf und ergingen sich in allerlei ehrenkränkenden Bemerkungen. Doch der Maulwurf kümmerte sich nicht weiter darum, sondern kletterte flink den hohen Baum hinauf und befreite die Sonne wirklich. Aber er verlor sein Augenlicht dabei und seine Schnauze und Zähne wurden ganz braun gebrannt.
Danach richtete der junge Tschappewi sein Augenmerk auf die bessere Einrichtung der Erde und schuf, indem er mit den Fingern über das Land fuhr, eine große Anzahl schöner Flüsse und grub die Stellen für Seen mit seinem Suppenlöffel aus.
Als er die Berge betrachtete, stutzte er. »Was soll ich mit diesen Erdhaufen tun?«, fragte er. Da er sich augenblicklich keine befriedigende Antwort zu geben wusste, so beschloss er, sie vorläufig zu lassen, wie sie waren. Dann wies er den Tieren besondere Wohnplätze an und sagte, sie möchten sich in Zukunft selber gegen die Menschen verteidigen. »Wenn ihr sterbt«, fuhr er, um sie wegen ihrer Zukunft zu trösten, fort, »dann werdet ihr wie Grassamen sein, der, wenn man ihn ins Wasser wirft, zu neuem Leben erwacht!«
Aber das gefiel den Tieren durchaus nicht und das Schwein, welches das Wort führte, erwiderte: »Lass uns lieber nach dem Tod zu einem Stein werden, denn der verschwindet doch wenigstens vor den Augen der Menschen, wenn man ihn ins Wasser wirft!«
Der junge Tschappewi erklärte sich damit einverstanden und machte nur eine Ausnahme mit dem Hund, der seinem Herrn auch nach dem Tod folgen dürfe.
Die Nachfolger Tschappewis lebten lange Zeit in Frieden; doch als einst zufälligerweise einige junge Männer im Spiel getötet wurden, entstand ein allgemeiner Krieg, der die einzelnen Familien nach allen Himmelsgegenden trieb. Mehrere zogen sich in die hohen Gebirge zurück und andere nahmen ihren Wohnsitz am Ufer des Ozeans. Ein Indianer ließ sich mit seinem Hund am Großen Bärensee nieder, und dieser Hund bekam nach kurzer Zeit acht Junge. Als der Indianer nun eines Tages nach Hause kam, schallte ihm ein fröhliches Kindergelächter entgegen; doch als er seinen Wigwam betrat, fand er nur seine Hunde darin. Am nächsten Tag passierte ihm dasselbe, doch diesmal schlich er sich unbemerkt herbei und sah zu seinem größten Erstaunen acht wunderschöne Kinder, welche ihre Hundefelle abgelegt hatten, am Feuer sitzen. Eilig sprang er herzu und warf die Häute ins Feuer, wonach die Kinder ihre neue Gestalt behielten.
Diese wurden späterhin die Stammväter der Hundsrippen-Indianer.
Schreibe einen Kommentar