Der Spion – Kapitel 6
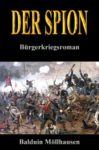 Balduin Möllhausen
Balduin Möllhausen
Der Spion
Roman aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, Suttgart 1893
Kapitel 6
Martin Findegern
Wer zu Anfang der sechziger Jahre, also zur Zeit des furchtbaren brudermörderischen Bürgerkrieges, in St. Louis der dem Mississippi zunächstliegenden und mit diesem ziemlich parallel laufenden Straße stromaufwärts so weit folgte, bis anstelle der zusammenhängenden Häuserreihen vornehm eingefriedete Gärten mit stattlichen Landhäusern dieselbe begrenzten, dessen Aufmerksamkeit wurde sicher durch einen umfangreichen quadratischen Platz gefesselt, der sich zu seiner freundlich emporblühenden Nachbarschaft verhielt, wie etwa ein griesgrämiger obdachloser Strolch zu einer geschniegelten und gebügelten Gesellschaft in einer Theaterloge ersten Ranges.
Der Gegensatz wurde verschärft, wenn man den Platz, der ein regelmäßiges Häuserviereck hätte tragen können, sogar tragen sollen, ein wenig eingehender prüfte. Zunächst störte der ihn umfriedigende, zwar feste, sonst aber recht ärmlich drein schauende Palisadenzaun. Seine durch Verwitterung erzeugte langweilige graublaue Farbe erhielt nur da einen etwas munteren Ausdruck, wo mutwillige Kinderhände ihn mit den tollsten Kreidezeichnungen und noch tolleren Bemerkungen schmückten. Außerdem sah man hier statt der benachbarten geschmackvoll angelegten Parkgärten nur einige kleine Kartoffel- und Gemüsefelder, überragt von einem Dutzend Pfirsich- und vielleicht doppelt so vielen Apfelbäumen.
Inmitten dieser wenig anheimelnden Umgebung, nicht einmal in der richtigen Mitte des umfangreichen Platzes, erhob sich endlich wie verloren das Wohnhaus des Besitzers. Auf einem, das Erdreich in Manneshöhe überragenden, aus Feldsteinen gemauerten Unterbau war dasselbe aus behauenen Balken einstöckig errichtet worden und umschloss vier nicht allzu kleine Zimmer sowie eine Küche nebst schmalem Flur. Zwei Giebelzimmer nahmen die Hälfte des Bodens ein. Zu diesen gelangte man von der Küche aus auf einer allerdings festen, im Übrigen aber zum Halsbrechen recht geeigneten Treppe.
Auch hier war alles bläulich verwittert, sowohl die Holzmauern auch das Schindeldach, nur dass dieses gesprenkelt erschien, indem der Besitzer mit peinlicher Genauigkeit jede schadhafte Stelle bald wiederum erneuerte, wogegen die Wände, wo nur immer eine geeignete Fläche es ermöglichte, mit Ölmalereien bedeckt waren, die zwar von keinem übermäßig hervorragenden Talent zeugten, dafür aber in um so grelleren und lebhafteren Farben prangten.
Vier kleine Fenster und eine Tür lagen auf der Vorderseite, ebenso viele zur Gartenseite hinaus. Diese unterschieden sich dadurch voneinander, dass auf der Ersteren eine ebenfalls von Schindelwerk überdachte, einfach hergestellte Veranda von einem Giebel zum anderen hinüberreichte. Nebenbei wurde sie von zwei mächtigen Hickory-Nussbäumen beschattet, deren Jugend mindestens auf die Zeiten des ersten Unabhängigkeitskrieges entfiel. So erzeugte das ganze Grundstück den Eindruck, als ob es einst aus den Händen eines anspruchslosen Farmers in die des jetzigen Besitzers übergegangen sei und trotz der über dasselbe hinauswachsenden Stadt keine Wandlung erfahren habe. Aus neuerer Zeit stammte ein großer Bretterschuppen, welcher die doppelte Aufgabe einer geräumigen Tischlerwerkstatt und eines Magazins erfüllte.
Über die Persönlichkeit des derzeitigen Besitzers wurde man übrigens durch ein oberhalb des Torwegs angebrachtes Brett belehrt, auf welchem die ziemlich verwitterte Inschrift zu lesen war Tischlerei und Sargmagazin von Martin Findegern – ein echt deutscher Name und eine Firma, die schon über ein Vierteljahrhundert hindurch ihren guten Ruf bewahrt hatte.
Ja, solange war es her, als Martin Findegern, ein ehrlicher märkischer Tischlergeselle, das seinen Mann ernährende Geschäft begründete. Das geschah in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre. War er schon in der Heimat als schlauer Rechenmeister bekannt gewesen, dem gesunder Mutterwitz überall durchhalf, so darf am wenigsten gemutmaßt werden, dass besondere Vorliebe für ein abenteuerliches Dasein ihn über das Weltmeer trieb, was denn auch durch sein späteres Leben zur Genüge bestätigt wurde. Ebenso wenig hatte er jemals etwas begangen, infolgedessen der heimatliche Boden ihm unter den Füßen zu heiß geworden wäre. Fragte ihn aber jemand nach der Ursache seines Auswanderns, so lautete die mit bedeutsamem Emporschrauben der Brauen erteilte Antwort kurz und bündig: »Familienangelegenheiten.«
Und Familienangelegenheiten waren es tatsächlich gewesen. Seine einzige Schwester, einst ein auffällig schönes Mädchen, welche unter den erdenklichsten Opfern ihrer Eltern, die ebenfalls der edlen Tischlerzunft angehörten, wie durch eigenen unermüdlichen Fleiß sich zur Erzieherin ausgebildet hatte, war nämlich von einem nicht mehr ganz jungen Geheimrat als Frau heimgeführt worden. Damit erreichte das frühere herzliche geschwisterliche Verhältnis selbstverständlich sein Ende. Nur zweimal hatte Martin nach ihrer Verheiratung das geheimrätliche Haus besucht, und zwar das erste Mal, um sich nach der Heimkehr von der Wanderschaft vorzustellen und in wohlgefügter Rede seine aufrichtigen Glückwünsche darzubringen. Der Empfang musste vonseiten des Herrn Schwagers ein recht kühler gewesen sein, denn zwei Jahre vergingen, bevor er abermals erschien, um den Herrn Geheimrat gegen die Sicherheit seiner Ehrlichkeit schüchtern um ein mäßiges Darlehen zur Begründung einer eigenen Werkstatt zu ersuchen. Zum Überfluss fügte er hinzu, dass er sich, nachdem er festen Fuß gefasst habe, nach einer braven Frau mit etwas Geld umzusehen gedenke. Darauf antwortete der Herr Geheimrat trotz der flehenden Blicke seiner jungen schönen Gattin ablehnend. Vornehm berief er sich darauf, dass er sich grundsätzlich allen Geldgeschäften fernhalte. Unter vier Augen bot er ihm dagegen ein Geschenk in Höhe von vierhundert Talern, wenn er sich verpflichte, das Geld zur Überfahrt nach Amerika zu verwenden, wo er tausendfach Gelegenheit finde, sich zu Ansehen und Reichtum emporzuschwingen.
In dem Gefühl, dass der Herr Schwager nur danach trachte, sich auf alle Zeiten seiner zu entledigen, aber auch in dem Bewusstsein, ein derartiges Beiseiteschieben nicht zu verdienen, zumal er sich stets in respektvoller Entfernung von ihm gehalten hatte, ging er nach kurzem Überlegen auf das Anerbieten ein. Die Heimat war ihm eben durch das herzlose Verfahren verleidet worden. Am liebsten hätte er dem Geheimrat das Geld vor die Füße geworfen, wäre es ihm nur möglich gewesen, die Mittel zur Ausführung des in ihm angeregten Planes anderweitig aufzutreiben. So landete er denn eines Tages wohlbehalten und mit über dreihundert Talern in der Tasche in New York, wo er bald lohnende Arbeit fand.
Sparsam, fleißig und ehrlich, nebenbei von ungewöhnlichem Scharfsinn, legte er einen Dollar nach dem anderen zurück. Daneben aber vorsichtig, sogar misstrauisch, beteiligte er sich mit seinem kleinen Kapitälchen an einem ihm sicher erscheinenden Unternehmen, wobei er so glücklich war, sein Vermögen im Laufe des ersten Jahres zu versechsfachen. Ohne Sorgen und schlaflose Nächte war es dabei nicht abgegangen. So beschloss er, um das Erworbene nicht wieder aufs Spiel zu setzen, allen Spekulationen endgültig zu entsagen.
Neben der Begeisterung für das Tischlergewerbe beseelte ihn der gleichsam fanatische Wunsch, ein Stückchen Land zu besitzen, dessen Eigentumsrechte gerade bis in den Mittelpunkt der Erde hineinreichten. Da aber der Grund und Boden in der Nachbarschaft von New York zu teuer war, so entschloss er sich, westwärts zu ziehen, und wählte zu seinem Ziel St. Louis.
Mit ungefähr achtzehnhundert Dollar in der Tasche und frischem Lebensmut in der Brust traf er daselbst ein. Vier volle Wochen verwendete er als vorsichtiger Geschäftsmann darauf, sich mit den dortigen Verhältnissen einigermaßen vertraut zu machen und in der Nachbarschaft etwas Umschau zu halten. Die nächste Folge davon war, dass er eines Tages mit einem Farmer, der eine Strecke außerhalb der Stadt Ackerbau und Viehzucht betrieb, sich um dessen sechzig Morgen Land einigte. Fünfzehnhundert Dollar zahlte er an, ebenso viel blieb ihm noch abzuzahlen. Kaum zwei Wochen waren verstrichen, da hatte er in dem alten hölzernen Wohnhaus seine Werkstatt eingerichtet.
Anfänglich war sein Erwerb ein kümmerlicher, indem er darauf angewiesen war, bei benachbarten Farmern in der Vorstadt Arbeit zu suchen. In demselben Maß aber, in welchem er als gewissenhafter Meister bekannt wurde, mehrten sich auch seine Aufträge, sodass er schon nach Ablauf des ersten Jahres einen Teil seiner Schulden abzutragen vermochte. Nur einen Kummer hatte er. Der bestand darin, dass er, ursprünglich eine gesellige Natur, seine Tage in tiefer Einsamkeit zu verleben gezwungen war, außerdem aber die Zeit ihm fehlte, die kleinen Gartenfelder und tragfähigen Obstbäume hinter dem Haus nach Gebühr auszunutzen. Doch auch darüber half ein glücklicher Zufall ihm hinweg.
Nach vollbrachtem Tagewerk von der Stadt heimkehrend, sprach er in einer Schänke vor, um daselbst mit einem Glas Bier sich zu erquicken. Nebenbei hatte ihn Musik angelockt. Als er eintrat, wurde er eines mit ihm ungefähr gleichaltrigen Mannes ansichtig, der sich durch wildes braunes Lockenhaar, einen stolz emporgedrehten starken Schnurrbart nebst Knebelbart auszeichnete. Ziemlich schäbig gekleidet, hielt er auf den Knien eine große Ziehharmonika, welcher er mit erträglicher Gewandtheit die allerschönsten Heimatweisen entlockte.
Über sein Glas hinweg beobachtete Martin Findegern den Virtuosen lange aufmerksam. Hin und wieder schüttelte er den Kopf zweifelnd, um bald wieder, die Blicke auf den Fremden gerichtet, in tiefe Betrachtungen zu versinken.
Endlich ließ der Virtuose in seinen Vorträgen eine Pause eintreten. In würdevoller Haltung mit einem Notenblättchen von Tisch zu Tisch schreitend, gelangte er auf seinem Rundgang auch zu Martin Findegern. Pünktlich legte dieser das bereitgehaltene Fünfcentstück auf das Papier, bemerkte aber, indem er scharf zu dem vor ihm Stehenden aufsah: »Es sollte mich nicht wundern, hätten wir uns früher schon gesehen.«
»Habe nicht die Ehre«, versetzte der Fremde, das Gesicht geringschätzig halb abkehrend, infolgedessen Martin Findegern deutlich zwei lange Narben unterschied, die sich auf seiner linken Wange kreuzten.
»Doch, doch, Mann«, erklärte Martin dringlicher, »ich könnte darauf schwören. Die beiden Schmarren in Ihrem Gesicht sind mir unvergesslich.«
»Wo sollten wir einander begegnet sein?«, hieß es noch immer vornehm herablassend zurück. wie im Spott senkte sich der eine Mundwinkel samt der betreffenden Schnurrbarthälfte.
»Bless you, Mann, in Heidelberg«, erklärte Martin Findegern lebhaft. »Jetzt entsinne ich mich auch Ihres Namens. Krehle nannte man Sie, als es sich darum handelte, Zeugenaussagen zu bestätigen. Das war ja eine fürchterliche Schlägerei zwischen Studenten und Handwerksburschen. Wenn Sie mir damals mit Ihrem ungehörig schweren Stock den Schädel nicht in Scherben brachen, so lag es sicher nicht an Ihrem guten Willen. Hatte ich doch kaum noch die Kraft, Sie über den Kopf zu schlagen, dass Ihnen das Blut über die Stirn lief. Das Ende vom Lied war: Ich musste drei Tage brummen.«
Mehr und mehr hatten sich bei diesen eifrigen Mitteilungen Krehles Züge erhellt. Ein Anflug von Wehmut trübte gleich darauf seine Augen. Als Martin schloss, da knüpfte er an dessen letzte Bemerkung mit den Worten an: »Und mir wurden vierundzwanzig Stunden Karzer zuerkannt. Doch gleichviel, der empfangene Schlag hat wenigstens in dieser Angelegenheit mein Gedächtnis verschärft. Ich müsste mich sehr irren, wenn Sie nicht ein gewisser Findegern wären.«
»Martin Findegern, wie er leibt und lebt«, bestätigte dieser sichtbar herzlich erfreut. Treuherzig reichte er dem früheren Gegner die Hand. »Wenn mir seit langer Zeit wieder einmal eine angenehme Überraschung widerfuhr, so geschah das heute, als ich die beiden Schmarren in Ihrem Gesicht wiedererkannte.«
Wie Martin Findegern offenbarte nun mehr auch Krehle seine Befriedigung, jemand gefunden zu haben, mit dem er gemeinschaftlich der alten Zeiten gedenken könne. Dann aber dauerte es nicht lange, da saßen die einstigen Todfeinde in angelegentlichem Gespräch vertraulich beieinander. Das Ergebnis dieser, wohl eine Stunde dauernden Unterhaltung war, dass Doktor Arminius Krehle, wie er sich stolz nannte, mit dem Wanderstab in der rechten Hand und die Ziehharmonika unter dem linken Arm – seine ziemlich schlaffe Reisetasche trug Martin Findegern – diesen nach Hause begleitete, um sich nicht mehr von ihm zu trennen. Als Bedingung war zwischen ihnen vereinbart worden, dass Doktor Krehle die Pflege des Gartens und der Obstbäume zu übernehmen habe, wofür Martin Findegern ihm ein seinen Bedürfnissen entsprechendes Monatsgehalt zusagte. Da mit dieser Beschäftigung Krehles Zeit nicht ganz ausgefüllt wurde, so versuchte er es mit dem Schreiben von Zeitungsartikeln, jedoch nur solange, bis er sich von der Nutzlosigkeit seines Strebens überzeugte. Seine Anschauungen passten eben nicht für die amerikanischen Verhältnisse. Dann verfiel er auf die Idee, eine Schmetterlingssammlung für den Verkauf ins Ausland anzulegen. Allein auch damit wurde es nichts, weil die selteneren Falterarten ihm zum Zweck des Aufgespießtwerdens nicht zufliegen wollten. Nach diesen bitteren Täuschungen entschloss er sich endlich schweren Herzens, ebenfalls zu einem Handwerk zu greifen. Er begann damit, sich in das Geheimnis des Lackierens der von Martin Findegern angefertigten Möbel einweihen zu lassen. Der Erfolg war ein überraschender. Außerdem aber entdeckte er bei dieser Gelegenheit sein Talent zum Malen, welches er in seinen zahlreichen Mußestunden zur eigenen Befriedigung und Martins ungeheuchelter Bewunderung mit lobenswertem Eifer pflegte. Sein erstes Meisterwerk bestand darin, dass er auf einem Brett oberhalb der Haustür das Bildnis einer Riesenschnecke herstellte, welche ihr in allen Regenbogenfarben prangendes Haus auf dem Rücken trug, eine von Martin Findegern dankbar anerkannte Anspielung, weil er selber nicht nur sein Haus, sondern auch den ganzen wüsten Platz am liebsten überall hin mit sich herumgeschleppt hätte. So war er auch vollkommen zufrieden damit, dass sein Heimwesen von da ab den Namen Schneckenhaus führte. Nach dieser ersten gelungenen Probe entstanden darauf, wo nur immer eine geeignete Fläche sich innerhalb und außerhalb des Hauses bot, zahlreiche charakteristische Gemälde, namentlich Porträs Findegerns in allen denkbaren Stellungen, an welchen die beiden Gefährten sich in gleichem Maß erfreuten.
Aus den beiden Haus- und Arbeitsgefährten wurden solcher Art zwei Freunde, die trotz der Verschiedenartigkeit ihrer Bildungsstufe und Ansichten mit unverbrüchlicher Treue aneinander hingen. Wenn aber diese Verschiedenartigkeit häufig zu bösem Hader führte, der in vielen Fällen mit einer gegenseitigen Kündigung auf sofort endete, so kühlten die Gemüter sich andererseits jedes Mal ebenso schnell wieder ab, wie sie sich erhitzten, und alles ging seinen gewohnten ruhigen Gang. Doch so eng sie miteinander verbunden sein mochten; eine Kluft blieb zwischen ihnen bestehen, nämlich dass statt der vielleicht wohl angebrachten Brüderschaft das etwas Förmliche: Herr Doktor Krehle und Herr Martin Findegern fortan Geltung behielt.
Zehn Jahre waren verstrichen, als Martin Findegern gezwungen war, zum Zweck der Weiterführung und Neuanlage von Straßen, einen Teil seines Besitztums selbstverständlich gegen hohe Entschädigung an die Stadt abzutreten. Doktor Krehle nannte es ein glänzendes Geschäft, natürlich der Grund zu einem ernsten Zerwürfnis, wogegen Martin Findegern tränenden Auges überwachte, wie sein Land zu einem regelmäßigen Viereck beschnitten wurde. Er beruhigte sich sehr bald, nachdem die ihm gebliebene, noch immer sehr ansehnliche Fläche, laut Kontrakt mit einem acht Fuß hohen festen Palisadenzaun eingehegt worden war. Seine Befriedigung erhöhte, dass er von jetzt ab die Grenzen seines Eigentums so viel leichter zu übersehen vermochte.
Durch den erheblichen baren Vermögenszuwachs war er freilich in die Lage geraten, eine Familie ohne viele Sorgen ernähren zu können. Leider stand er aber schon in einem Alter, in welchem man wählerisch wird. Wie für den Doktor Krehle war es auch für ihn selbst ein unerträglicher Gedanke, die Herrschaft auf seinem Grund und Boden mit einer noch so sanftmütigen Hausehre teilen zu müssen.
Abermals gingen fünf oder sechs Jahre dahin. Aus der Tischlerei war längst eine Sargfabrik geworden, für welche sogar mehrere Meister in der Stadt arbeiteten, als eines Tages ein pfiffig dreinschauender Amerikaner bei Martin Findegern erschien und ihm vierzigtausend Dollar für seine Besitzung bot.
Obwohl freudig erstaunt, schüttelte Martin den Kopf und erklärte mit verschmitztem Augenblinzeln, dass er sein Land nicht gekauft habe, um es wieder aus den Händen zu geben.
Der Amerikaner erhöhte sein Gebot um fünftausend Dollar; abermals und immer wieder, bis er endlich die Summe von achtzigtausend erreichte, jedoch nur, um ebenso oft von dem nicht minder pfiffigen Martin zu hören, dass er um das Geld betrogen und bestohlen werden könne, wogegen es schon einen recht kräftigen Mann erfordere, um auch nur einen Sack voll Erde von seinem Grundstück heimlich davonzutragen. Damit war die Sache erledigt.
Jahre gingen dahin und näher rückte die Stadt seiner geliebten Scholle, als ihm, wiederum unerwartet, der Vorschlag zuging, sein Grundstück, ohne viel zu feilschen, für hundertundfünfzigtausend Dollar hinzugeben.
»Nicht für doppelt so viel«, entschied Martin Findegern zu Doktor Krehles Entzücken, der für seine Kunsterzeugnisse fürchtete. Weiter lebte er mit dem von ihm unzertrennlichen Gefährten nach alter Weise, ohne sich jemals nach einer Änderung seiner äußeren Lage zu sehnen. Das Einzige, wozu er sich entschloss, bestand darin, dass er eine schwarze Aufwärterin annahm, welche den Tag über seinem bescheidenen Hauswesen vorstand, jedoch des Abends sich jedes Mal wieder entfernte.
Jahr auf Jahr verstrich. Mit jedem einzelnen wuchsen und befestigten sich die Seltsamkeiten der beiden alternden Junggesellen Jahr auf Jahr und nach Tausenden zählten die Menschen, welchen Martin ihr letztes Haus gebaut und Doktor Krehle es kunstgerecht lackiert hatte. Die Stadt, und zwar deren schönster Teil, schob sich an dem Palisadenzaun vorbei. Neue erhöhte Angebote ergingen an Martin Findegern, ohne dass sein fester Wille dadurch erschüttert worden wäre. Als er aber endlich viermal hunderttausend Dollar mit einer Miene ablehnte, als ob es sich um einen Korb Hobelspäne zum Anheizen gehandelt habe, da nannte man ihn verrückt. Höchstens erkundigte man sich noch unter der Hand, ob er den Schandflecken der Stadt nicht aufgeben wolle, um sich mit einem soliden Vermögen zur Ruhe zu setzen. Immer vergeblich.
So war das Jahr 1862 herangekommen, also das zweite des mit wachsender Erbitterung geführten Bürgerkrieges, als das patriarchalische Leben der beiden innig verbundenen Gefährten eine nichts weniger als willkommene Störung erleiden sollte.
Mit Europa hatte Martin Findegern seinen ohnehin spärlichen Briefwechsel gänzlich aufgegeben, nachdem ihm die betrübliche Kunde von dem Tod seiner Schwester übermittelt worden war. Das geschah vor acht Jahren, mithin lange genug für ihn, die ganze überseeische Verwandtschaft zu vergessen. Sich bei dem geheimrätlichen Schwager nach dessen drei Kindern zu erkundigen, hielt er für überflüssig, weil er glaubte, auf keine Antwort rechnen zu dürfen. So gedachte er auch ihrer, die er nie kennenlernte, kaum noch beiläufig.
***
Frühling war es und ein so lieblicher Nachmittag, wie er unter jenen bevorzugten Breiten nur denkbar ist. Die Pfirsich- und Apfelbäume hinter dem Schneckenhaus blühten üppig und verheißend. Auf den breiten Landflächen, die unbestellt blieben, grünten dagegen Unkraut und Brombeerranken um die Wette mit den jungen Pflanzen auf den nach Schnur- und Winkelmaß sich aneinanderreihenden Beeten. Träge hing das Sternen- und Streifenbanner vom hohen Flaggenmast nieder, welchen Martin bald nach Ausbruch des Krieges aus Patriotismus für den Norden und zum Hohn der in St. Louis lebenden zahlreichen Sezessionisten errichtet hatte, um jede von den Unionisten gewonnene Schlacht durch deren Hissen feierlich begrüßen zu können.
Mit der Anfertigung eines Sarges für das Magazin beschäftigt, während Doktor Krehle einen anderen mit großer Sorgfalt lackierte, hatte er eben Vesperschicht gemacht, um mit diesem beim Glas Bier ein halbes Stündchen zu verplaudern. Auf der Hobelbank saß er, neben sich ein Zeitungsblatt – seit Ausbruch des Krieges waren die beiden alten Junggesellen eifrige Politiker geworden, dessen Inhalt den Stoff für ihr Gespräch bildete.
Von guter Mittelgröße, hager, dabei aber kräftig und sehnig gebaut, mit dem gefaltelten weißen Hemd – er hielt nämlich nach amerikanischer Sitte auf seine Wäsche – ferner mit der blauen Latzschürze und den bis über die Ellenbogen emporgerollten Ärmeln war Martin Findegern nicht nur eine selbstbewusste, sondern auch ansehnliche Erscheinung. Trotz des respektablen Alters von achtundfünfzig Jahren verriet sich in seiner Beweglichkeit noch immer eine gewisse Jugendfrische. Seinem länglichen, hageren Gesicht mit den klugen blauen Augen und der wunderbar spitz in die Welt hinausragenden, etwas schief geratenen großen Nase gereichte zur besonderen Zierde ein pinselartiges Bärtchen von zweifelhafter Farbe, welches sich unterhalb des Kinns keck hervorschob.
Gutmütigkeit war der Hauptausdruck dieses wunderlichen Antlitzes. Daneben aber machte sich ein eigentümlichter Zug von Verschlagenheit geltend, sodass man bei der ersten oberflächlichen Bekanntschaft nicht recht wusste, welcher von diesen Eigenschaften der Vorrang gebührte. Sein mit Weiß gemischtes rötliches Haar bedeckte ein schwarzer Zylinderhut – eine andere Kopftracht kannte er nicht – den er, so oft eine Pause in der Arbeit eintrat, mit großem Bedacht auf seine feuchte und daher gegen Erkältung empfindliche Stirn drückte.
Vor ihm auf einem des Anstrichs harrenden Sarg saß Doktor Arminius Krehle, neben sich ein Glas Bier und zwischen den Zähnen eine echt deutsche lange Pfeife mit verschossenen Seidenquasten. Seitdem er zum ersten Mal wieder mit Martin Findegern zusammentraf, hatte er sich im Äußeren nur wenig verändert. Da war dasselbe braune, jetzt freilich mit einigen Silberfäden durchzogene lockige Haar, derselbe Bartschnitt, wie er ihn schon als flotter Bursche getragen haben mochte. Da waren vor allen Dingen dieselben braunen Augen, die in einer Weise schauten, als ob ihm das ganze Erdenrund untertan gewesen wäre. Von einem bestimmten Ausdruck seines runden, fleischigen Gesichtes ließ sich eigentlich nichts Zuverlässiges behaupten. Unzweifelhaft war nur der einer unerschütterlichen Gemütsruhe, wie sie seiner zur Wohlbeleibtheit hin neigenden kurzen Gestalt entsprach und sich dem lebhafteren Freund gegenüber leicht bis zu dessen Verzweiflung steigerte.
Martin hatte eben einen Kriegsbericht vorgelesen und seine kurze Pfeife mit dem Porzellankopf in Brand gesetzt, worauf er, die Brauen zur Stirn hinaufschraubend und mit dem rechten Auge listig blinzelnd, seine Erörterungen mit den Worten eröffnete: »Sie können glauben, Herr Doktor, diese gelegentlichen Rückwärtsbewegungen der Unionisten sind nur darauf berechnet, den Feind in eine Falle zu locken.«
Krehle drückte mit dem kleinen Finger die Asche in seiner Pfeife nieder, senkte den linken Mundwinkel samt Schnurrbarthälfte tief herab, die bekannte Bewegung, welche Martin auf hundert verschiedene Arten deutete und verabscheute, und antwortete empörend gleichmütig: »Die Unionisten gehen ohne Zweifel bis über Washington hinaus zurück, damit die Sezessionisten mit aller Bequemlichkeit in die Landeshauptstadt einziehen können.«
»Bless you, Herr Doktor«, versetzte Martin, welchem die Zornesröte ins Antlitz stieg. »Wüsste ich nicht, dass Sie im Herzen aufseiten der Nördlichen stehen, möchte ich Sie für einen Rebellen halten. Es sollte mich kaum wundern …«
Das Bellen des Hofhundes, welches Fremde anmeldete, unterbrach ihn. Beide spähten durch das Fenster zum Torweg hinüber.
»Ein wunderbar kluges Tier, dieser Hobel. Meldet die Leute, bevor sie die Pforte geöffnet haben«, bemerkte Martin. Nachdenklich betrachtete er den durch seinen Namen der Tischlerzunft eingereihten Hund, welcher auf Grund seines Äußeren wie seiner Seltsamkeiten mit Fug und Recht als der Dritte im Bunde bezeichnet werden durfte. Ungewöhnlich groß und gänzlich schweiflos, nebenbei ein Ausbund von Hässlichkeit, zählte er zur Sippe der Schlächterhunde. Seinen Dienst versah er mit erträglicher Gewissenhaftigkeit. Was er sonst noch verstand, beschränkte sich auf die ihm von Krehle mit großer Geduld beigebrachte Kunst, auf ein gegebenes Zeichen, sich auf derselben Stelle im Kreis zu drehen und lustig bellend mit den Zähnen nach seinem abhandengekommenen Schweif zu schnappen. Endlich öffnete sich die Pforte zögernd, als hätten die betreffenden Besucher vor ihrem Eintritt noch einige beratende Worte gewechselt. Herein schritten zwei Herren und eine Dame, die nach flüchtiger Umschau die Richtung zum Schneckenhaus hinüber einschlugen.
»Die sehen nicht aus, als kämen sie, um sich einen Sarg zu bestellen«, meinte Krehle, die Fremden aufmerksam betrachtend.
»Die nicht«, bestätigte Martin, »aber sie spähen um sich, als ob sie den Wert meines Grundstückes abschätzten. Wahrscheinlich Kauflustige.«
»Ist ein gutes Geschäft zu machen, so würde ich an Ihrer Stelle darauf eingehen«, bemerkte Krehle gleichmütig.
Martin Findegern schleuderte ihm einen Zornesblick zu, indem er erklärte: »Heimleuchten will ich ihnen, dass ihnen die Kauflust auf ewig vergeht.«
Schnell drückte er den Hut, den er eben abgelegt hatte, wieder auf sein Haupt. In der Absicht, den Fremden dadurch den Weg zu zeigen, trat er ins Freie hinaus.
Die sich Nähernden waren Martins kaum ansichtig geworden, als sie ihre Schritte auf ihn zulenkten, jedoch in den Bewegungen immer noch Zweifel verrieten. Er gewann dadurch Zeit, sie eingehender zu prüfen, nicht minder Krehle, der sie schadenfroh durch das Fenster betrachtete.
Zwei stattliche junge Männer waren es, die am wenigsten wie Geschäftsleute aussahen, dagegen sowohl in Haltung als auch Bekleidung ein besseres Herkommen verrieten. Weit jünger als sie, höchstens siebzehn Jahre alt, war ihre Begleiterin, deren Blicke, nach den lebhaften Bewegungen des mit einem kleidsamen Strohhut bedeckten Hauptes zu schließen, kindlich neugierig in alle Richtungen flogen, bis sie endlich auf der blauen Schürze und dem hohen schwarzen Hut haften blieben.
Je näher die jungen Leute kamen, um so durch dringender starrte Martin auf die drei hübschen Physiognomien. Es war, als hätte er in denselben nach etwas gesucht. Unwillkürlich nahm er die erloschene Pfeife aus dem Mund, sie hinter dem Schürzenlatz bergend. Einen plötzlich erwachten Argwohn vergeblich bekämpfend, bemerkte er kaum, dass die beiden jungen Männer ihn höflich begrüßten, und das Mädchen, eine schlanke, freundliche Gestalt mit hold selig errötendem fröhlichen Kinderantlitz, sich anmutig verneigte. Den Rand seines Hutes als Gegengruß mit den Fingern nachlässig berührend, fragte er eintönig, womit er dienen könne, dann wechselte er die Farbe. Scharfsinnig hatte er entdeckt, dass die Fremden mit einem Ausdruck auf ihn hinsahen, welchem unzweideutig Enttäuschung zugrunde lag.
Schreibe einen Kommentar