Der Spion – Kapitel 2
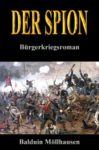 Balduin Möllhausen
Balduin Möllhausen
Der Spion
Roman aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, Suttgart 1893
Kapitel 2
Der Vaquero
Vom Lager der Kundschafter bis zu der bedrohten Ansiedlung betrug die Entfernung ungefähr eine Stunde mäßig schnellen Einherreitens. Nicht über sechshundert Einwohner zählend erhob sich der Ort inmitten von Hainen, Waldstreifen, Wiesen, Ackerflächen und sanft ansteigenden Hügeln. Ziegelsteine waren bei Errichtung der Baulichkeiten nur ausnahmsweise verwendet worden. Um so einladender nahmen sich dafür die aus Balken und Brettern zusammengefügten Häuser mit ihrem weißen Anstrich und den grauen Schindeldächern aus. So waren auch die wenigen Straßen noch nicht gepflastert. Begünstigte aber kein dem Handelsverkehr einen bequemen Weg bietender Strom die Lage des Örtchens, so ließ sich doch voraussehen, dass die dort vorüberführende Eisenbahn demselben eine von Jahr zu Jahr wachsende Wichtigkeit verleihen würde.
Am heutigen Tag erschien es, als ob der düstere Schleier, welcher seit dem Beginn des brudermörderischen Krieges über dem ganzen Staat schwebte, sich zu einer schweren Gewitterwolke verdichtet habe, die sich über dem bisher von feindlichen Angriffen verschont gebliebenen Städtchen zu entladen drohte. Die Sägemühle hatte freilich schon, wer weiß wie lange, gerastet, ebenso die Brennerei, während die Mahlmühle nur noch mit Unterbrechungen arbeitete. Dagegen erzeugte es den Eindruck, als hätten die erkalteten langen Schornsteine heute doppelt misstrauisch gen Himmel gestiert. Wo aber Leute sich auf der Straße begegneten und anredeten, da geschah es mit ängstlichem scheuen Wesen, wie in Befürchtung, dass ihre Stimmen über das Weichbild der Ansiedlung hinausgetragen werden könnten.
Es hatte sich nämlich das dumpfe Gerücht verbreitet, dass eine der den Staat brandschatzenden stärkeren Guerrillabanden die Richtung auf den heimatlichen Ort eingeschlagen habe und deren Eintreffen von Tag zu Tag zu erwarten sei. Es beeilte sich daher jeder, Geld und sonstige Wertgegenstände an sicherem Ort zu verbergen, Pferde und Rinder in die benachbarten Waldungen zu treiben und auf diese Art die bevorstehenden Verluste wenigstens auf das geringste Maß zu beschränken. Was sonst noch von der räuberischen Horde als gute Beute erklärt oder im rohen Übermut vernichtet wurde, war natürlich nicht abzusehen – das musste man eben über sich ergehen lassen. Denn um Widerstand zu leisten, nachdem eine Anzahl streitfähiger Männer zum Kriegsdienst herangezogen worden war, reichten die Kräfte nicht aus. Wenn man aber auch alles verlor, und nur die Familienmitglieder dem Leben erhalten blieben, so gab es ja nichts, das unersetzlich gewesen wäre. Neue Hoffnungen grünten aus den Trümmern irdischer Habe, solange die Schaffenslust nicht durch Trauer um diesen oder jenen teuren Angehörigen gelähmt wurde.
Beinahe die Hälfte des Nachmittags war verstrichen, als ein einzelner Reiter vor dem Südende des Örtchens auftauchte und, in die Hauptstraße einbiegend, dieselbe gemächlich folgte. Wer ihn aus der Ferne sah, mochte ihn aufgrund seines Aufzuges für ein Mitglied der gefürchteten Horde halten, welcher er vielleicht als Kundschafter vorausgeritten war. Diese Besorgnis schwand, sobald man in ihm einen anscheinend siebzehnjährigen Burschen erkannte, auf dessen auffällig ernstem Antlitz nichts weniger als Raubgier sich ausprägte. In seinem offenbar lang gedienten, indianisch gestickten faltigen Lederhemd, welches nach unten in eng anschließenden Beinkleidern verschwand, die unterhalb der Knie in steifen Gamaschenledern ihre Fortsetzung fanden, und mit den schweren, klirrenden Schnallsporen, bot er das Bild eines harmlosen jungen Vaqueros, wie solche die mexikanischen Handelskarawanen auf ihren Wüstenreisen zu begleiten pflegen. So ritt er auch ein mit mexikanischem Sattelzeug ausgerüstetes, zwar kleines und hageres, jedoch augenscheinlich sehr zähes und flinkes Pferd, dasselbe mit einer nachlässigen Sicherheit lenkend, als ob seit frühester Kindheit der Sattel seine Heimat gewesen wäre. Als Waffe führte er nur den auf der rechten Hüfte in einem Futteral steckenden Revolver, welchem auf der anderen Seite des Gurtes ein langes dolchartiges Messer gewissermaßen das Gegengewicht hielt. Außerdem hing vom Sattelknopf ein aus Wildleder geflochtenes, geschmeidiges Lasso mit poliertem Stahlring handgerecht in mehreren großen Schlingen nieder. Den schwarzen schlappen Filzhut mit der breiten Krempe hatte er weit auf den Hinterkopf hinaufgeschoben. Rabenschwarzes Haar, auf der Stirn in der Höhe der Brauen stumpf abgeschnitten, fiel hinten nach Indianerart über die Schultern und tief auf den Rücken nieder. Das von demselben eingerahmte Antlitz war klassisch regelmäßig geformt und von auffallender Schönheit. Von jener gelblichen Farbe, wie sie den Mexikanern im Allgemeinen eigentümlich, charakterisierte dasselbe eine seltsame träumerische Ruhe. Dagegen funkelten die Augen unter den wie müde gesenkten Lidern in einer Weise hervor, als hätten sie alles in ihrem Bereich Befindliche mit einem einzigen Blick in sich aufnehmen wollen. Wer den jungen Reitersmann sah, betrachtete ihn verwundert. Der eine und der andere rief ihm auch einen Gruß zu, ohne mehr als ein ausdrucksloses Neigen des Hauptes zur Antwort zu erhalten. Man begriff, dass er nicht in ein Gespräch gezogen zu werden wünschte.
So war er allmählich bis dahin gelangt, wo die Straße auf der einen Seite von einem umfangreichen Grundstück begrenzt wurde. Zwei voneinander gesonderte Fabrikgebäude erhoben sich auf demselben, und zwischen diesen ein aus Ziegelsteinen erbautes Haus mit hohem Erdgeschoss, offenbar die Wohnung des unzweifelhaft reich begüterten Besitzers. Ein freundlicher Garten erstreckte sich von diesem bis zur Straße, von welcher er durch ein weiß gestrichenes Holzgitter getrennt wurde. Oberhalb des Torweges war, die beiden Eckpfeiler miteinander verbindend, ein ebenfalls weiß angestrichenes Brett angebracht worden, und auf diesem stand, weithin lesbar geschrieben: William Rutherfield.
Der junge Vaquero hielt sein Pferd an. Flüchtig las er die Inschrift, aufmerksamer betrachtete er die verschiedenen Baulichkeiten. In jeden Winkel bohrte er die Blicke gleichsam ein, in jedes Fenster, wie um sich mit allen dahinterliegenden Räumen vertraut zu machen. Da aber die Fabriken stilllagen, nirgendwo ein Arbeiter sichtbar wurde, an den er sich mit einer Frage hätte wenden können, ebenso das Wohnhaus verödet und ausgestorben erschien, trieb er sein Pferd wieder an. Nach Zurücklegung einer kurzen Strecke hielt er abermals, und zwar vor einem Haus, welches sich durch eine umständliche Inschrift und andere sprechende Merkmale als eine Schankwirtschaft kennzeichnete.
Ein älterer Yankee in Hemdsärmeln und breitrandigem Strohhut, in dessen Zügen sich bittere Unzufriedenheit ausprägte, stand in der Tür. Er war so versunken in den Anblick des jungen Reiters, dass er dessen erste Anrede überhörte.
»Ich frage nochmals, Herr«, wiederholte dieser mit heller, klangvoller Stimme, »kann ich hier einen Trunk Wasser mit einem Tropfen Whisky oder Essig darin erhalten, dazu vielleicht ein Stück gebratenes Fleisch nebst Brot? Verbrachte man seine acht Stunden im Sattel, ohne Gelegenheit zum Einkehren zu finden, so ist man mit dem Geringsten zufrieden.«
Zweifelnd sah der Wirt in das von aufreibenden Anstrengungen gezeichnete jugendliche Antlitz, dessen ernster Ausdruck so wenig im Einklang mit dem mutmaßlichen Alter des jungen Mannes stand, antwortete aber bereitwillig: »Was Ihnen dient, sollen Sie haben, vorausgesetzt, Sie gehören nicht zu den Leuten, die sich haufenweise im Lande umhertreiben, um sich auf Kosten friedlicher Bürger zu bereichern.«
»Gehörte ich zu denen«, antwortete der Vaquero spöttisch, »so würde ich nicht lange bitten, sondern warten, bis meine Kameraden eingetroffen wären, und dann nehmen, was mir gefiele.«
»Das klingt mannhaft und aufrichtig, wenn auch beinahe zu trotzig für ein bartloses Gesicht«, versetzte der Wirt mürrisch, »aber was in der Hölle Namen führt Sie hierher, wenn Sie dem Raubgesindel fern stehen? Und in diesem Teil des Landes sind Sie sicher nicht zu Hause, das steht auf Ihrem Gesicht geschrieben.«
»Gewiss nicht«, hieß es gleichmütig zurück, »das hindert mich nicht, dahin zu reiten, wohin es mir beliebt. Doch damit Sie es wissen: Ich diene bei einer Gesellschaft von Trabern, die, um ihre Waren an den Mann zu bringen, von New Mexiko heraufkam, wo es seit dem Ausbruch des Krieges drunter und drüber geht. Fünf Tagesreisen weit in die Prärie hinein steht unser Lager. Da begab ich mich auf den Weg, um auszukundschaften, ob hier herum vielleicht Geschäfte zu machen seien.«
»Ein langer Ritt für einen einzelnen Mann, bei Gott; doch was brachten Sie in Erfahrung?«
»Genug, um mich zu entschließen, diese Gegend so bald wie möglich wieder hinter mich zu legen; denn bevor viel Zeit vergeht, ist hier der Teufel los. Zögern Sie aber mir einen Trunk zu reichen, so will ich Ihnen trotzdem keinen guten Rat erteilen. Spricht Sie binnen Kurzem wieder jemand um eine Herzstärkung an, so fragen Sie nicht lange nach dem Woher und Wohin, oder es möchte sich ereignen, dass Ihr Haus und Hof in Flammen ständen, bevor Sie für sich selbst einen Trunk mischten. Geben Sie, was Sie haben, und seien Sie froh, wenn keine Pistolenmündungen Sie angrinsen.«
»Ein feiner Rat, beim Allmächtigen, junger Mann«, versetzte der Wirt zuvorkommender, »und ein gutes Mahl will ich Ihnen nicht vorenthalten, ohne Kostenberechnung obenein, wenn Sie mir dafür anvertrauen, ob die Raubbande, von der wir hörten, auf hier marschiert.«
Der junge Vaquero schwang sich aus dem Sattel, und das Lasso auseinanderrollend, band er sein Pferd an das zu solchen Zwecken vor dem Haus errichtete Lattengerüst. Nachdem er es abgezäumt und um ein Dutzend Maiskolben gebeten hatte, fuhr er fort: »Ich bin erstaunt, dass bisher noch keiner im Ort sich die Mühe gab, auszukundschaften, dass eine Horde von mindestens vierhundert Mann nahe genug ist, um sich nach Ablauf weniger Stunden hier anzumelden. Vom Osage River ist sie heraufmarschiert, und zwar, um den Unionisten auszuweichen, in Bachtälern und Regenschluchten. In ihrem Plan liegt es offenbar, sich erst dann bemerklich zu machen, wenn sie vor euren Türen steht.«
In den Zügen des Wirtes verriet sich Bestürzung. »Sollte das wahr sein?«, fragte er ungläubig.
»So wahr, wie ich von niemand etwas geschenkt nehme«, antwortete der Bursche mit einer Zuversicht, dass des Wirtes Gesicht sich merklich verlängerte, »nicht einmal einen Trunk, der auch nur um einen Fingerhut voll Brandy stärker ist, als klares Wasser. Sie werden mir daher den Preis für das Mahl berechnen, wie Sie es gewohnt sind.« Nachdem das Pferd mit Futter versorgt worden war, und er dann an der Seite des Wirtes den als Schänke dienenden Raum betrat, fügte er hinzu: »Ja, die Schurken weilen in der Nachbarschaft, und ich vermute, sie fühlen sich stark genug, um mit ihrem Einzug nicht bis nach Einbruch der Nacht zu säumen. Ich entdeckte sie zufällig, möchte sonst als friedliebender Reisender schwerlich viel nach ihnen gesucht haben.«
»Das ist ein Unglück«, kehrte der Wirt sich verstört einigen eben eintretenden Gästen zu, die offenbar durch die auffällige Erscheinung des Vaqueros herbeigelockt worden waren und dieselbe in Beziehung zu den bedrohlichen Gerüchten brachten. »Ein großes Unglück«, wiederholte er, dem jugendlichen Reiter ein Glas Wasser und eine Flasche Rum nebst Zucker zuschiebend, »hier steht ein zuverlässiger Zeuge, wenn er auch noch jung sein mag, und der behauptet, dass die seit einer Woche angekündigten Banditen vor Abend hier sein werden. Bewahrheitet sich das, so mag Gott uns gnädig sein, dass es ohne Blutvergießen abgeht.«
Die von allen Seiten an ihn gerichteten Fragen beantwortete der Vaquero kurz und bestimmt, sodass Zweifel an der Verbürgtheit seiner Mitteilungen keinen Raum fanden. Zugleich bemächtigte sich aller wahres Entsetzen. Eine Weile verhandelte man noch lebhaft; dann eilte der eine hier hin, der andere dort hin, um die Schreckenskunde zu verbreiten, begleitet von dem dringenden Rat, an keinen Widerstand zu denken, der nur um so größeres Unheil im Gefolge haben würde.
Gleich darauf befand der Wirt sich wieder allein mit seinem Gast. Einen Aufwärter rief er herbei, ihn beauftragend, ein gutes Mahl herzurichten, woran er die Bemerkung schloss: »Zuvor aber gehen Sie zu Miss Rutherfield herum.«
»Miss Lydia Rutherfield?«, fragte der junge Reitersmann lebhaft, indem er, ihn unterbrechend, die Hand auf seinen Arm legte, »ist das die Tochter des Besitzers der Fabriken hier nebenan?«
»Sie sprechen es aus, Freund«, bestätigte der Wirt, »ein braves, freundliches Mädchen und meine Nachbarin obenein. Da ist es freilich meine Pflicht, an ihre Sicherheit zu denken. Leider ist der Vater nicht daheim, was um so mehr zu beklagen ist, weil sie die Mutter schon vor Jahren verlor. Im Feld steht er, wo er ein Regiment kommandiert. Eine Schande ist es, dass die arme junge Lady jetzt auf sich allein angewiesen ist; denn eine Verwandte von ihr – die Hölle über sie – die ihr solange zur Seite stand, machte sich aus dem Staub, sobald die ersten unheimlichen Gerüchte über einen möglichen Besuch des Raubgesindels ihr zu Ohren drangen. Als guter Nachbar riet ich Miss Lydia, in St. Louis Zuflucht zu suchen, allein sie ist eine beherzte Natur und bestand darauf, hier nach dem Rechten zu sehen. Sie meinte, in St. Louis sei es nicht besser als hier, und der Weg dahin führe mitten zwischen den streitenden Armeen hindurch, und so ist es mit dem Zaudern allmählich zu spät zur Flucht geworden.«
»Ich will selber zu ihr gehen«, fiel der Vaquero gelassen ein, »weiß ich doch am besten zu schildern, was ich mit meinen Augen sah, und ausrichten werde ich es, ohne sie viel zu erschrecken.«
»Recht so, Freund«, billigte der Wirt in fieberhafter Unruhe, »besorgen Sie das Geschäft mit einigem Bedacht, ist es doppelt dankenswert. Kehren Sie zurück, so finden Sie Ihr Mahl bereit.«
»Sie wohnt in dem Haus zwischen den beiden Fabrikgebäuden?«
»Gerade da; Sie brauchen nur anzuklopfen. Zu Hause ist sie um diese Zeit ebenfalls, seitdem sie es aufgab, ihren gewöhnlichen Nachmittagsritt zu unternehmen, und wie wir anderen, jagte auch sie ihre Pferde in den Wald.«
Schweigend verließ der Vaquero die Schänke und etwas später klopfte er an die Tür des bezeichneten Hauses.
Ein hünenhaft gebauter Negrid öffnete, und obwohl von Misstrauen gegen die fremdartige Erscheinung des jungen Mannes beschlichen, führte er ihn doch, ohne ihn zuvor anzumelden, in ein freundlich, sogar verhältnismäßig reich ausgestattetes Empfangszimmer, wo er ihn anwies, einige Minuten zu warten.
Der Vaquero benutzte die Zeit, sich ein wenig umzusehen. Schwerlich hatte er in seinem Leben oft Räume betreten, deren Einrichtung mit seiner jetzigen Umgebung zu vergleichen gewesen wäre. Um so überraschender erschien es daher, dass seine Blicke kalt über alles hinwegglitten, was jeden anderen aus seinem Kreis vielleicht mit Bewunderung erfüllt hätte. Was ihm vor Augen lag, mochte er mit der freien Natur vergleichen, auf welche der weitaus größte Teil seines Lebens entfiel, dass es zuweilen wie Spott auf seine Züge trat, er sogar erschrak, als er sich plötzlich vom Kopf bis zu den Füßen hinunter in einem Spiegel sah. Unwillkürlich betrachtete er sein Ebenbild aufmerksam. Zugleich gelangte auf seinem Antlitz mehr und mehr ein Ausdruck der Trauer zum Durchbruch. Es war, als hätten die Merkmale, welche nicht allein in dem verschlissenen und bestaubten Anzug, sondern auch in seinen sonnverbrannten Zügen von endlosen Entbehrungen und Beschwerden zeugten, tiefes Bedauern mit sich selbst wachgerufen.
In seinen Gedanken störte ihn das Gehen einer Tür. Schnell kehrte er sich nach dem Geräusch um, und auf ihn zu schritt eine hoch und schlank gewachsene junge Dame im einfachen Hauskleid, ihn mit einem Befremden verratenden, beinahe befangenen Lächeln grüßend. Anfänglich rief es den Eindruck hervor, als habe die anmutige Gestalt mit dem von Kastanien braunem Haar eingefassten lieblichen Antlitz und den herzigen blauen Augen ihn geblendet; denn erst, als dieselbe ihn anredete, schien er wie aus einem traumähnlichen Zustand zu erwachen.
»Der schwarze Nestor meldete mir, Sie wünschten mich in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen«, begann Lydia Rutherfield, des jugendlichen Vaqueros Schweigen als Zaghaftigkeit auslegend. Indem aber ihre ermutigende Stimme zu seinen Ohren drang, kehrte seine Selbstbeherrschung zurück. Es schwand die erste Verlegenheit. In den Vordergrund trat wieder jene kalt erwägende Ruhe, wie eine solche sich in seinen Zügen spiegelte.
»An Stelle Ihres Nachbars, des Schankwirtes, ging ich hierher, um Sie zu warnen«, hob er ohne weitere Einleitung an. »Spätestens nach Ablauf einer Stunde zieht eine starke Guerrillaschar in diesen Ort ein. Was das bedeutet, kann nur derjenige ermessen, der Gelegenheit fand, solche Banden auf ihren Raubzügen zu beobachten.«
Lydia erbleichte. Wie um die Wahrheit der Schreckenskunde aus seinen Augen herauszulesen, sah sie starr in des bräunlichen Burschen unbewegliches Antlitz.
»Wenn die Unholde unsere Ansiedlung wirklich überfallen. Was bliebe uns zu tun übrig?«, fragte sie nach einer kurzen Pause des Schweigens mit heimlichem Zagen.
»Es bietet sich keine große Auswahl«, antwortete der Vaquero frei von jeder Spur irgendeiner Erregung. »Fliehen müssen Sie oder Sie haben das Schrecklichste zu gewärtigen. Wenn man den übrigen Bewohnern der Ansiedlung Schonung angedeihen ließe, so hätte die Tochter des tapferen Colonels Rutherfield auf eine solche nicht zu rechnen.«
»Was wissen Sie von meinem Vater?«, fragte Lydia, in ihrer Angst um ihn die eigene Lage vergessend. »Lebt er noch? Ist er gesund? Seit Wochen hörte ich nichts von ihm. Kein Tag vergeht, an welchem ich nicht eine schreckliche Nachricht fürchte.«
»Vor einer Woche befand er sich wohlauf und auf dem Marsch nach Kansas City. Seitdem ist es nicht zu ernsten Zusammenstößen mit den Rebellen gekommen. Jetzt, da es zu spät ist, bereut er, nicht schon vor Jahresfrist Sie von hier fortgebracht zu haben.«
»Ihn trifft kein Verschulden«, versetzte Lydia anmutig, »denn wer konnte ahnen, dass die furchtbarste Form des Bürgerkrieges gerade in diese abgelegenen Distrikte verpflanzt werden würde.«
Der Vaquero zuckte die Achseln. »Das ist jetzt nicht mehr von Belang«, sprach er im Geschäftston. »Zunächst handelt es sich darum, ob Sie mir trauen. Ist das der Fall, so werden Sie im Verlauf der kommenden Nacht von hier abgeholt. Ich bereite Sie darauf vor, dass Sie vielleicht große Gefahren über sich ergehen lassen müssen. Nur unter dem Schutz der Dunkelheit, wohl gar über Leichen hinweg, ist Rettung noch möglich. Ich spreche rückhaltlos, um Ihren Entschluss zu fördern.«
Lydia bebte bis ins Mark hinein. Eine Weile sann sie angestrengt nach. Es mochte ihr vorschweben, dass der vor ihr stehende Bursche in dem Kleid eines verwilderten Steppenreiters möglicherweise selbst ein Mitglied der gefürchteten Guerrillabande und nur ausgeschickt sei, um sie den grausamen Feinden zu überliefern. Um Zeit zum Überlegen zu gewinnen, fragte sie mit notdürftig errungener Fassung: »Die ganze Habe meines Vaters, die Fabriken, unsere Wohnung mit allem, was dazu gehört, soll ich fremder Willkür preisgeben.«
»Ihr eigener Vater würde antworten«, unterbrach der Vaquero sie rau, »mag alles in Asche zerfallen, wenn nur meine Tochter gerettet wird. Erklären Sie daher offen: Wollen Sie flüchten und zu diesem Zweck sich meiner Führung anvertrauen, so ist es gut. Anderenfalls haben meine Freunde und ich keine Veranlassung, uns mutwillig in Gefahr zu begeben.«
Forschend sah Lydia in des Vaqueros dunkle Augen. Sie vermochte sich der Scheu nicht zu erwehren, welche er ihr durch sein entschiedenes Auftreten einflößte. Es stand in zu krassem Widerspruch mit seiner Jugend. Endlich entwand es sich, wie beschwörend, ihren Lippen. »Sie ängstigen mich. Wenn Sie mir nur den kleinsten Beweis liefern wollten, dass mein Vater mit Ihrem und Ihrer Freunde Plan einverstanden ist.«
»Nichts leichter als das«, versetzte der Vaquero gleichmütig, »zwischen Ihrem Vater und uns vermittelt ein gewisser Kampbell, wenn Sie je diesen Namen hörten. Da nun Ihr Vater aus dienstlichen Rücksichten die Angelegenheit nicht selbst in die Hand nehmen konnte, schickte er einen seiner Offiziere mit dem Auftrag an uns ab, Sie zunächst an den Missouri zu geleiten und dort weitere Verhaltungsbefehle von ihm abzuwarten. Eine Stunde Wegs von hier im sicheren Versteck weilt der Captain bei meinen Freunden. Wir alle sind bereit, unser Leben für Ihre Befreiung aus der gefährlichen Lage einzusetzen. Ich denke, das genügt, um Ihren Entschluss zu zeitigen. Und so frage ich Sie nochmals: Wollen Sie Ihre nächste Zukunft in unsere Hände legen?«
»Besäßen Sie nur ein einziges Wort, niedergeschrieben von der Hand meines Vaters«, hob Lydia zweifelnd an, als der Vaquero ungeduldig einfiel.
»Nicht nur ein Wort, sondern ein ganzer Brief ist für Sie da. Gern hätte ich ihn gebracht, allein Captain Durlach erklärte, denselben persönlich aushändigen zu müssen.«
Lydia schwankte noch immer. Mochte der vor ihr Stehende mit seiner mannhaft überlegenden Ruhe immerhin einen günstigen Eindruck auf sie ausüben, so widerstrebte es ihr dennoch, sich einem halben Knaben anzuvertrauen, der, nach seinem Äußeren zu schließen, in Verhältnissen herangereift war, in welchen die überzeugende Gewalt von Pistole und Messer höher anerkannt wurde als die weisesten Erörterungen; Treue und Glauben dagegen nach ihrer Meinung nicht über die Gegenwart hinausreichten. Wie ein schwarzes Verhängnis schwebte ihr vor, das Opfer schnöden Verrats zu werden, und so antwortete sie unter dem Einfluss verheimlichter Todesangst zögernd: »Wir sahen einander nie bevor, und sowohl meinem Vater als auch mir selber bin ich es schuldig – dies Bekenntnis kann Sie nicht beleidigen – jedem Fremden gegenüber Vorsicht walten zu lassen. Und dann, ich erkläre es offen, können Ihre Erfahrungen doch nur Ihrem Alter entsprechen.«
Ein Ausdruck des Spottes eilte über das Gesicht des Vaqueros, Lydia in erhöhtem Grad beängstigend.
»Mit anderen Worten: ich bin Ihnen zu jung«, erwiderte er leidenschaftslos, »und meine älteren Gefährten rechnen Sie für nichts. Freilich, womit könnte ich beweisen, dass ich überhaupt Gefährten besitze? Es bliebe mir also nur übrig, meines Weges zu ziehen und Sie Ihrem Schicksal zu überlassen. Doch das darf nicht geschehen. Die Tochter des Colonels Rutherfield darf nicht wie ein totes Beutestück von den Banditen fortgeschleppt werden – das sind des bekannten Spions Kampbell eigene Worte – und wäre ich gezwungen, zum letzten Mittel zu greifen.« Er trat Lydia einen Schritt näher. Wie die Anwesenheit eines Zeugen fürchtend, warf er einen scheuen Blick um sich, dann neigte er sich dem beklommen drein schauenden Mädchen zu. Eigentümlich durch dringend sah er in die bangen Augen. Nur wenige Worte sprach er mit gedämpfter Stimme, und wieder zurück tretend, beobachtete er gespannt die anmutige Gestalt.
Lydia stand wie erstarrt. Was der trotzige junge Vaquero ihr anvertraut hatte, sie schien es nicht fassen zu können. Unsägliches Erstaunen beherrschte ihre Züge, zugleich aber erwachendes Verständnis, und unter solchen Eindrücken sprach sie nach kurzem Sinnen förmlich überstürzt: »Unmöglich! Und dennoch – ich hätte es erraten müssen.« Sie reichte dem plötzlich seltsam milde schauenden und leicht errötenden Vaquero die Hand, indem sie fortfuhr: »Ich glaube Ihnen, ja, alles glaube ich. Sagen Sie, wie ich mich zu verhalten habe; Ihren Anweisungen folge ich blindlings. Ich kenne keine Zweifel mehr.«
»Das kommt Ihnen selbst am meisten zugute«, erklärte der Vaquero nunmehr minder streng. »Sie werden gerettet werden. Wie alles zu beginnen, ich weiß es noch nicht. Halten Sie sich bereit, dem ersten Ruf Ihrer und Ihres Vaters Freunde zu jeder Stunde zu folgen. Suchen Sie ein Versteck, in welchem Sie von den Spürhunden nicht entdeckt werden können, oder alle Mühe ist vergeblich. Stählen Sie Ihren Mut, um in verhängnisvoller Lage nicht von Grauen bemeistert zu werden. Führt die Flucht uns auf blutigen Wegen, so denken Sie, es sei schädliches Gewürm, welches von den Füßen ehrenwerter Menschen zertreten wurde.«
Immer größeres Erstaunen prägte sich in Lydias Augen aus. Einen gleichsam bannenden Zauber schien der junge Vaquero auf sie auszuüben. Bei seinem ersten Anblick vom Bewusstsein getragen, ihn gewissermaßen geistig zu beherrschen, fühlte sie sich jetzt abhängig von ihm, und so antwortete sie gefasst: »Das sind entmutigende Aussichten, aber bauen Sie auf meinen ernsten Willen. An Ihrem Beispiel werde ich mich aufrichten. Durch mich, wenn es überhaupt meine Kräfte nicht übersteigt, soll Ihre Aufgabe nicht scheitern.«
»Das ist verständig gesprochen«, hieß es mit unzweideutigem Wohlwollen zurück, »und so wiederhole ich nochmals meine Warnung: Halten Sie sich streng verborgen, gleichviel wie oder wo. Lassen Sie sich durch nichts beirren oder hervorlocken, durch keinen Ruf, kein Signal, und ginge es von Ihren Nachbarn aus. Vergegenwärtigen Sie sich, dass es Bluthunde in vollem Sinn des Wortes, die nach Ihnen forschen. Sind wir erst zur Hand, so wissen wir auch Sie zu finden.«
»Aber die übrigen Bewohner der Ansiedlung – sie können sich unmöglich der Aufmerksamkeit der schrecklichen Menschen entziehen«, wendete Lydia wieder klagend ein.
Der Vaquero warf den Kopf gering schätzig empor, dass das lange Schläfenhaar über die Schultern zurückflog, und bemerkte etwas lebhafter: »Keiner von ihnen ist die Tochter des als reich bekannten Fabrik- und Landbesitzers Rutherfield, der ein hohes Lösegeld zu zahlen vermag. Keiner die Tochter des tapferem Colonels, der mit seinem Regiment den Südlichen so manche Niederlage bereiten half. Um sich an ihm zu rächen, könnte den Schurken kein willkommeneres Mittel geboten werden, als Ihre Person. Doch auch ohne das schweben Sie in einer furchtbaren Gefahr: Bedenken Sie die wilden Leidenschaften von Männern, die sich durch nichts von Bestien unterscheiden. Jetzt noch eine Hauptfrage: Befindet sich unter Ihren Leuten jemand, dem wir trauen dürfen?«
»Ich verfüge überhaupt nur noch über zwei Menschen. Alle anderen gingen davon, sobald die Fabriken zum Stillstand gelangten. Sie sahen den Schwarzen. Früher Sklave, ist er durch meinen Vater schon vor zwei Jahren ein freier Mann geworden. Ihn fesselt die Anhänglichkeit an uns fester, als es durch Sklavenketten möglich wäre. Außer ihm weilt eine ältere Mulattin bei mir, eine treue Seele, von der ich mich nicht trennen möchte.«
»Gut, Miss Rutherfield«, nahm der junge Vaquero mit einem gewissen Ausdruck der Überlegenheit wieder das Wort, »so erübrigt mir nur noch, mit dem Schwarzen mich ins Einvernehmen zu setzen.«
Lydia klingelte. Als der Schwarze eintrat, wandte sie sich ihm mit den Worten zu: »Nestor, hier ist jemand, der uns vor einem großen Unglück bewahren möchte. Dazu bedarf er deiner Mitwirkung. Höre auf ihn und befolge seine Ratschläge pünktlich. Vergiss nicht: Unser aller Leben und Freiheit hängt von deiner und Evas Gewissenhaftigkeit und Treue ab.«
Das Unbehagen, welches sich anfänglich in Nestors schwarzen Zügen spiegelte, erhielt plötzlich den Charakter in ihm gährender Wut. Seine großen Augäpfel rollten wild in ihren Höhlen, indem sie sich abwechselnd auf Lydia und den Vaquero richteten. Hörbar knirschten seine Zähne aufeinander, und die mächtige Brust durch einen tiefen Atemzug erweiternd, erklärte er feindselig: »Es schwebt Unheil in der Luft. Ich hörte davon. Eine Bande erstaunlicher Schurken, gut genug, dreimal des Tages aufgeknüpft zu werden, ist hierher unterwegs. Aber wir sind noch da …« Dröhnend schlug er mit der Faust auf seine Brust.
»Gut, gut«, fiel der Vaquero herrisch ein, »meine Zeit ist kurz bemessen, zu kurz für überflüssige Erörterungen. Auch ist dieser Ort nicht dazu geeignet.« Er wies mit dem rückwärts gebogenen Daumen auf Lydia. »Begleite mich hinaus, und bist du tatsächlich ein so ehrenwerter Mann, wie deine Herrin behauptet, so wirst du deinen ganzen Scharfsinn aufbieten, mich und meine Freunde in unserem Unternehmen zu unterstützen.«
Sich verabschiedend, reichte er Lydia die Hand, und von dem Afrikaner gefolgt, trat er auf den Flurgang hinaus, wo er sich bald in ein lebhaftes Gespräch mit ihm vertiefte. Als er eine Viertelstunde später durch den Vorgarten der Straße zuschritt, stand Lydia am Fenster. Sorgenvoll spähte sie ihm nach, wie er, beide Hände in die Taschen seiner Beinkleider geschoben, sich wie jemand einher bewegte, der nichts Besseres zu tun weiß, als seine Zeit mit planlosem Umherstreifen zu verbringen.
Außerhalb des Stacketenzauns erwarteten ihn mehrere Männer und Frauen. In deren Wesen offenbarte sich ängstliche Hast. Lydia erriet, dass sie den wortkargen Burschen um dieses und jenes befragten. Seine Erklärungen waren kurz. Gen Süden wies er mit dem ausgestreckten Arm. Die Ratschläge aber, mit welchen er diese Bewegung begleitete, mussten erschreckend wirken; denn er hatte kaum ausgesprochen, als die Leute sich eiligst entfernten, die ihnen Begegnenden durch dringende Zurufe mit sich fortreißend. Jeder trachtete sichtbar, den häuslichen Herd baldigst zu erreichen, sich mit seinen Angehörigen zu vereinigen.
Als der Vaquero die Schänke wieder betrat, fand er sein Mahl angerichtet. Schweigend ließ er sich zu demselben nieder. Mehrere Gäste waren, von Unruhe getrieben, schon vor ihm eingetroffen. Er achtete ihrer nicht. Mäßig sprach er den Speisen zu. Nur wenn der eine oder der andere eine Frage an ihn richtete, sah er, um eine kurze Antwort zu erteilen, flüchtig vom Teller auf. Er hatte die Empfindung, als ob hier und da Misstrauen gegen ihn rege geworden wäre, man immer wieder seine jugendliche Erscheinung mit den von ihm überbrachten Nachrichten vergleiche. Nach beendigtem Mahl warf er einen halben Dollar auf den Tisch und sich erhebend, schritt er zwischen den ihn argwöhnisch betrachtenden Männern auf die Straße hinaus.
Er war eben mit dem Aufzäumen seines Pferdes beschäftigt, als das Heulen der Dampfpfeife herüberdrang, mit welchem ein kurz zuvor eingetroffener Eisenbahnzug etwaige Reisende zur Eile trieb. Bald darauf folgte das Fauchen der Maschine und das sich schnell verstärkende Rollen der Räder. Eine kurze Strecke konnte der Zug erst zurückgelegt haben, als aus derselben Richtung mehrere Schüsse herüberdröhnten. Fast gleichzeitig ließ sich heftiges Poltern und Krachen vernehmen. Das Geräusch der Wagen verstummte. An dessen Stelle aber trat durch dringendes Gellen und Brüllen, als ob eine Horde wilder Steppenindianer einen Überfall des Ortes ins Werk gesetzt habe.
Die Gäste stürmten ins Freie hinaus, wo sie in kopfloser Flucht auseinanderstoben. Spöttisch blickte der junge Vaquero ihnen nach. Dann schwang er sich nachlässig in den Sattel. Im Begriff, davonzureiten, wurde er des Wirtes ansichtig, der wieder auf der Türschwelle stand. Sein leichenfahles Gesicht zeugte von der Angst, in welcher er um die seinen und seine Habe schwebte.
»Beherzigen Sie meinen Rat: Öffnen Sie den neuen Gästen Küche und Keller, wenn Sie nicht das schwerste Verhängnis auf Ihr Haus herabbeschwören wollen«, rief er ihm zu. Sein Pferd wendend schlug er in mäßig forderndem Schritt die Richtung ein, aus welcher der bedrohliche Lärm herübergedrungen war und sich fortgesetzt wiederholte.
Schreibe einen Kommentar