Der Schwur – Zweiter Teil – Kapitel 6
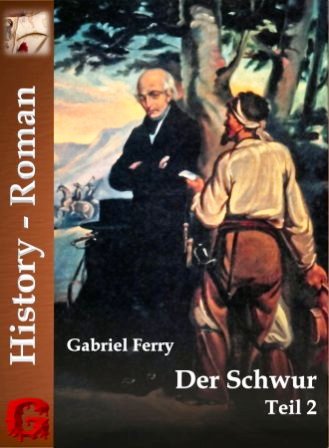 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Zweiter Teil
Ein moderner Odysseus
Kapitel 6
Erfüllung einer Prophezeiung
Der Eifer, mit dem der Indianer den geheimnisvollen Mann verfolgte, schien die Vermutungen, welche die Insurgenten über die rätselhafte Persönlichkeit desselben aufgestellt hatten, zu rechtfertigen.
»Habt Ihr ihn von Nahem gesehen?«, fragte man von allen Seiten diejenigen, welche Galeana begleitet hatten.
»Seine Kapuze fiel ihm einen Augenblick auf die Schultern zurück«, sagte ein Soldat. »Er riss sie aber so abrupt wieder in die Höhe, dass man kaum seine Züge unterscheiden konnte.«
»Was für ein Gesicht hat er?«
»Ein Angesicht wie jedermann.«
»Hat Costal, der ihn doch so hartnäckig verfolgt, nicht gesagt, für wen er ihn hält?«, fragte ein anderer Streiter.
»Nein, aber seine Augen glänzten vor Freude, sodass ich glaube, es ist ein Adliger aus königlicher Blutsbande.«
»Dieser Costal wird ein schönes Lösegeld erhalten«, fügte ein anderer hinzu.
Unter allen teilten nur zwei, Galeana und der Hauptmann Lantejas, das allgemeine Interesse nicht. Ersterer unterbrach die Privatgespräche, indem er Order zur Rückkehr zu der Insel gab. Der Zweite beschäftigte sich ausschließlich mit der Gefahr, die der Indianer an der Küste, wo die Königlichen noch Machthaber waren, laufen konnte, und dachte wenig daran, sich zu erkundigen, wer der Mann im Matrosenmantel sein könnte. Die Augen starr auf das Ufer gerichtet, folgte er den Bewegungen eines dritten Schattens, der noch schwärzer war, als die beiden ersten.
»Wenn Clara nicht tot und nicht verwundet war, so war er es. Kann mir einer Mitteilung über Clara geben?«, rief der Hauptmann. »Ist er tot?«
»Nicht einmal verwundet«, erwiderte man einstimmig. »Er war in diesem Moment noch hier.«
Es war wirklich der Farbige, der mit der stummen und grenzenlosen Ergebenheit eines Hundes gegen seinen Souverän, ohne ein Wort zu sprechen, sich ins Meer gestürzt hatte, um dem Kerl zu folgen, den er sich zum Waffenbruder erkoren hatte. Für Don Cornelio war das Beispiel des Schwarzen ein Fingerzeig, welches Verfahren er einzuschlagen habe.
Er wandte sich an Galeana und sprach: »Es würde mir unmöglich sein, die ganze Nacht in Ungewissheit über Costals Schicksal zu schweben. Wenn Ihr es für angemessen erachtet, werde ich mir zwei Personen mitnehmen, in jene leere Barke steigen und das jenseitige Ufer gewinnen. Vielleicht harrt der arme Teufel auf meine Ankunft, wie ich vor drei Nächten auf die seine.«
Galeana hatte in seiner angeborenen Gutmütigkeit nichts einzuwenden und erteilte Don Cornelio die nachgesuchte Erlaubnis.
»Seid vorsichtig, Lantejas«, sagte er mit sichtbarem Wohlwollen, »und verlasst womöglich Euren Kahn nicht, wenn Ihr an Land seid, denn ich glaube einige Marodeure bemerkt zu haben, die das flache Land und die Felsen unsicher machen.«
»Ich werde vorsichtig sein, seid sorglos, Señor Galeana«, erwiderte Don Cornelio.
Mit diesen Worten sprang er mit zwei Ruderern in die Barke und ließ zum jenseitigen Ufer paddeln. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass schon seit langer Zeit der Kerl im Mantel, der Indianer und der Schwarze im Schatten der Nacht verschwunden waren. Die Küste war leer und schweigend, als das Kanu Lantejas’ dort landete, was in einer kleinen, auf beiden Seiten mit ziemlich hohen Felsen umschlossenen Bucht stattfand, an demselben Ort, wo Costal den Fuß auf das Land gesetzt hatte.
Don Cornelio lauschte aufmerksam, ohne dass der geringste Laut zu ihm gedrungen wäre, dann rief er den Namen des Indianers mit dem ganzen Aufwand seiner Lungen, in der Voraussetzung, dass er nicht weit entfernt sein könne.
Niemand beantwortete seinen Ruf.
So vergingen zwei Stunden mit vergeblichem Warten, während welcher er jeden Moment hoffte, Costal von seiner Verfolgung zurückkehren zu sehen. Voller Unruhe über das Schicksal des Indianers beschloss er, Ermittlungen anzustellen.
Er steckte zwei Pistolen in den Gurt, nahm sein Rapier in die Hand und sprang auf das Ufer, indem er den beiden Ruderern empfahl, sich ungefähr zehn Schritte vom Ufer entfernt zu halten und auf alles, was vorgehe, genau achtzuhaben.
Die beiden Insurgenten versprachen es und der Soldat entfernte sich vorsichtig.
Der Mond war noch nicht aufgegangen, aber unzählige Sterne funkelten am Himmelszelt, deren Brillanz keineswegs der Nacht ihre Dunkelheit nahm und Don Cornelio gestatteten, seine Gegenwart zu verbergen. Dennoch gelang es ihm, die Fußspuren derer, die er suchte, in dem lockeren Sand aufzufinden, die sich aber verloren, sobald der Boden fester wurde. Dann horchte er aufmerksam, ohne aber auch nur den geringsten Laut vernehmen zu können. Alles war mucksmäuschenstill um ihn, Todesschweigen, mit Ausnahme des dumpfen Geräuschs, mit dem sich die Wellen am Ufer brachen.
Bevor Lantejas in einen engen Hohlweg, durch welchen seiner Annahme nach der Flüchtling es hätte am ehesten versuchen können, zu entkommen, hinabstieg, warf er noch einen Blick auf den Kahn. Die beiden Wächter lagen sorglos auf ihrer Bank, die Zigarre im Mund, und ließen sich vom Wind wie in einer Hängematte hin- und herschaukeln.
Nachdem sich Lantejas überzeugt hatte, dass hier keine Gefahr drohe, drang er in den Hohlweg, den die weißen Gestade zwischen sich ließen.
Genau denselben Weg hatte auch Costal bei der Verfolgung des rätselhaften Mannes eingeschlagen. Dieser war mit so staunenswerter Geschwindigkeit geflohen, dass es dem Schwarzen sicher nicht gelungen wäre, den Indianer, der aus Leibeskräften hinter ihm herjagte, wahrzunehmen, hätte er nicht mehrmals den Ruf vernommen.
»Bei der Seele der Kaziken von Tehuantepec, stehe, Feigling! Bin ich nicht allein, wie du?«
Diese Rufe hatten Clara auf die Fährte des Indianers gebracht. Noch immer dauerte der Lauf in ungeschlachter Kraft fort, obgleich sich ihre Brust schon keuchend hob, als plötzlich Costal stehen blieb.
Der Mann im Mantel war hinter einer Biegung des Weges verschwunden. Während der Zeit, in welcher der Indianer vergebens zu erraten suchte, wohin er sich wohl gewandt haben könnte, holte Clara ihn ein.
»Bei den Hörnern des Teufels!«, rief Costal. »Ihr kommt wie gerufen, um mir die Spur, die ich hier verloren habe, wieder aufsuchen zu helfen. Schnell, durchsucht mit mir jedes Gebüsch. Ihr glaubt nicht, welchen ungeheuren Wert ich darauf lege, diesen Menschen in unsere Gewalt zu bringen.«
»Kennt er ein Rätsel über ein Goldlager oder eine Perlenbank?«, fragte Clara.
»Nein, nein! Beim Weltenlenker! Kommt … es ist … halt! Da ist er … da … auf dem Rand des Hohlwegs.«
Dieses Mal setzten sich der Schwarze und der Indianer zur Verfolgung des Ausreißers in Bewegung. Sie verließen den Trampelpfad, und bald befanden sich alle drei auf der offenen Fläche, die sich vor ihnen ausdehnte.
***
Während der Hauptmann Lantejas mit aller Vorsicht, die ihm Galeana anempfohlen hatte, weiterschritt, und zwar mit einer Bedächtigkeit, die ihn diejenigen, welche er suchte, so bald nicht antreffen lassen, waren seine beiden Ruderer weit davon entfernt, den Befehl auszuführen, den er ihnen gegeben hatte.
Der Schlummer übermannte einen, dann den anderen, denn beide waren die vorhergehende ganze Nacht auf den Beinen gewesen.
»Wenn wir abwechselnd ein wenig schliefen?«, sagte der Erste.
»Ich sollte meinen, wir könnten beide zu gleicher Zeit schlafen«, sagte der Zweite. »Ich sehe überhaupt gar nicht ein, was für eine Bedrohung wir zu fürchten haben bei unserer Entfernung vom Land, und der Hauptmann kann uns bei seinem Wiederauftauchen wecken.«
Anstatt auf ihrer Hut zu sein, wie es ihnen Lantejas eingeschärft hatte, schliefen beide fast zu gleicher Zeit fest ein. Ihr zur Unzeit angebrachter Schlaf war der Auslöser, dass keiner von ihnen zwei Individuen bemerkte, die mit Vorsicht längs der Felsen heranschlichen.
Diese beiden Kerle trugen keine Uniform, waren mit Flinten bewaffnet. Einige Leichen, die das Meer anspülte, zeigten den Zweck ihrer Gegenwart an. Es waren nämlich Marodeure, die der Armee folgten und denen jede Beute recht ist, die die Lebenden berauben und die Toten ausplündern. Sie gehörten zur königlichen Armee, wagten es aber nicht, zur Festung zurückzukehren, aus der sie wie die Wölfe bei einer Treibjagd aus ihrem schützenden Versteck verjagt waren, fürchteten auch, in die Hände der Insurgenten zu fallen. Die Ansicht eines Kanus war ihnen daher ein gewaltiges Reizmittel.
Die beiden Ruderer schliefen während der Zeit ruhig fort, der eine an Backbord, der andere an Steuerbord.
Die beiden Landstreicher durchzuckte der gleiche Gedanke: sich des so schlecht bewachten Bootes zu bemächtigen und aus den beiden Lebenden zwei Tote zu machen.
Zu gleicher Zeit erhoben sie ihre Gewehre, und nachdem sie ihr Ziel mit der größten Muße aufs Korn genommen hatten, gaben sie in demselben Augenblick Feuer. Der Doppelknall erweckte die Schläfer nicht, sie schlummerten den Todesschlaf.
Der Hauptmann Lantejas war der Einzige, der die Schüsse vernahm. Seit länger als einer Stunde durchlief er, sich ganz dem Los überlassend, in Gegenden, die er nicht kannte, indem er sich selbst die Frage vorlegte, welchen Vorteil wohl seine so hartnäckig fortgesetzte Nachforschung für den Indianer und den Schwarzen haben könnte. Es lag auf der Hand, dass er inmitten dieser unbekannten Pampa nichts für sie tun konnte. Deshalb beschloss er, den Rückweg anzutreten. Er verfolgte dabei genau den schon gemachten Pfad und näherte sich wieder dem Meer, als er mit einem Mal aus dieser Richtung her zwei Schüsse knallen hörte.
Im ersten Moment konnte er sich der lebhaften Befürchtung, es möchte irgendein Unheil geschehen sein, nicht enthalten. Dann aber dachte er wieder, dass Costal und Clara vielleicht zurückgekehrt seien und die beiden Schüsse abgefeuert hätten, um ihre Anwesenheit anzuzeigen und ein Boot zu veranlassen, sie zur Insel la Roqueta überzusetzen. Dann jedoch sagte er sich bei weiterem Nachdenken, dass, wenn seine Annahme richtig wäre, der Indianer und der Schwarze doch die beiden Ruderer, denen die Sorge für das Kanu oblag, hätten antreffen müssen. Diese Überlegung durchzuckte ihn wie ein Blitz, sein Gefühl gewann wieder die Oberhand bei ihm und anstatt zu gehen, rannte er und legte daher einen Weg, zu dem er vorher eine Stunde gebraucht hatte, in weniger als einer halben Stunde zurück.
Endlich erreichte er den Ausgang des Hohlwegs. Sein Auge schweifte erfolglos am Horizont umher, sein Kanu war verschwunden. Er ging näher, sah nichts als das ewig bewegliche Meer. So glaubte er erst, sich in der Strecke geirrt zu haben. Der Anblick des Hohlwegs, der sich zwischen den Felsenreihen hinzog, rief ihm vollkommen den Bereich, wo er ausgestiegen war, ins Gedächtnis zurück. Der Landungsort war derselbe, nur das Kanu war verschwunden. Als er endlich schärfer hinblickte, bemerkte er ein schwarzes Etwas, das sich in bedeutender Ferne auf der hohen See schaukelte.
Don Cornelio hoffte. Er nahm an, dass die, wenngleich auch an diesen Küsten fast unmerkliche Ebbe und Flut doch das Kanu, während die Bewacher schliefen, in die hohe See getragen haben könnte.
Zuerst rief sie der Hauptmann ziemlich leise bei ihren Namen. Als er aber keine Antwort erhielt, verstärkte er seine Stimme, allein ebenfalls vergebens. Das Kanu schwankte von einer Seite nach der andern, aber nichts zeigte an, dass man ihn vernommen habe. Er rief aus Leibeskräften. Auch dies war vergeblich, denn das Echo allein wiederholte seine Rufe.
Er lauschte und vernahm nichts, als das Schlagen der Wellen, die sich am Strand brachen und Streifen weißen Schaumes zurückließen. Das tiefe Schweigen, das ihn umgab, und die klagenden Seufzer der auf dem Strand ersterbenden Wellen erfüllte die Seele des Hauptmanns zuerst mit einer unbestimmten Angst, die aber bald auf schreckliche Weise zur Gewissheit wurde.
Es erschienen auf einmal zwei Männer im Kanu, das leer und verlassen geschienen hatte, und vier kräftige Arme setzten die Ruder in Bewegung, aber anstatt zum Ufer zu halten, entfernten sie sich schleunigst davon.
»Schurken!«, schrie Don Cornelio, erstaunt und beunruhigt von dem unbegreiflichen Manöver, das er von den beiden Männern ausführen sah. »Ich bin es ja, der Hauptmann Lantejas!«
Ein höhnisches Gekicher erscholl als Erwiderung auf seine Worte und fast in demselben Moment sah er mit Entsetzen die sterblichen Überreste der beiden Männer, von den Wogen getragen, auf sich zu treiben, die er noch in der Ferne zu sehen glaubte, sich abmühend, die hohe See zu gewinnen.
Die beiden nächtlichen Herumschwärmer hatten einige Zeit damit zugebracht, die auf dem Ufer und im Kanu liegenden Leichname auszuplündern und kaum ihre Arbeit beendet, als der Anblick des Hauptmanns sie in Schrecken setzte. Sie legten sich beide auf den Boden des Kanus nieder, da sie nicht wussten, ob die sich nähernde Person noch irgendeine Begleitung bei sich habe. Als sie aber die Zuversicht erlangt hatten, dass er allein sei, ergriffen sie in aller Ruhe ihre Paddel, um sich zu entfernen, nicht ohne die Versuchung empfunden zu haben, zurückzukehren und auch Lantejas zu ergreifen.
Die von Galeana ausgesprochenen Befürchtungen waren also auf das Treffendste begründet, und Don Cornelio musste nun, jeder Verbindung mit der Insel beraubt, den Entschluss fassen, die Festung trotz der Marodeure zu umgehen und das Lager Morelos’ zu erreichen zu suchen. Vor zwei Tagen hatte er schon einen fast eben solchen Weg mit Costal gemacht und im Ganzen hier noch die Möglichkeit, ihm zu begegnen. Er orientierte sich, so gut es gehen wollte, um sich die Lage der Abgründe Los Hornes in Erinnerung zurückzurufen und begab sich, den Säbel in der einen und eine Pistole in der anderen Faust, wiederum, und zwar diesmal ziemlich entschlossen in den Hohlweg, aus dem er soeben herausgekommen war.
»Warum sollten übrigens der Schwarze und der Indianer nicht ein Selbiges getan haben?«, sprach er auf brechend zu sich selbst. Diese Betrachtung, die er eher hätte anstellen müssen, beruhigte ihn wenigstens über das Geschick dessen, dem er mindestens zwei Mal sein Leben verdankte, und zerstreute eine seiner traurigsten Befürchtungen. Nun schritt er zuversichtlicher weiter, wenn auch aufs Geratewohl.
Der Mond ging hell und glänzend auf und wenn auch seine Helligkeit den Hauptmann der Gefahr aussetzte, gesehen zu werden, so verschaffte es ihm doch zugleich auch die Möglichkeit, seine Feinde und die gefährlichen Stellen der Berge bemerken zu können. Er gelangte ohne Anfechtung in einem steilen Pfad auf ein Plateau, von wo aus er das Meer, die Stadt, den schwarzen Schatten der Zitadelle und auch die fernen Feuer im Lager des Generals Morelos erblickte. Jetzt konnte er auch mit Gewissheit die Lage der Brücke bestimmen, die ihm dazu dienen sollte, über den Abgrund von Hornos zu gelangen. Mit erneutem Eifer setzte er nun seinen Weg fort, der ihn zu dem Ziel führen sollte, das er so sehr ersehnte. Denn hatte er erst einmal die Brücke erreicht, so brauchte er nur noch einen ihm schon bekannten Weg zurückzulegen.
Das Plateau, auf dem er sich befand, war an einigen Stellen von weniger tiefen Einschnitten durchzogen. Auch erhoben sich einige kleine Anhöhen über demselben. Ein pfeifender Wind, der mit Heftigkeit über die Ebene strich, jagte, obgleich das Meer ruhig wie ein See war, weiße Staubwolken auf und verhinderte ihm im Verbund mit den Unebenheiten des Terrains, die Brücke und den Abgrund zu erkennen.
Don Cornelio schritt mit einiger Behutsamkeit weiter. Als er um den letzten der kleinen Hügel herumging, bemerkte er in der Entfernung beim Mondschein die Balken und das Mauerwerk, die dazu dienten, quer über den Abgrund hinweggehen zu können. Schnell kauerte er sich ins Gebüsch, denn er hatte deutlich auf der Brücke eine menschliche Gestalt sich bewegen sehen.
Höchst verdrießlich, sich in dem Moment, in dem er sich schon geborgen glaubte, ausgehalten zu sehen, versuchte der Hauptmann durch die Zweige des Gebüsches hindurch die Anzahl der Männer, die ihn an der Fortsetzung seines Wegs hinderten, zu erforschen. Es war nur ein Einziger, er schien von riesigem Wuchs. Sein Kopf war mit dem Pfahl, an dessen Spitze Costal seine Blendlaterne aufgehängt hatte, um den Artilleristen Pepe Gago zu benachrichtigen auf gleicher Höhe. Don Cornelio konnte trotz seiner kritischen Lage ein Grienen über seinen Irrtum nicht unterdrücken. Es war klar, dass die Person nur so hoch geklettert war, um die Ebene unter sich besser überschauen zu können. Endlich aber erkannte der Hauptmann mit größter Bestimmtheit und zu seinem Verblüffen den wieder, den Costal mit so großer Erbitterung und Verwegenheit verfolgt hatte, mit einem Wort: den Mann im Matrosenmantel.
Er war ohne Zweifel in sehr tiefe Betrachtungen versunken, denn seit beinahe einer halben Stunde, in der sich Don Cornelio den schwarzen Gedanken über das Schicksal Costals hingab, wartete er schon auf die Entfernung dieses geheimnisvollen Subjekts. Noch war sie nicht vom Platz gewichen. Plötzlich schlug der vom Wind aufgeblähte Mantel auseinander und der Hauptmann konnte jetzt zum ersten Mal den Mann sich bewegen sehen. Dies geschah aber in einer höchst befremdenden Art.
Don Cornelio fühlte inmitten dieses nächtlichen Schweigens, einsam auf diesen verlassenen Höhen, bei dem Anblick dieses Mannes in einer so wunderlichen Stellung sein Herz erbeben.
Endlich gaben ihm seine hilflose Lage und die Gefahr, die er lief, wenn er sein unnützes Harren noch weiter ausdehnte, einen verzweifelten Entschluss ein, seinen zerstreuten Feind zu überraschen, zu töten und dann weiter zu gehen.
Er verließ seinen Schlupfwinkel im Gebüsch und schlich ohne das geringste Geräusch vorwärts, um Feuer auf die Person zu geben, welche ihm den Steg versperrte.
Schon befand er sich dicht am Übergang. Noch hatte sich der Mann nicht gerührt.
Abrupt verfing sich ein heftiger Windstoß in seiner Kapuze und warf sie über die Schultern zurück. Der Mond beschien mit vollem Licht sein Gesicht, und jetzt erkannte Don Cornelio schaudernd die durch grässliche Verzerrungen entstellten Züge. Jetzt war er außer allem Zweifel, der Mann im Regenmantel war mit einem Strick an dem Pfahl aufgehängt.
Gleich mächtig von der Neugierde, diese sonderbare Person näher zu sehen, und dem Widerwillen, den ihm der Anblick verursachte, ergriffen, zögerte der Hauptmann weiter zu gehen. Dann – da ihm kein anderer Ausweg übrig blieb, waffnete er sich mit Wagemut und betrat die Brücke. Er betrachtete das verzerrte Gesicht des Gehängten aufmerksam. Es war ihm, als hätte er ihn schon irgendwo früher gesehen.
Schnell wollte er vorüberschreiten, als sich sein Mantel ein zweites Mal vom Wind öffnete und eine um seinen Hals gehängte Blendlaterne erkennen ließ.
Bei diesem Anblick war ihm alles klar, der Name des Mannes wie auch seines Henkers.
Entsetzt wollte Lantejas fliehen, doch hielten ihn Stimmen, die er deutlich aus der Tiefe der Abgründe herauf ertönen hörte, an seinen Platz gebannt.
Der Mond beleuchtete die beiden aller Vegetation beraubten Gipfel des Abgrundes diesseits und jenseits der Brücke so hell, dass er sie nicht hätte überschreiten können, ohne bemerkt zu werden. Seine Anwesenheit zu verheimlichen war nicht mehr möglich, aber er konnte hinter der Brustwehr und dem Mauerwerk verborgen, den Übergang über die Brücke wohl gegen zehn Mann verteidigen und unmöglich machen. Er kauerte sich daher trotz seines grausigen Nachbarn unter ihm nieder und wartete von Neuem.
Es dauerte nur eine Minute, eine entsetzliche Minute, während welcher der Leichnam des Gehängten sich über ihm hin- und her schaukelte, durch sein Gewicht den Strick krachen ließ, mit dem er am Pfahl aufgehängt war. Nicht minder harmonisch klapperte und knarrte die alte rostige Laterne, die vom Wind gegen seine Brust getrieben wurde.
Erfreulicherweise war dieser Augenblick nur kurz, denn gleich danach riefen zwei wohlbekannte Stimmen den Hauptmann beim Namen. Costal und Clara erschienen wenige Schritte vor ihm, aus dem Abgrund emporkletternd.
Nach den ersten Beglückwünschungen, die der Hauptmann an Costal richtete, den er zu seinem großen Glück voll Kraft und Leben wiederfand, sagte er: »Ihr habt also gewusst, wer die geheimnisvolle Person in der blauen Kapuze war?«
»Nein«, erwiderte Costal, »aber dieser auffallende Umstand erregte Argwohn in mir. Ich würdigte vollkommen die Vorsicht vonseiten Gagos, denn der Schuldige verbirgt seine Züge immer so viel er kann. Als ich auf einem der spanischen Kanus den so verhüllten Mann bemerkt hatte, ließ ich ihn nicht mehr aus den Augen. Ein Windstoß schlug seinen Mantel zurück und ich erkannte den Verräter. Ich habe ungeheure Anstrengungen gemacht, um ihn mir nicht entwischen zu lassen, meine Absicht ist mir gelungen. Als er sich ins Meer stürzte …«
»Ich habe Euch auch ins Meer springen sehen«, erwiderte der Hauptmann Costal unterbrechend, »und deshalb habe ich mich, über Euer Schicksal beunruhigt allein in die Berge gemacht, um Euch aufzusuchen, nachdem die beiden Männer, die ich mit mir im Kahn hatte, wo sie mich erwarteten, durch Flintenschüsse getötet worden sind.«
»Und wir«, entgegnete Costal, »wir haben Euch gesehen, während wir uns verborgen hielten, um zu verhindern, dass jemand das Opfer der indianischen Rache abnehmen könnte, und sind nun herbeigelaufen. Ich hätte wohl zu Clara gesagt, dass die alte Laterne, die ich vorgestern hier eingrub, mir noch zu etwas dienen würde.«
»Lassen wir jetzt den Unglücklichen, damit ihm seine Landsleute nach Wohlgefallen die letzte Ehre erweisen können«, sagte der Hauptmann. »Die Rache darf den Tod nicht überdauern.«
»Meinetwegen – wenn Ihr es durchaus so wollt. Im Übrigen ist meine Arbeit getan und mein Eid gelöst.«
Kurze Zeit darauf ruhte sich der Hauptmann Lantejas auf seinem Bett aus. Er schlief vierzehn Stunden lang.
Schreibe einen Kommentar