Felsenherz der Trapper – Teil 9.3
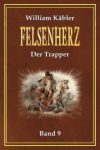 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 9
Die belagerte Hazienda
Drittes Kapitel
Nach der Hazienda Lago del Parral
Als der alte Benito durch den schmalen Eingang des Verhaus ins Freie gekrochen war und Sancho ihm alles Nötige erklärt hatte, sagte jener bedächtig: »Nein, Sancho, warten wir besser ab, was weiter geschieht. Zu Fuß zu fliehen ist eine missliche Sache! Bedenke, dass gegen vierhundert von den roten Halunken dort in der Ferne in der Prärie umherschwärmen. Vielleicht …«
Er packte da plötzlich Sanchos Arm und deutete nach links. »Siehst du dort am Bachufer im trüben Mondlicht den beweglichen dunklen Fleck? Das sind mehrere Pferde und nur zwei Reiter dabei. Das sind die beiden Retter! Amigos … jetzt gilt es! … Vorwärts … kriechen wir den Hügel hinab den beiden entgegen!«
Die Aufmerksamkeit der zurückgebliebenen Wachen war nun mehr auf die Vorgänge jenseits des Baches als auf die sechs Vaqueros und den Hügel gerichtet.
Sancho voran gelangten die Vaqueros denn auch glücklich im hohen Präriegras zwischen zwei Feuer hindurch und begannen, als sie eine flache Talmulde erreicht hatten, zu laufen.
Gerade als Felsenherz und der schwarze Panther nun im Galopp auf den Hügel zusprengten, erschienen links von ihnen die sechs, die sie hatten befreien und mit Pferden versehen wollen.
Kein unnützes Wort wurde gewechselt. Die überflüssigen vier Indianergäule ließ man laufen. Dann jagte der Trupp nach Südwest weiter.
Aber auch die Verfolger hatten den Bach bereits hinter sich und gewahrten die Flüchtlinge, als diese notgedrungen die Bodensenkung, in der sie bisher entlanggeritten waren, verlassen und eine Anhöhe passieren mussten. Das wilde Kriegsgeschrei der Apachen belehrte die acht Männer, dass sie entdeckt waren. Zu allem Unheil war ihr Vorsprung sehr gering, betrug kaum fünfhundert Meter.
»Wir müssen ihnen aus Sehweite!«, brüllte Sancho, der zurückgeblickt hatte. »Das verdammte Mondlicht konnte gerade heute getrost trüber sein! Es ist ja fast taghell!«
Felsenherz auf seinem Braunen und Chokariga auf seinem nicht minder schnellfüßigen Rappen hätten allein hinter einem Hügelrücken und einem Wald die Hazienda liegen musste.
»Ich denke daran, dass wir den gefährlichen Teil der Flucht vielleicht noch vor uns haben, Estevan!«, erklärte er ernst. »Wenn der Große Bär klug gehandelt hat, dann hat er die Hälfte seiner Krieger auf dem kürzesten Weg zur Hazienda vorausgeschickt und uns so einen Hinterhalt dicht vor dem Ziel legen lassen.«
»Ah!«, rief Estevan erschrocken, »da mögt Ihr wohl recht haben, Señor! Wenn dem so ist, werden auch Benito und Juan vielleicht …«
Er schwieg.
Der Abendwind, der aus Osten herüberwehte, hatte den Reitern den schwachen Knall zweier Schüsse zugetragen.
»Das war Sanchos Büchse!«, flüsterte Estevan erregt. »Señor, wir …«
Felsenherz war zurückgesprengt, fasste den Zügel des Rappen und jagte ohne jede Rücksicht auf den verwundeten Freund, den man schon morgens im Sattel festgebunden hatte, nach Süden zu einem ausgetrockneten Flussbett entlang.
Die drei Vaqueros folgten. Die Prärie stieg hier allmählich an. Der Graswuchs wurde dürftiger. Dafür tauchten Baumgruppen und Sträucher auf, einzelne Felspartien und weite gelbliche Kakteenfelder.
Die Abendröte verglomm immer mehr. Die Dunkelheit kam. Felsenherz war nun überzeugt, dass der Große Bär, den seine Krieger wohl sehr bald dort am fernen Bach aufgefunden und von den Fesseln befreit hatten, mit der Hauptmacht der Apachen die Hazienda längst erreicht und völlig umzingelt hatte. Er fragte daher der Vaquero Estevan, ob es hier in der Nähe nicht ein sicheres Versteck gäbe, wo man den Häuptling zunächst zurücklassen könnte.
Estevan bejahte und deutete auf einen einzelnen zerklüfteten Berg. »Dort befindet sich eine Höhle, die sich mit vielen Nebengrotten tief ins Erdinnere hineinzieht. Ihr Eingang liegt in einer Schlucht, die schwer zugänglich ist.«
Es war bereits völlig finster, als man sich dem Berge näherte. Einige Felskolosse, die am Fuß des Berges aus der Prärie herausragten, musste man umgehen, da sie von stachligem Dornengestrüpp unwuchert waren.
Estevan, der den Führer spielte, war etwa zehn Schritte voraus. Da – mit einem Mal erhob sich ringsum das gellende Kriegsgeheul der Apachen. Vor wenigen Minuten erst hatte die Mondscheibe ihre ersten milchigen Strahlen über die stille Landschaft geworfen, die nun wie mit einem Schlag von Rothäuten wimmelte.
Schüsse knallten. Der Kreis der Apachen, die hier den Flüchtlingen einen klug berechneten Hinterhalt bereitet hatten, schloss sich enger und enger.
Felsenherz erkannte, dass er nun im Interesse seines roten Bruders nur eins tun könne; sich durchschlagen und nachher dann versuchen, ihn, der wehrlos hier in die Hände der Apachen fiel, zu befreien.
Er drückte seinem Braunen die Hacken in die Weichen, sprengte gerade auf die daherstürmende Linie der Rothäute zu.
Wieder eine unregelmäßige Salve aus den miserablen Indianerflinten, die dem Pferd des Trappers galt, um es zu töten, damit sein Herr lebend den Apachen gehörte.
Die Kugeln gingen fehl. Drei ältere Krieger sprangen Felsenherz an. Der Braune stieg vorn hoch, und der Tomahawk des blonden Hünen mähte die Angreifer hin.
Noch zwei Sätze tat der Braune.
Nun ein furchtbarer Ruck. Ein Lasso war durch die Luft geschwirrt, hatte des edlen Tieres Hals umschlungen, und der Arm des Fliegenden Pfeiles, des großen schlanken Unterhäuptlings, hatte die Schlinge mit so kräftigem Ruck zugezogen, dass das Tier zitternd nach hinten einknickte.
Diesen Moment benutzte ein anderer Apache dazu, sich hinter Felsenherz auf die Kruppe des Pferdes zu schwingen und dem Trapper die Hände wie Eisenklammern um den Hals zu legen.
Doch auch diese Angreifer sollten sich verrechnet haben. Der blonde Westmann hieb dem Braunen die Hacken in die Weichen.
Das Tier schnellte vorwärts. Der Unterhäuptling, der das Ende des Lassos bereits um die Zacke eines Felsblockes gewunden hatte, brüllte vor Schmerz jäh auf. Die Schlingen des Lederriemens hatten ihm die Finger gegen den Stein gepresst, rissen ihm ganze Fetzen Haut herunter. Das Lasso glitt ab, und das halb erwürgte Tier raste das Lasso nachschleifend von dannen.
Der Rote, der hinter Felsenherz saß und ihn aus dem Sattel zu zerren versuchte, erhielt plötzlich von der nach rückwärts fahrenden rechten Faust des Trappers einen solchen Stoß ins Gesicht, dass er den Hals des weißen Feindes freigeben musste und mit eingeschlagenen Zähnen vom Pferd glitt.
Dann trennte auch schon die scharfe Messerklinge die würgenden Riemen auseinander. Keuchend holte das brave Tier Atem, raste weiter, bis nach etwa einer Viertelstunde plötzlich vor dem glücklich Entronnenen die im Mondlicht silbern schimmernde Fläche eines großen Sees auftauchte.
Es war der Lago del Parral, der Parral-See, nach dem die Hazienda Señor Alvaros ihren Namen erhalten hatte.
Felsenherz wusste durch Benitos Schilderung, dass die Gebäude der Viehfarm sich auf einer Halbinsel erhoben, die sich am Westufer in den See hinein erstreckte. Ein kurzer Blick, und er hatte sich genügend orientiert. Dort links, etwa dreihundert Meter ab, leuchteten die weiß getünchten Gebäude. Aber dort, wo die Halbinsel sich mit dem Festland vereinigte, leuchteten auch zahlreiche Feuer, an denen sich dunkle Gestalten bewegten: die Wachtfeuer der Belagerer, der Apachen!
Nicht genug damit. Die Apachen mussten auch die Boote des Haziendabesitzers in ihre Gewalt bekommen haben, denn dort vor der Halbinsel schillerten bewegliche Flammen, die nur von Feuern herrühren konnten, die die Rothäute auf einer Steinunterlage in den Booten zur Bewachung der Wasserseite der Hazienda angezündet hatten.
Noch war Felsenherz von den Wächtern der Apachen nicht bemerkt worden. Er stieg schnell ab und führte seinen Braunen zum Ufer hinab in ein Gebüsch, wo er und sein Tier vorerst geborgen waren.
Hier ließ er es wohl zehn Minuten verschnaufen. Dann schnitt er aus den Büschen Zweige ab und befestigte sie am Zaumzeug des Braunen, damit der Pferdekopf bei der beabsichtigten Schwimmtour den Eindruck eines treibenden Strauches hervorriefe.
Nun nahte die Entscheidung, nun würde es sich zeigen, ob es glückte, die Wassertreppe der Baulichkeiten an der Spitze der Halbinsel zu erreichen.
Felsenherz nahm den Braunen wieder am Zügel und geleitete ihn langsam in den sehr bald recht tief werdenden See hinein. Als das Tier zu schwimmen begann, schlang er sich die Zügel so um den linken Oberarm, dass der Braune ihn mit über Wasser hielt. In der Rechten hatte er die gespannte Doppelbüchse.
Vorsichtig drängte er durch kurze Schwimmstöße mit den Beinen sein Pferd in die gewünschte Richtung. Das kluge Tier schnaubte nicht. So ging es denn allmählich der Spitze der Halbinsel entgegen, zugleich aber auch immer näher an das eine Boot heran, in dem acht Apachen, durch den Feuerschein der vorn im Bug brennenden Scheite grell beleuchtet, etwa achtzig Meter vor der Wassertreppe langsam auf und ab ruderten. Die beiden anderen Boote waren so weit ab, dass der Trapper sie kaum zu fürchten brauchte.
Er lenkte den Braunen mehr nach links, um dem Boot auszuweichen.
Da war es einer der am Ufer stehenden Posten, der, auf das treibende Strauchwerk aufmerksam geworden, das Boot anrief.
Felsenherz packte seine Büchse fester. Es hatte keinen Zweck mehr, das Boot zu vermeiden und einen Umweg zu machen. Hier musste er sich mit Gewalt freie Bahn erkämpfen.
Die acht Apachen waren aufgestanden. Zwei ruderten. Die übrigen sechs hatten Flinten im Arm. Sie starrten misstrauisch zum schwimmenden Busch hinüber, sprachen erregt miteinander und spannten ihre einläufigen Gewehre.
Felsenherz, dieser seltene Mann, der in kurzer Zeit im Wilden Westen es zu so großer Berühmtheit gebracht hatte, vergoss ungern Menschenblut. Wo es nur irgend anging, schonte er seine Feinde. Nun durfte er es nicht. Sein eigenes Leben stand ja auf dem Spiel, dazu noch die Freiheit seines besten und einzigen Freundes, des Schwarzen Panthers.
Bisher hatte auch er sich in den grünen Zweigen mit verborgen gehalten. Nun musste er mehr Bewegungsmöglichkeit haben, tauchte aus dem schützenden Laub hervor, legte an, zielte kurz.
Zweimal drückte er ab. Zwei Schüsse dröhnten über das Wasser hin.
In dem Boot sanken zwei Apachen, durch die Stirn getroffen, halb über Bord und brachten es so sehr aus dem Gleichgewicht, dass es Wasser schöpfte und die überlebenden Rothäute nicht zum Schuss kamen. Zischend löschte das eingedrungene Wasser die lodernden Brände.
Die vier Apachen feuerten daraufhin, trafen jedoch nicht.
Felsenherz drängte den Braunen hastig noch näher an das schwankende Boot heran. Er wusste, wie stark sein Name schon allein auf die Rothäute wirkte, wie leicht sie sich verblüffen ließen.
»Hier ist Felsenherz und der Schwarze Panther!«, brüllte er. »Die Apachen mögen aus dem Boot springen oder unsere Kugeln werden sie schnell hinwegraffen!«
Mit schrillen Rufen stürzten sich drüben die sechs Krieger wirklich ins Wasser und schwammen dem nächsten Boot zu.
Felsenherz erreichte drei Minuten später die Wassertreppe.
Über ihm von der Mauer herab blitzten Schüsse auf. Sie galten dem zweiten Boot, das sich nahe herangewagt hatte.
Dann wurde die Mauerpforte geöffnet. Schnaubend und prustend arbeitete sich der Braune aus dem Wasser und fasste auf der Treppe festen Fuß.
Felsenherz und das wackere Tier verschwanden hinter der starken Balkenpforte.
Schreibe einen Kommentar