Die Trapper in Arkansas – Band 3.13
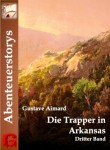 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 3
Zweiter Teil – Waktehno – der, welcher tötet
Nachschrift
Es war einige Monate nach der Expedition des Grafen Raousset Boulbon.
Zu der Zeit waren die Franzosen in Sonora hoch angesehen.
Alle Reisenden jener Nation waren, wenn sie zufällig in jenem Teil von Amerika kamen, gewiss, überall, wo sie sich aufhielten, die herzlichste und bereitwilligste Aufnahme zu finden.
Ich hatte, von meiner Sucht nach Abenteuern getrieben, Mexiko verlassen, ohne einen anderen Zweck damit zu verbinden, als mich im Land umzusehen.
Ich ritt einen vortrefflichen Mustang, den ein Waldläufer, einer meiner Freunde, mit dem Lasso gefangen und mir geschenkt hatte, und mit dem ich schon das ganze amerikanische Festland bereist hatte. Ich war nämlich in kleinen Tagereisen, meiner Gewohnheit gemäß, über eine Strecke von mehreren Hundert Meilen gekommen, hatte unterwegs Schneeberge erstiegen, ungeheure Einöden, reißende Ströme und wilde Gewässer durchschritten, um die spanischen Städte, die am Ufer des Stillen Ozeans liegen, als Tourist zu besuchen.
Ich war seit siebenundfünfzig Tagen unterwegs und reiste wie ein echter Weltenbummler, indem ich mein Zelt überall aufschlug, wo mich meine Laune dazu antrieb.
Indessen näherte ich mich dem Ziel, das ich mir gesteckt hatte. Ich war nur noch wenige Meilen von Hermosillo entfernt, jener Stadt, die, von Mauern umgeben, eine Bevölkerung von fünfzehntausend Einwohnern zählt, eine Besatzung von elfhundert Mann regelmäßiger Truppen unter dem Kommando des Generals Bravo, eines der besten und tapfersten Offiziere in Mexiko, besitzt und die der Graf Raousset an der Spitze von nicht ganz zweihundert Franzosen keck angriff und in zwei Stunden mit dem Bajonett einnahm.
Die Sonne war untergegangen und die Dunkelheit nahm mit jedem Augenblick zu. Mein armes Pferd, das von einem Marsch von fünfzehn Meilen ermüdet war, und welches ich seit einigen Tagen sehr angestrengt hatte, um eher nach Guaymas zu kommen, schritt nur noch mit Mühe weiter und stolperte bei jedem Schritt über die spitzen Steine des Weges.
Ich war selbst sehr ermüdet und starb fast vor Hunger, war daher über die Aussicht, noch eine Nacht im Freien zuzubringen, nicht besonders erfreut.
Ich fürchtete, mich in der Dunkelheit zu verirren, und spähte umsonst nach einem Licht umher, das mich zu irgendeiner Wohnung hätte führen können. Ich wusste, dass ich mehrere Haziendas – Landhäuschen – in der Nähe von Hermosillo finden würde.
Ich bin, wie alle Menschen, die lange Zeit ein unstetes Leben geführt haben und im Laufe desselben mehr oder weniger Unannehmlichkeiten erfahren haben, mit einer guten Dosis philosophischen Gleichmutes versehen. Dies ist besonders in Amerika etwas Unentbehrliches, wo man meistenteils auf seinen eigenen Scharfsinn angewiesen ist und selten auf fremden Beistand rechnen darf.
Ich fügte mich willig in das Unvermeidliche und gab mit einem Seufzer die Hoffnung auf ein Abendessen und ein Obdach auf. Da die Nacht immer finsterer wurde und es nutzlos gewesen wäre, weiterzugehen, indem ich leicht eine ganz entgegengesetzte Richtung einschlagen konnte, als ich wollte, so sah ich mich nach einer passenden Stelle um, wo ich mein Lager aufschlagen, Feuer anzünden und etwas Futter für mein Tier suchen könnte, das gleich mir ganz verhungert war.
Das war auf dem sonnenverbrannten und mit staubartigen, feinen Sand bedeckten Boden nicht leicht. Endlich, nach langem Suchen, fand ich einen verkümmerten Baum, an dessen Fuß eine dürftige Vegetation wuchs.
Ich fürchtete, mich in der Dunkelheit zu verirren, und spähte umsonst nach einem Licht umher, das mich zu irgendeiner Wohnung hätte führen können. Ich wusste, dass ich mehrere Haziendas – Landhäuschen -in der Nähe von Hermosillo finden würde.
Ich bin, wie alle Menschen, die lange Zeit ein unstetes Leben geführt haben und im Laufe desselben mehr oder weniger Unannehmlichkeiten erfahren haben, mit einer guten Dosis philosophischen Gleichmutes versehen. Dies ist besonders in Amerika etwas Unentbehrliches, wo man meistenteils auf seinen eigenen Scharfsinn angewiesen ist und selten auf fremden Beistand rechnen darf.
Ich fügte mich willig in das Unvermeidliche und gab mit einem Seufzer die Hoffnung auf ein Abendessen und ein Obdach auf. Da die Nacht immer finsterer wurde und es nutzlos gewesen wäre, weiterzugehen, indem ich leicht eine ganz entgegengesetzte Richtung einschlagen konnte, als ich wollte, so sah ich mich nach einer passenden Stelle um, wo ich mein Lager aufschlagen, Feuer anzünden und etwas Futter für mein Tier suchen könnte, das gleich mir ganz verhungert war.
Das war auf dem sonnenverbrannten und mit staubartigem, feinem Sand bedeckten Boden nicht leicht. Endlich, nach langem Suchen, fand ich einen verkümmerten Baum, an dessen Fuß eine dürftige Vegetation wuchs.
Gerade wollte ich vom Pferd steigen, als der entfernte Tritt eines Pferdes, welches denselben Weg wie ich zu verfolgen schien und schnell näher kam, an mein Ohr traf.
Ich blieb unbeweglich stehen.
Die Begegnung eines Reiters des Nachts in der mexikanischen Wildnis ist immer eine bedenkliche Sache. Der Fremde, dem man da begegnet, kann zwar auch ein ehrlicher Mann sein, doch ist hundert gegen eins zu wetten, dass es ein Schurke ist.
In der Ungewissheit lud ich meine Revolver und wartete.
Ich brauchte nicht lange zu warten.
Nach dem Verlauf von fünf Minuten hatte mich der Reiter eingeholt. »Buenas noches, Caballero. Guten Abend, mein Herr«, sagte er im Vorüberreiten.
Der mir so offen gebotene Gruß klang so ehrlich, dass meine Zweifel sogleich verschwunden waren.
Ich antwortete ihm.
»Wohin gehen Sie so spät«, fragte er mich.
»Das würde ich, meiner Treu, selbst gern wissen«, antwortete ich treuherzig, »ich glaube, ich habe mich verirrt. In der Ungewissheit habe ich beschlossen, die Nacht unter jenem Baum zuzubringen.«
»Das ist ein schlechtes Obdach«, sagte der Reiter kopfschüttelnd.«
»Ja«, sagte ich philosophisch, »aber in Ermangelung eines Besseren werde ich mich mit demselben begnügen. Ich komme um vor Hunger, mein Pferd ist halb tot vor Müdigkeit und wir haben beide keine Lust, länger umherzuirren, um eine zweifelhafte Gastfreundschaft anzusprechen, besonders zu dieser Stunde der Nacht.«
»Hm!«, sagte der Unbekannte und warf einen Blick auf meinen Mustang, der mit gesenktem Kopf einige Grashälmchen zu erwischen suchte. »Ihr Pferd scheint von guter Rasse zu sein, ist es denn so müde, dass es nicht imstande wäre, ein paar Meilen höchstens noch zu laufen?«
»Es wird, nötigenfalls, noch zwei Stunden laufen«, antwortete ich lächelnd.
»So folgt mir denn in Gottes Namen«, fuhr der Unbekannte in scherzhaftem Ton fort. »Ich verspreche Euch beiden ein gutes Obdach und ein gutes Abendbrot.«
»Das nehme ich mit Dank an«, sagte ich und gab meinem Pferd die Sporen.
Das edle Thier, welches zu verstehen schien, um was es sich handelte, trabte ziemlich tapfer weiter.
Der Fremde war, soviel ich sehen konnte, ein Mann von ungefähr vierzig Jahren, mit offenem und intelligentem Gesicht. Er trug die Kleidung der Landbewohner, einen breitkrempigen Filzhut mit einem drei Finger breiten goldenen Band geziert. Ein buntes Zarapé fiel von seinen Schultern auf seine Beine herab und bedeckte das Hinterteil seines Pferdes. An seinen Baqueros-Stiefeln waren schwere silberne Sporen mit Riemen befestigt.
An seiner Seite trug er, wie alle Mexikaner, die Machete, eine Art kurzer, gerader Säbel, den Dolchen unserer Infanteristen nicht unähnlich.
Bald wurde unsere Unterhaltung lebhafter und vertraulicher.
Nach kaum einer halben Stunde sah ich die Gebäude einer ansehnlichen Wohnung aus dem Dunkel aufsteigen. Es war die Hazienda, in welcher mir mein Führer eine gute Aufnahme versprochen hatte.
Mein Pferd beschleunigte seinen Lauf aus eigenem Antrieb.
Ich warf einen neugierigen Blick um mich und sah die hohen Hecken einer gut gepflegten Huerta und alle Zeichen des Komforts.
Ich dankte innerlich meinem guten Stern, der mich eine so glückliche Begegnung hatte machen lassen.
Bei unserer Ankunft ließ ein wahrscheinlich als Wache aufgestellter Reiter ein lautes »Wer da?« erschallen, während sieben bis acht Rastreros von guter Rasse herbeikamen, meinen Führer mit freudigem Geheule umsprangen und mich der Reihe nach anrochen. »Ich bin es«, sagte mein Begleiter.
»Nun, so kommt doch endlich, Belhumeur«, sagte die Wache, »man erwartet Euch seit länger als einer Stunde.«
»Geht und sagt dem Herrn, dass ich einen Reisenden mitbringe«, schrie mein Führer. »Vorzüglich, Schwarzer Hirsch, vergesst nicht zu sagen, dass es ein Franzose ist.«
»Wie wisst Ihr das?«, fragte ich etwas ärgerlich, »denn ich bilde mir ein, das Spanische sehr rein zu sprechen.«
»Alle Wetter, weil wir beinahe Landsleute sind«, sagte er lachend.
»Wieso denn?«
»Nun, ich bin ein Kanadier. Sie werden begreifen, dass ich den Akzent gleich erkannt habe.«
Während dieses kurzen Wortwechsels hatten wir den Eingang der Hazienda erreicht, wo wir mehrere Personen antrafen, die uns erwarteten, um uns zu empfangen.
Wie es schien, hatte die Ankündigung meines Begleiters, dass ich ein Franzose sei, einigen Eindruck gemacht.
Zehn bis zwölf Diener trugen Fackeln, bei deren Schein ich unterscheiden konnte, dass sechs bis acht Menschen, Männer und Frauen, sich herzu drängten, um uns zu empfangen.
Der Herr der Hazienda, den ich sogleich erkannte, kam uns, mit einer Dame am Arm, entgegen, die sehr schön gewesen sein musste, denn sie konnte noch für angenehm gelten, obgleich sie nahe an die vierzig Jahre alt war.
Ihr Mann war ein hochgewachsener Fünfziger mit männlichen und charakteristischen Zügen. Fünf bis sechs allerliebste Kinder, die ihnen zu ähnlich sahen, um nicht die ihren zu sein, umstanden sie mit aufgerissenen Augen.
Im Hintergrund endlich stand eine Dame von ungefähr sechzig Jahren und ein beinahe hundertjähriger Greis halb im Schatten.
Ich umfasste die gesamte Familie, deren patriarchalisches Aussehen, Sympathie und Ehrerbietung erweckte, mit einem Blick.
»Mein Herr«, sagte der Haziendero freundlich und erfasste die Zügel meines Pferdes, um mir beim Absteigen behilflich zu sein. »Esa casa se de V… dieses Hans gehört Ihnen. Ich bin meinem Freund Belhumeur sehr dankbar, dass er Sie überredet hat, mit herzukommen.«
»Ich gestehe, mein Herr«, antwortete ich lächelnd, »dass ihm das nicht sehr schwer geworden ist und dass ich das Anerbieten, welches er so freundlich war, mir zu machen, dankbar angenommen habe.«
»Wenn es Ihnen gefällig ist«, fuhr der Haziendero fort, »wollen wir, da es schon spät ist und ganz besonders, weil Sie der Ruhe bedürfen, sogleich in den Speisesaal gehen. Wir wollten uns eben zu Tisch setzen, als man uns Ihre Ankunft meldete.«
»Ich bin Ihnen sehr dankbar«, antwortete ich und verneigte mich. »Ihr freundlicher Empfang hat mich bereits meine Müdigkeit vergessen lassen.«
»Daran erkennen wir die französische Höflichkeit«, sagte die Dame mit einem allerliebsten Lächeln.
Ich bot der Dame des Hauses meinen Arm, und wir begaben uns in den Speisesaal, wo auf einer ungeheuren Tafel eine wahrhaft homerische Mahlzeit aufgetragen war, deren angenehmer Duft mich daran erinnerte, dass ich seit zwölf Stunden nichts gegessen hatte. Man setzte sich.
Es waren wenigstens vierzig Personen um den Tisch versammelt.
In der Hazienda bestand noch der alte Brauch, welcher anfängt, sich zu verlieren, dass die Diener des Hauses mit der Herrschaft speisen.
Alles, was ich in dem Haus sah und hörte, bestach mich. Es herrschte ein Geist der Rechtschaffenheit darin, der einem das Herz erwärmte.
Als der erste Hunger gestillt war, wurde die bis dahin stockende Unterhaltung allgemein.
»Nun, Belhumeur«, sagte der Großvater zu meinem Führer, der neben mir saß und seine Gabel eifrig in Bewegung setzte. »Haben Sie die Fährte des Jaguars entdeckt?«
»Ich habe nicht nur die Fährte gefunden, General, sondern ich habe Grund, zu glauben, dass der Jaguar nicht allein ist, sondern dass er einen Begleiter hat.«
»So! So«, sagte der Greis, »wissen Sie das gewiss?«
»Ich kann mich irren«, General, doch glaube ich es nicht. Fragen Sie nur Treuherz, dort unten in den Prärien des Westens hatte ich einigen Ruf.«
»Belhumeur wird wohl recht haben, mein Vater«, sagte der Haziendero und nickte bejahend. »Er ist ein zu erfahrener Jäger, um sich täuschen zu lassen.«
»Da werden wir ein Treiben veranstalten müssen, um uns von der gefährlichen Nachbarschaft zu befreien. Bist du nicht auch der Ansicht, Rafael?«
»Es war meine Absicht, Vater, es freut mich, dass du denselben Gedanken hast. Ich habe schon mit dem Schwarzen Hirsch gesprochen, es wird wohl schon alles bereit sein.«
»Die Jagd kann beginnen, wenn es Euch beliebt. Es ist alles in Ordnung«, sagte ein ältlicher Mann, der nicht weit von mir saß.
Die Tür ging auf und ein Mann trat ein.
Seine Ankunft wurde mit Ausrufen der Freude begrüßt. Don Rafael und seine Frau standen lebhaft auf und gingen ihm entgegen.
Diese Höflichkeit überraschte mich um so mehr, als der Ankömmling nur ein Bravo oder freier Indianer war. Er trug die vollständige Kleidung der Krieger seines Stammes. Vermöge meines häufigen Aufenthaltes unter den Rothäuten glaubte ich zu erkennen, dass er zu einem der zahlreichen Comanchenstämme gehöre.
»Ach! Adlerkopf, Adlerkopf«, riefen die Kinder und umringten ihn vergnügt.
Der Indianer nahm sie nach der Reihe in seine Arme, küsste sie und beschenkte sie mit einigen jener Kleinigkeiten, die die Eingeborenen Amerikas mit so viel Geschick anfertigen.
Dann trat er lächelnd vor, begrüßte die zahlreiche Gesellschaft, die im Saal versammelt war, mit vollendeter Anmut und ließ sich zwischen dem Hausherrn und der Hausfrau nieder.
»Wir erwarteten Euch noch vor Sonnenuntergang, Häuptling«, sagte die Dame freundlich. »Es ist nicht recht, dass Ihr uns habt so lange warten lassen.«
»Adlerkopf war auf der Fährte der Jaguare«, sagte der Häuptling gemessen, »meine Tochter soll sich nicht fürchten. Die Jaguare sind tot.«
»Wie! Ihr habt die Jaguare schon getötet, Häuptling?«, sagte Don Rafael lebhaft.
»Mein Bruder wird ja sehen! Die Felle sind sehr schön, sie liegen im Hof.«
»Nun, Häuptling«, sagte der Großvater und reichte ihm die Hand. »Ich sehe, dass Ihr noch immer unsere Vorsehung sein wollt.«
»Mein Vater spricht gut«, sagte der Häuptling und verneigte sich. »Der Herr des Lebens rät es an. Die Familie meines Vaters ist die meine.«
Nach der Mahlzeit führte mich Don Rafael in eine behagliche Schlafstube, wo ich, noch sehr beschäftigt mit dem, was ich an dem Abend gehört und gesehen hatte, einschlief.
Am anderen Morgen wollten meine Wirte durchaus nicht in meine Abreise einwilligen. Ich muss gestehen, dass ich nicht gar zu hartnäckig darauf bestand. Ich war über die freundliche Aufnahme, die ich gefunden hatte, nicht nur sehr erfreut, sondern eine geheime Neugierde trieb mich an, noch einige Tage zu verweilen.
So verging eine Woche.
Don Rafael und seine Familie überschütteten mich mit liebenswürdigen Aufmerksamkeiten, mein Leben glich fortwährend einem schönen Traum.
Ich weiß nicht, warum? Aber alles, was ich seit meiner Ankunft in der Hazienda gesehen, hatte die Neugierde, die ich von Anfang an empfunden, nur erhöht.
Es wollte mir scheinen, als ob dem Glück, das aus allen Mienen dieser glücklichen Familie sprach, eine lange Reihe von Unglücksfällen vorhergegangen sein musste.
Ich konnte nicht glauben, dass das Leben dieser Menschen immer ruhig und still dahingeflossen sei, sondern ich bildete mir, ohne selbst zu wissen, warum, ein, dass sie nach einer langen Prüfungszeit den Hafen endlich gefunden hätten.
Ihre Mienen zeigten den Adel, den nur große Schmerzen einprägen, und die auf der Stirn sichtbaren Furchen schienen mir zu tief gezogen zu sein, um nicht vom Kummer herzurühren.
Der Gedanke hatte sich in meinem Kopf so fest gesetzt, dass er, trotz meiner Bemühungen, ihn zu verjagen, immer hartnäckiger und deutlicher wiederkehrte. Nach wenigen Tagen war ich der Freund der Familie geworden und hatte sie mit allem, was mich betraf, bekannt gemacht. Sie hatten mich vollständig in ihr engstes Vertrauen aufgenommen, doch wagte ich nicht, die Frage, die mir beständig auf der Zunge schwebte, auszusprechen, so sehr fürchtete ich, entweder eine große Taktlosigkeit zu begehen oder alte Wunden wieder aufzureißen.
Eines Abends, als Don Rafael und ich von der Jagd heimkehrten, legte er in kurzer Entfernung vom Haus seinen Arm auf den meinen.
»Was ist Ihnen, Don Gustavio«, sagte er zu mir, »Sie sind finster, in sich gekehrt, langweilen Sie sich bei uns?«
»Das können Sie nicht glauben«, antwortete ich schnell, »ich weiß im Gegenteil nicht, wie ich es aussprechen soll, dass ich mich niemals so glücklich gefühlt habe wie bei Ihnen.«
»So bleiben Sie«, sagte er mit Offenheit, »wir haben an unserem Herd noch Raum für einen Freund.«
»Ich danke Ihnen«, sagte ich und drückte ihm die Hand. »So gern ich es möchte, so ist es leider unmöglich. Ich habe wie der Jude in der Legende, einen bösen Geist in mir, der mir unaufhörlich zuruft: ›Wandere!‹ Ich muss meinem Schicksal folgen!«
Ich seufzte.
»Hören Sie!«, fuhr er fort, »seien Sie aufrichtig! Sagen Sie mir, was Sie beschäftigt. Sie machen uns allen seit einigen Tagen Sorge. Niemand wagte es, Sie zu fragen«, fügte er lächelnd hinzu. »Kurz, ich habe mir ein Herz gefasst, wie ihr Franzosen zu sagen pflegt, und mich entschlossen, Sie auszufragen.«
»Nun denn! Da Sie es verlangen«, antwortete ich, »will ich es Ihnen sagen. Nur bitte ich, meine Aufrichtigkeit nicht übel zu deuten und versichert zu sein, dass die Teilnahme eben so viel Anteil daran hat wie die Neugierde.«
»Heraus damit«, sagte er mit mildem Lächeln, »beichten Sie, fürchten Sie nichts, ich werde Ihnen gewiss die Absolution erteilen.«
»Es ist mir auch lieber, wenn ich es vom Herzen los bin, und ich will Ihnen alles sagen.«
»So ist es recht, reden Sie.«
»Ich weiß nicht, warum ich mir einbilde, dass Sie nicht immer so glücklich gewesen sind, wie jetzt, und dass Sie Ihr gegenwärtiges Glück nur durch große Widerwärtigkeiten erkauft haben.«
Ein trübes Lächeln flog über seine Lippen.
»Verzeihen Sie mir die Taktlosigkeit, die ich begangen habe«, rief ich lebhaft aus. »Was ich fürchtete, ist geschehen! Sprechen wir nicht mehr davon. Ich bitte Sie, lassen wir die Sache ruhen.«
Ich war wirklich außer mir.
Don Rafael antwortete gütig. »Warum? Ich finde Ihre Frage nicht zudringlich. Die Anteilnahme, die Sie für uns empfinden, hat Sie dazu getrieben. Nur wenn man die Menschen liebt, ist man so scharfsichtig. Nein, mein Freund, Sie haben sich nicht geirrt, wir sind alle schwer geprüft worden. Sie sollen, da Sie es wünschen, alles erfahren. Vielleicht werden Sie, wenn Sie die Erzählung unserer Leiden angehört haben, eingestehen, dass wir wirklich das Glück, welches wir genießen, teuer erkauft haben. Doch treten wir ein, man wird uns zum Essen erwarten.«
Abends versammelte Don Rafael einige Personen um sich, ließ eine Flasche Mezcal und Zigaretten auf den Tisch stellen und sagte zu mir: »Jetzt, mein Freund, will ich Ihre Neugierde befriedigen. Belhumeur, der Schwarze Hirsch, Adlerkopf, mein Vater, meine Mutter und meine liebe Frau, die alle an dem seltsamen Drama, was ich Ihnen erzählen werde, teilgenommen haben, werden meinem Gedächtnis, wenn es mich verlassen sollte, zu Hilfe kommen.«
Hierauf, lieber Leser, erzählte mir Don Rafael, was du eben gelesen hast. Ich gestehe, dass die Erzählung dieser Abenteuer aus dem Munde dessen, der die Hauptrolle darin gespielt und in Gegenwart derjenigen, die teil daran genommen hatten, mich im höchsten Grade interessierte, was dir wahrscheinlich nicht begegnet sein wird. Denn notwendigerweise verliert sie in meinem Munde die Lebendigkeit, die ihren größten Reiz ausmachte.
Acht Tage später verließ ich meine liebenswürdigen Wirte, aber anstatt mich, wie ich es anfangs Willens gewesen, nach Guaymas einzuschiffen, ging ich in Begleitung Adlerkopfs nach Apacheria, wo mich der Zufall Zeuge ungewöhnlicher Szenen werden ließ, die ich dir vielleicht einst erzählen werde, wenn dich vorstehende Erzählung nicht gar zu sehr gelangweilt hat.
Ende
Schreibe einen Kommentar