Die Trapper in Arkansas – Band 2.8
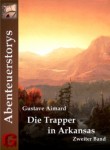 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 2
Erster Teil – Treuherz
Kapitel 17 – Adlerkopf
Adlerkopf war ein eben so vorsichtiger wie entschlossener Häuptling. Er wusste, dass er von den Amerikanern alles zu fürchten hatte, wenn es ihm nicht gelang, seine Spur vollständig zu verbergen.
Er versäumte daher, nachdem der Überfall der weißen Ansiedelung an den Ufern des Canadian gelungen war, nichts, um die seinen gegen die schreckliche Vergeltung, die ihnen drohte, zu schützen.
Man kann sich von dem Erfindungsgeist der Indianer, wenn es gilt, eine Spur zu verbergen, keinen Begriff machen.
Sie reiten oder gehen wohl zwanzig Mal über dieselbe Stelle und wissen die Spur so gut durcheinanderzubringen, dass sie zuletzt ganz unkenntlich werden, wobei sie jede Unebenheit des Bodens berücksichtigen und einer in die Fußstapfen des anderen treten, um ihre Anzahl zu verbergen. Oft folgen sie tagelang der Strömung eines Baches, wobei sie sich häufig bis an den Gürtel im Wasser befinden, ja sie treiben die Vorsicht und Geduld so weit, dass sie mit der Hand beinahe Schritt für Schritt die Spur, die sie den scharfen und spähenden Blicken ihrer Feinde verraten könnten, verwischen.
Der Stamm der Schlange, zu welchem Adlerkopf und die Krieger, die er befehligte, gehörten, war ungefähr fünfhundert Mann stark, als er die Prärie betrat, um Bisamochsen zu jagen und die Pawnee und Sioux zu bekämpfen, mit denen sie beständig im Streit lagen.
Sobald sein Feldzug beendet war, hatte Adlerkopf beschlossen, sich unverzüglich wieder zu seinen Brüdern zu begeben, um die bei der Einnahme des Dorfes gemachte Beute in Sicherheit zu bringen und an einem großen Zug teilzunehmen, den sein Stamm gegen die weißen Trapper und Mestizen, die verstreut in den Prärien leben und von den Indianern mit Recht als ihre ärgsten Feinde betrachtet werden, zu unternehmen beabsichtigte.
Trotz der Vorsicht, welche der Häuptling beim Marsch angewendet hatte, war der Trupp doch schnell vorwärtsgekommen.
Am sechsten Tag nach der Zerstörung des Forts hielten die Comanchen am Ufer eines kleinen Baches ohne Namen an, wie man deren viele in der Gegend findet, und bereiteten sich vor, ihr Lager für die Nacht aufzuschlagen.
Nichts ist einfacher als ein indianisches Lager, wenn sie sich auf dem Kriegspfad befinden.
Die Pferde werden angebunden, damit sie nicht davonlaufen können. Wenn man keinen Überfall fürchtet, so wird ein Feuer angezündet, im entgegengesetzten Fall richtet sich ein jeder mit dem Essen und Schlafen ein, so gut er kann.
Seit ihrem Abmarsch vom Fort hatten die Comanchen nichts bemerkt, woraus sie hätten schließen können, dass man sie verfolgte oder beobachtete. Ihre Kundschafter hatten keine verdächtige Spur entdeckt. Sie waren nicht weit vom Lager ihres Stammes entfernt, und daher ganz sorglos.
Adlerkopf ließ ein Feuer anzünden und stellte selbst die Schildwachen aus.
Als er diese Vorsichtsmaßregel getroffen hatte, lehnte sich der Häuptling an einen Ebenholzbaum, nahm seine Kalumets und befahl, dass ihm der Greis und die spanischen Frauen vorgeführt würden.
Als sie vor ihm standen, grüßte Adlerkopf den Greis herzlich und bot ihm ein Kalumet an, welches Zeichen des Wohlwollens der Greis annahm und sich zugleich darauf vorbereitete, die Fragen, welche ihm der Indianer wahrscheinlich vorlegen würde, zu beantworten. Dieser ergriff in der Tat nach einer kurzen Pause das Wort.
»Fühlt sich mein Bruder wohl bei den Rothäuten?«, fragte er ihn.
»Ich würde mich mit Unrecht beklagen, Häuptling«, antwortete der Spanier, »man hat mich, seitdem ich bei Euch bin, sehr rücksichtsvoll behandelt.«
»Mein Bruder ist ein Freund«, sagte der Comanche mit Pathos.
Der Greis verneigte sich.
»Wir sind endlich auf unserem Jagdgebiete«, fuhr der Häuptling fort, »mein Bruder Weißhaupt trägt die Last eines langen Lebens. Es ist besser für ihn beim Feuer des Rates zu sitzen, als zu Pferde den Hirsch oder Bisambüffel zu jagen. Was wünscht mein Bruder?«
»Häuptling«, antwortete der Spanier, »du sprichst wahr. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich wie jedes andere Kind der Prärien, tagelang auf einem feurigen und ungezähmten Mustang sitzend, jagen konnte. Meine Kräfte sind geschwunden, meine Glieder haben ihre Gelenkigkeit und mein Auge seine Unfehlbarkeit verloren. Ich tauge nicht mehr zu einem Streifzug, wie kurz er auch sein möge.«
»Gut!«, antwortete der Indianer gleichmütig und blies dichte Rauchwolken aus Mund und Nase, »so möge mein Bruder seinem Freund sagen, was er wünscht, und es soll geschehen.«
»Ich danke dir, Häuptling, und werde von deinem freundlichen Anerbieten Gebrauch machen. Es würde mich glücklich machen, wenn du mir die Mittel gäbest, mich zu einer Ansiedelung von Menschen meiner Farbe zu begeben, wo ich die wenigen Tage, die ich noch zu leben habe, in Frieden verbringen kann.«
»Warum nicht? Nichts ist einfacher. Sobald wir wieder bei unserem Stamm sein werden, sollen die Wünsche meines Bruders, da er nicht bei seinen roten Freunden bleiben will, erfüllt werden.«
Es folgte ein Augenblick des Schweigens. Der Greis, der die Unterhaltung beendet glaubte, schickte sich an, sich zurückzuziehen. Der Häuptling bedeutete ihn durch einen Wink, zu bleiben.
Nach einiger Zeit schüttelte der Indianer die Asche aus seiner Pfeife, steckte sie mit dem Rohr wieder in den Gürtel und sagte, indem er einen eigentümlichen Blick auf den Spanier richtete, in traurigem Ton: »Mein Bruder ist glücklich. Obwohl er schon viele Winter zählt, wandert er doch nicht allein durchs Leben.«
»Was meint der Häuptling?«, fragte der Greis, »ich verstehe nicht.«
»Mein Bruder hat eine Familie«, erwiderte der Comanche.
»Ach, mein Bruder irrt sich, ich bin allein auf der Welt.«
»Was sagt mein Bruder da? Hat er nicht seine Gefährtin bei sich?«
Ein trauriges Lächeln flog über die blassen Lippen des Greises. »Nein«, sagte er nach einer Pause, »ich habe keine Gefährtin.«
»Was ist ihm denn jene Frau?«, sagte der Häuptling mit geheucheltem Erstaunen und zeigte auf die spanische Dame, die schweigend und trübe an der Seite des Greises stand.
»Die Frau ist meine Gebieterin.«
»Ist mein Bruder ein Sklave?«, sagte der Comanche mit boshaftem Lächeln.
»Nein«, erwiderte der Greis stolz, »ich bin nicht der Sklave dieser Frau, ich bin ihr treuer Diener.«
»Oah!«, sagte der Häuptling, schüttelte den Kopf und sann lange über diese Antwort nach.
Aber der Indianer konnte die Worte des Spaniers nicht verstehen, der Unterschied war zu fein für seine Begriffe. Nach zwei bis drei Minuten schüttelte er den Kopf und gab es auf, die Lösung des unbegreiflichen Rätsels zu finden.
»Gut!«, sagte er und warf unter den halbgeschlossenen Augenlidern einen ironischen Blick auf den Greis, »die Frau kann mit meinem Bruder ziehen.«
»So habe ich es auch stets verstanden«, antwortete der Spanier.
Die bejahrte Frau, die bis dahin geschwiegen hatte, hielt es nun für angemessen, sich in die Unterhaltung einzumischen.
»Ich danke dem Häuptling«, sagte sie, »aber da er so freundlich ist, uns dienen zu wollen, so darf ich wohl eine Bitte an ihn richten?«
»Meine Mutter mag sprechen, meine Ohren stehen offen.«
»Ich habe einen Sohn, der ein großer, weißer Jäger ist. Er muss sich augenblicklich in der Prärie befinden. Vielleicht dass, wenn mein Bruder einwilligte, uns noch einige Tage bei sich zu behalten, es uns möglich würde, ihn zu treffen. Unter seinem Schutz hätten wir nichts mehr zu befürchten.«
Bei diesen unüberlegten Worten machte der Spanier eine Gebärde des Schreckens.
»Señorita«, sagte er in seiner Muttersprache, »bedenken Sie wohl, was Sie …«
»Still!«, unterbrach ihn der Indianer kurz, »warum spricht mein weißer Bruder eine fremde Sprache vor mir? Fürchtet er, dass ich seine Worte verstehe?«
»Ach! Häuptling!«, sagte der Spanier mit einer verneinenden Bewegung.
»Warum lässt denn dann mein Bruder meine Mutter mit dem bleichen Gesicht nicht reden, sie spricht mit einem Häuptling.«
Der Greis schwieg, wurde aber von einer Ahnung erfüllt.
Der Häuptling der Comanchen wusste sehr wohl, mit wem er sprach. Er spielte mit den zwei Spaniern, wie eine Katze mit der Maus, verbarg aber seine Empfindungen und wandte sich zu der Frau, vor der er sich mit der den Indianern angeborenen Höflichkeit verneigte.
»Oha!«, sagte er mit matter Stimme und teilnehmendem Lächeln, »der Sohn meiner Mutter ist ein großer Jäger, desto besser.«
Der armen Frau ging das Herz auf vor Freude.
»Ja«, sagte sie mit Wärme, »er ist einer der besten Trapper in den Prärien des Westens«, sagte der Häuptling und wurde immer freundlicher, »ein so berühmter Krieger muss einen auf den Prärien allgemein geachteten Namen haben.«
Dem Spanier missfiel etwas. Vom Blick des Comanchen eingeschüchtert, wusste er nicht, wie er seine Herrin warnen sollte, den Namen ihres Sohnes nicht zu nennen.
»Sein Name ist sehr bekannt«, sagte die Dame.
»Ach!«, rief der Greis lebhaft aus, »so sind die Mütter alle. In ihren Augen sind ihre Söhne immer Helden! Der ihre, obgleich er ein vortrefflicher, junger Mann ist, ist doch nicht mehr wert als ein anderer. Gewiss ist sein Name meinem Bruder noch nicht zu Ohren gekommen.«
»Das kann mein Bruder ja nicht wissen«, sagte der Indianer mit spöttischem Lächeln.
»Ich vermute es«, antwortete der Greis, »oder wenn mein Bruder ihn auch gehört haben sollte, so hat er ihn wenigstens längst vergessen, und es ist nicht der Mühe wert, ihn daran zu erinnern. Wenn es mein Bruder erlaubt, wollen wir uns zurückziehen. Der Tag war anstrengend. Es ist Zeit, dass wir uns ausruhen.«
»Sogleich«, sagte der Comanche ruhig und wandte sich wieder der Frau zu. »Welches ist der Name des weißen Kriegers?«, fragte er energisch.
Aber die alte Dame, welche durch die Unterbrechung ihres Dieners, dessen Treue und Vorsicht sie kannte, aufmerksam geworden war, antwortete nicht, denn sie fühlte im Geist, dass sie einen Fehler begangen habe, und wusste nicht, wie sie ihn wieder gut machen sollte.
»Hat mich meine Mutter nicht gehört?«, fuhr der Häuptling fort.
»Warum soll ich einen Namen nennen, der dir doch wahrscheinlich fremd ist und dich auf keinen Fall interessieren kann? Wenn es mein Bruder erlaubt, so werde ich mich entfernen.«
»Nicht eher, bis meine Mutter den Namen ihres Sohnes, des großen Kriegers genannt hat«, sagte der Comanche, indem er die Augenbrauen zusammenzog und mit schlecht verhehltem Zorn mit dem Fuß stampfte.
Der Greis sah ein, dass er der Sache ein Ende machen müsse. Sein Entschluss war augenblicklich gefasst.
»Mein Bruder ist ein großer Häuptling«, sagte er, »trotz seines braunen Haares ist seine Weisheit außerordentlich. Ich bin sein Freund. Er wird den Zufall, der ihm die Mutter seines Feindes in die Hände lieferte, nicht benutzen wollen. Der Sohn dieser Frau ist Treuherz.«
»Oah!«, sagte Adlerkopf mit düsterem Lächeln, »ich wusste es. Warum haben die Bleichgesichter zwei Zungen und zwei Herzen und suchen immer die Rothäute zu hintergehen?«
»Wir haben nicht versucht, dich zu hintergehen«, Häuptling.«
»Wenn man euch, solange ihr bei uns seid, wie Söhne unseres Stammes behandelt hat, so habe ich euch das Leben gerettet.«
»Das ist wahr.«
»Nun«, fuhr er mit spöttischem Lächeln fort, »will ich euch beweisen, dass die Indianer nicht vergessen, und Böses mit Gutem vergelten. Wer hat mir die Wunden, die ihr an mir seht, beigebracht? Treuherz! Wir sind Feinde, seine Mutter ist in meiner Gewalt. Ich könnte sie augenblicklich an den Marterpfahl binden lassen, das wäre meine Rache.«
Die beiden Spanier senkten den Kopf.
»Das Gesetz in der Prärie lautet: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hört mich jetzt an, Alte Eiche. Ich gewähre euch, in Erinnerung an unsere alte Freundschaft eine Frist. Morgen bei Tagesanbruch wirst du gehen, um Treuherz zu suchen. Wenn er sich binnen vier Tagen nicht freiwillig gestellt hat, wird seine Mutter sterben. Meine jungen Männer werden sie am Blutpfahl lebendig verbrennen, und meine Brüder werden sich aus ihren Knochen pfeifen schnitzen. Geht, ich habe gesprochen.«
Der Greis wollte für Treuherz bitten, er warf sich dem Häuptling zu Füßen, aber der rachsüchtige Indianer stieß ihn mit dem Fuß zurück und entfernte sich.
»Ach! Señora«, murmelte der Greis verzweiflungsvoll, »Sie sind verloren.«
»Vor allen Dingen, Eusebio«, antwortete die Mutter mit bewegter Stimme, »bringe meinen Sohn nicht her. Was tut es, wenn ich sterbe. Hat mein Leben nicht leider schon lange genug gewährt?«
Der alte Diener blickte seine Herrin mit Bewunderung an.
»Immer die Gleiche«, sagte er gerührt.
»Gehört das Leben einer Mutter nicht ihrem Kinde an?«, sagte sie aus vollem Herzen.
Die beiden alten Leute sanken, vom Schmerz überwältigt, am Fuß eines Baumes nieder und verbrachten die Nacht im Gebet.
Adlerkopf schien keine Ahnung von ihrer Verzweiflung zu haben.
Schreibe einen Kommentar