Camp Grant Massaker
In den frühen Morgenstunden des 30. April 1871 wurden acht Männer sowie 110 Frauen und Kinder brutal in der kurzen Zeitspanne von 30 Minuten ermordet. Darüber hinaus entführte man während dieser grausigen Tat 28 Arivaipa Apache Babys, um sie auf dem Kindersklavenmarkt zu verkaufen. Die Leichen, die verlassen im Arivaipa Canyon lagen und der Morgensonne ausgesetzt waren, verwesten vor sich hin. Es war ein makabrer Anblick für den Arzt Conant B. Briesly, als er den Ort des Geschehens gegen 07:30 Uhr desselben Morgens erreichte. Er war der erste Weiße, welcher diesen grausigen Anblick dokumentierte. Um acht Uhr morgens frühstückte die gemischte Bande, welche für das grauenhafte Massaker verantwortlich zeichnete, und feierte ihren Sieg über einen wehrlosen und schlafenden Indianerstamm. Was veranlasste 148 Männer, bestehend aus sechs Angloamerikanern, 94 Tohono O’odham und 48 Mexikanern, zu einer solchen Greueltat?
Dieser Frage geht Autor Alfred Wallon in seinem neuesten Werk nach und gibt in literarischer Form darauf eine Antwort.
Das Buch
Alfred Wallon
Camp Grant Massaker
History, E-Book, Kindle, 3,99 Euro, Covergestaltung Vanessa Busse
Kurzinhalt:
Tucson, Arizona, im April 1871:
Längst haben der Aravaipa-Häuptling Eskiminzin und sein Stamm Frieden mit den Weißen geschlossen. Aber andere Apachenstämme befinden sich noch im Krieg mit den verhassten Feinden und überfallen abgelegene Ranches und Farmen.
In der Stadt Tucson hat sich eine Bürgermiliz unter Führung von William S. Oury gebildet, die von einflussreichen Geschäftsleuten finanziell unterstützt wird. Tucson war in der Vergangenheit schon oft das Ziel von Apachenangriffen – und die Tatsache, dass ein ganzer Stamm nur wenige Meilen entfernt lebt, schüren Angst und Hass in der Bevölkerung. Als Apachen die Mission von San Xavier angreifen und alle Bewohner grausam getötet werden, verbreitet sich das Gerücht, dass auch Häuptling Eskiminzin und sein Stamm an diesem Überfall beteiligt waren. Daraufhin beschließt die Bürgermiliz, eine Strafexpedition gegen die Aravaipas zu starten und den Stamm auszurotten.
Leseprobe
Kapitel 1
10. April 1871
San Xavier Mission
30 Meilen südlich von Tucson
Er bemerkte die große Rauchwolke, obwohl er noch fast zwei Meilen von der San Xavier Mission entfernt war. Jordan Scott wusste, dass dies Ärger bedeutete. Er zügelte den braunen Morganhengst und suchte in der Satteltasche nach dem Fernglas. Dann spähte er hindurch und versuchte aus der Distanz weitere Einzelheiten zu erkennen. Sekunden später erblickte er einen Reitertrupp, der sich rasch von dem Ort entfernte.
Scott fluchte leise, weil er nicht genau ausmachen konnte, wer die Reiter waren. Eins stand jedoch fest für ihn: Wenn in dieser abgelegenen Gegend Rauch in den Himmel stieg, bedeutete dies fast immer, dass ein Überfall stattgefunden hatte. Und der musste so plötzlich gekommen sein, dass sich die Bewohner der alten Mission nicht mehr hatten wehren können.
Er wartete einen Moment und beobachtete mit dem Fernglas sehr sorgsam das vor ihm liegende Gelände. Die San Xavier Mission befand sich am Ende eines kleinen, beinahe schon idyllisch anmutenden Tals, das von einem Bach durchzogen wurde und für die Bewohner zu einer lebenswichtigen Ader geworden war. Dieser Ort war einst von spanischen Mönchen gegründet worden und beherbergte nun auch noch eine Handvoll alter Männer, die ihre religiösen Riten praktizierten und seit Jahren vergeblich darauf hofften, die Apachen mit der Bibel und ihrer Lebensweise zum christlichen Glauben konvertieren zu können.
Was die Apachen wirklich von den Kuttenträgern hielten, hatten sie jetzt deutlich demonstriert. Mit einem gewaltsamen Übergriff auf die Mission, der vor nicht allzu langer Zeit begonnen hatte. Jordan Scott hatte schon einige Begegnungen mit den Apachen gehabt und wusste, wie gefährlich die Krieger sein konnten, wenn sie darauf aus waren, weiße Siedlungen anzugreifen. Sie waren zu allem entschlossen und kannten keine Gnade – und das hatten die Mönche nun vermutlich mit dem Leben bezahlen müssen.
Erst als Scott ganz sicher war, dass ihm keine Gefahr mehr drohte und die Apachen in westlicher Richtung verschwunden waren, setzte er den Ritt fort. Inzwischen roch er den Rauch und sah die Flammen, die aus den Gebäuden schlugen. Die Feuersbrunst war allgegenwärtig und hatte sich mittlerweile auf den gesamten Gebäudekomplex ausgeweitet. Es war jetzt so heiß, dass sein Pferd unter ihm scheute und ängstlich wieherte. Dennoch zwang er das Tier, den Weg fortzusetzen. Bis er vom äußeren Teil des Mauerwerks noch knapp 50 Meter entfernt war.
Seine Augen tränten, als er aus dem Sattel stieg, das Gewehr aus der Halterung nahm und sich langsam den brennenden Gebäuden näherte. Das Knistern von Holz und die Geräusche der verzehrenden Flammen überlagerten alles. Trotzdem wagte sich Scott weiter vor. Dann jedoch wurde der Rauch so dicht, dass er sich wieder zurückzog. Er wollte sich selbst nicht in Gefahr begeben und von den Trümmern des einstürzenden Gebälks begraben werden.
Noch bevor er diesen Gedanken zu Ende gebracht hatte, fiel das Dach des Hauses auf der gegenüberliegenden Seite des Innenhofs zusammen. Schwarze Rauchwolken breiteten sich aus und Funken flogen empor. Jordan Scott trat rasch einige Schritte zurück, weil der Qualm jetzt so dicht wurde, dass er die Atemwege brennend scharf reizte.
Stumm sah er aus der Entfernung zu, wie die Flammen ihre Zerstörung weiter fortsetzten und die aus Holz errichteten Teile des Gebäudekomplexes zu Asche und Schutt zerfielen. Da drin konnte niemand mehr am Leben sein – nicht bei dieser unerträglichen Hitze, die im Innenhof herrschte.
Scott spürte, wie sich feine Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten, als er daran dachte, wie der Tod über die Mission gekommen war. In Form einer marodierenden Apachenhorde, die nur eines im Sinn hatte: jeden Weißen zu töten, der sich dort aufhielt. Mit diesem Überfall wollten sie ein unmissverständliches Zeichen setzen und der Armee klarmachen, dass sie immer noch am längeren Hebel saßen.
Bitterkeit erfasste ihn, als er sich vor Augen hielt, dass die Menschen in diesem Land niemals in Frieden leben konnten, solange irgendwelche Unruhestifter nur Krieg und Zerstörung im Sinn hatten.
Er wusste nicht, wie lange er die brennenden Gebäude schon beobachtet hatte. Aber irgendetwas zwang ihn förmlich dazu, weiter an diesem Ort zu verweilen, der von den Apachen auf so grausame Weise heimgesucht worden war. Zumindest glaubte er, dass es sich bei den flüchtenden Reitern um Apachen gehandelt hatte. Wer wäre sonst auf den Gedanken gekommen, ausgerechnet eine Mission zu überfallen und die friedliebenden Menschen dort zu töten?
Allmählich sanken die Flammen in sich zusammen, als sie keine neue Nahrung mehr fanden. Doch der dichte Rauch war noch allgegenwärtig. Trotzdem wagte es Scott jetzt, den Innenhof zu betreten und sich vorsichtig und wachsam zugleich umzuschauen. Aber wohin er auch blickte – das Bild der Zerstörung war überall. Er konnte lediglich ahnen, welchen Zweck die Überreste des Gebäudekomplexes einstmals erfüllt hatten. Das längliche Gebäude seitlich von ihm hatte geschwärzte Mauern, und als sich Scott der Stelle näherte, bemerkte er zwei Leichen, die halb von herabgestürzten Trümmern begraben worden waren.
Die Mönche sahen schrecklich aus. Ihre Körper waren blutig. Der Tod war so schnell über sie gekommen, dass sie vermutlich gar nicht begriffen hatten, was mit ihnen geschah. Auf der anderen Seite des Innenhofs befanden sich die Reste von zwei weiteren Gebäuden. Dort lag der Kadaver einer Kuh. Scott schloss daraus, dass dies die Stallungen der Mission waren. Anscheinend waren die übrigen Tiere schon von den Plünderern weggetrieben worden, denn Scott fand nichts mehr in den Trümmern. Keine weiteren Tierkörper oder Leichen von Menschen.
Doch unweit des eingestürzten Glockenturms entdeckte er die Leiche eines Apachen. Eine Kugel hatte ihn in den Rücken getroffen. Vermutlich abgefeuert von einem Mann, der nur wenige Schritte entfernt von dem Indianer lag. Er trug keine Mönchskutte. Vielleicht hatte er für die Mönche gearbeitet und sich noch wehren wollen, als der Angriff erfolgte. Aber er hatte nicht die geringste Chance gehabt – selbst wenn es ihm gelungen war, einen der Angreifer niederzuschießen.
Waffen hatte er keine mehr bei sich. Die Mörder hatten alles mitgenommen, was für sie nur irgendeinen Wert besaß. Und dazu gehörten selbstverständlich auch Revolver, Gewehre und jegliche Munition, die sie hatten finden können. Die restlichen beiden Toten fand Scott etwas weiter hinten im Hof, halb begraben von den Trümmern. Ein Mönch und ein weiterer Mann ohne Kutte. Ihre Gesichter waren im Tode schrecklich verzerrt und spiegelten das Entsetzen wider, das sie in den letzten Sekunden ihres Lebens verspürt haben mussten.
Ihm war übel beim Anblick dieser grausamen Bilder. Wut erfasste ihn angesichts dieser sinnlosen Gewalt, und er fluchte laut. Denn durch diese Bluttat würde die gesamte Region in einen grausamen Krieg gezogen werden. Und weitere Unschuldige würden sterben.
Er wandte sich ab, weil sich der beißende Rauch jetzt so sehr auf seine Atemwege gelegt hatte, dass er einen permanenten Hustenreiz in der Kehle spürte. Hastig verließ er den Innenhof und wollte wieder zurück zu seinem Pferd gehen, als ihn eine warnende Stimme innehalten ließ.
»Halt!«
Scott verharrte auf der Stelle und rührte sich nicht. Zwischen den Rauchschwaden erkannte er die Konturen von mehreren Männern. Sie hielten Gewehre und Revolver in den Händen und zielten damit unmissverständlich in seine Richtung. Es wäre tödlicher Leichtsinn, jetzt überhastet zu reagieren. Man würde es höchstwahrscheinlich falsch verstehen und auf ihn schießen.
»Gewehr fallen lassen!«, erklang eine zweite Stimme von weiter rechts. »Wird´s bald?«
Er zögerte einen kurzen Moment, doch das reichte schon aus, um einen der Männer nervös werden zu lassen. Einer von ihnen trat näher heran. Er zielte mit einem Revolver auf Scotts Magen. Seine Miene wirkte angespannt.
»Ich drücke ab«, sagte er. »Und es ist mir verdammt ernst, Mister!«
»Hören Sie, ich habe nichts damit zu tun«, erwiderte Scott mit ruhiger Stimme. »Ich kam hier vorbei, weil ich das Feuer aus der Ferne bemerkte. Aber da waren die Apachen schon längst auf und davon …«
»Apachen?« Der Mann mit dem Revolver wirkte nun zusehends nervöser. Er kratzte sich nervös am Hinterkopf, während es in seinen Augen wütend aufblitzte. »Wie viele waren es?«
»Kann ich nicht genau sagen«, antwortete Scott wahrheitsgemäß. »Ich war eine gute Meile entfernt und habe es durch das Fernglas beobachtet. Nehmen Sie jetzt endlich den Revolver weg. Sie dürften doch mittlerweile begriffen haben, dass ich mit diesem feigen Überfall nichts zu tun habe …?«
»Er hat recht, Webster«, meldete sich ein weiterer Mann zu Wort. »Steck die Waffe ein. Der Mann sieht nicht aus, als wäre er ein Abtrünniger.«
»Sind Sie sicher, Captain?«
Jordan Scott wandte den Kopf und musterte denjenigen, den Webster mit einem Offiziersrang angesprochen hatte. Aber er trug eigenartigerweise keine Uniform. Die übrigen Männer, die Scott nun erkennen konnte, nachdem der Rauch etwas abgezogen war, auch nicht.
»Ich bin William S. Oury«, sagte der Mann, der hier offensichtlich das Kommando hatte. »Meine Männer und ich gehören zur Bürgermiliz von Tucson. Und wer sind Sie, Mister?«
»Mein Name ist Jordan Scott. Ich bin auf dem Weg nach Tucson und bemerkte die Rauchwolke. Und als ich sah, wie die Indianer davon ritten, wollte ich nach dem Rechten sehen – in der Hoffnung, dass noch jemand am Leben ist. Aber es kam jede Hilfe zu spät.«
Oury erwiderte nicht gleich etwas darauf, sondern gab Webster und zwei anderen Männern einen kurzen Wink, sich in den Trümmern umzusehen, bevor er sich wieder an Scott wandte. Auf den Anführer der Bürgermiliz von Tucson wirkte der große Mann wie jemand, der nicht zufällig hier vorbei gekommen war – auch wenn er das behauptete.
»Was führt Sie nach Tucson, Scott?«
»Warum wollen Sie das wissen?«, entgegnete der leicht gereizt. »Werfen Sie mir irgendetwas vor?«
In Ourys Augen blitzte es kurz auf, als er begriff, dass er so mit Scott nicht reden konnte. Aber dann hatte er sich wieder unter Kontrolle.
»Es sind unruhige Zeiten, Mister. Die Apachenunruhen beschäftigen die Einwohner von Tucson. Es hat viele Tote auf den abgelegenen Farmen gegeben, und die Armee schafft es trotzdem nicht, die verfluchten Rothäute endlich in ihre Schranken zu verweisen. Deshalb haben einige wachsame und mutige Bürger von Tucson beschlossen, diese Miliz zu gründen – und darum müssen Sie sich solche Fragen auch gefallen lassen. Wir sind nur vorsichtig, das ist alles.«
»Kann ich gut verstehen.« Scott nickte. »Ich habe gelesen, dass die Apachen sogar einmal versucht haben, Tucson anzugreifen. Der Schrecken darüber sitzt bestimmt noch tief.«
»Richtig«, sagte Oury. »Aber ein zweites Mal wird das nicht mehr vorkommen. Wenn die Armee nichts unternimmt – wir wissen jedenfalls, was zu tun ist und …«
»Captain!«, rief einer der Männer. »Hier ist einer von den verfluchten Apachen! Ich glaube sogar, es ist ein Aravaipa!«
»Ich komme sofort, Webster!«, schrie Oury zurück und schaute ein letztes Mal zu Scott. »Am besten reiten Sie weiter. Wir kümmern uns darum, die Toten anständig unter die Erde zu bringen. Vielleicht begegnen wir uns ja noch einmal in Tucson …?«
»Möglich ist das«, entgegnete Scott und wandte sich ab. Er ging langsam zu seinem Pferd und spürte förmlich, wie gründlich ihn Oury und einige der Männer beobachteten. Der Anführer dieser sogenannten Bürgermiliz und dessen Helfershelfer waren unangenehme Zeitgenossen. Sie würden gewiss nicht dazu beitragen, dass sich das Klima zwischen Weiß und Rot in dieser Region entspannte. Denn Scott schätzte Oury so ein, dass er und seine Leute zuerst schossen und dann Fragen stellten.
Er stieg in den Sattel und nahm die Zügel des Pferdes in die Hand, während Ourys Männer die Leichen der Mönche aus den Trümmern holten. Es war ein trauriger Job, den sie zu verrichten hatten, und Scott konnte sich gut vorstellen, dass dies erneut den Zorn gegen die Apachen anheizen würde.
Deshalb hatte er entschieden, Oury zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen, dass er durchaus einen guten Grund hatte, um nach Tucson zu kommen. Weil er einen alten Freund in Camp Grant besuchen wollte. Jemand, der mit einem ganz bestimmten Indianerstamm seit einigen Monaten ganz andere Erfahrungen gemacht hatte. Aber darüber mit einem Mann wie Oury zu sprechen, wäre sicherlich vergebliche Mühe gewesen.
Veröffentlichung der Leseprobe mit freundlicher Genehmigung des Autors
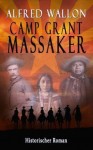
Schreibe einen Kommentar