Der Rabe der Reynard
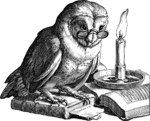 Percy Bolingbroke Saint John
Percy Bolingbroke Saint John
Der Rabe der Reynard
Eine Geschichte aus Prairie du Chien
Aus: Chambers Edinburgh Journal. 1846
In der Nähe des Zusammenflusses des Wisconsin mit dem großen Vater der amerikanischen Flüsse und nicht weit entfernt von dem Dorf Painted Rock und Fox am Turkey River gründeten die Franzosen 1783 eine Siedlung und nannten sie nach einer Familie von Les Renards, die als Dogs bekannt waren, das Dorf Prairie du Chien. Heutzutage ist der Ort als Station für die Reisenden auf dem Mississippi berühmt, aber zu der Zeit, von der wir schreiben, war er ein entfernter und wenig besuchter Außenposten im Herzen des Indianerlandes. Die Prärie, auf der das Dorf liegt, wird im Rücken von hohen, kahlen Hügeln begrenzt, an deren Fuß damals eine Gruppe von Les Renards – später Fox genannt – lebte. Die wichtigsten Siedler in Prairie du Chien waren die Giards, die Antayas und die Dubuques. Der Posten wurde von einem Offizier mittleren Alters namens Joseph Rienville befehligt. Dieser Joseph Rienville hatte vor Kurzem von der Ankunft seiner Frau und seines einzigen Kindes in Natchez erfahren, wo sie jeden Tag von einem Boot erwartet wurden, das in regelmäßigen Abständen zu der jungen Siedlung reiste.
In der Morgendämmerung verließ Capitaine Rienville mit einem Gewehr auf der Schulter das Dorf, nur begleitet von zwei Lieblingshunden, um in den benachbarten Wäldern auf die Jagd zu gehen. Sein Ziel war jedoch ein anderes; es war eines, das ihm schon seit einiger Zeit vorschwebte und das er angesichts der nahenden Ankunft seiner Familie mehr denn je zu verwirklichen gedachte. Etwa eine halbe Meile vom Dorf entfernt, an den Ufern eines klaren Baches gelegen und auf drei Seiten von Platanen, Zedern und Kiefern umgeben, befand sich eine schöne Prärie, die sanft zum Wasser hin abfiel. Es war ein wahrhaft exquisiter Ort, den das Auge eines jeden Naturliebhabers sofort als Wohnsitz ausgewählt hätte. Auch der Boden war äußerst fruchtbar, wie die üppige Vegetation, die blühenden und duftenden Blumen reichlich bewiesen. Rienville hatte es sich in den Kopf gesetzt, hier ein Haus zu bauen und die natürlichen Wiesen in fruchtbare Felder zu verwandeln. Der Stolperstein, der ihm immer im Weg gestanden hatte, war die Anwesenheit einer kleinen Gruppe freundlicher Indianer gewesen, deren Wigwams anmutig über die Fläche verstreut waren und die von dem berühmten Raven of the Reynard befehligt wurden, einem jungen Häuptling, dessen Tapferkeit und Energie ihn von einem einfachen Tapferen zum Befehlshaber einer erlesenen Kriegergruppe erhoben hatte. Nach einem Spaziergang, bei dem der Capitaine alle erdenklichen Möglichkeiten durchdachte, um in den Besitz des Waldes zu gelangen, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen, außer dem, dass Gewalt notwendig sein könnte, kam er an einer plötzlichen Biegung des Weges in Sichtweite des Indianerdorfes.
Keine 22 Yards vom Wald entfernt stand ein Wigwam von recht stattlicher Größe, vor dem eine Gruppe sofort die Aufmerksamkeit des Capitaines auf sich zog. In seiner Nähe stand, auf eine Muskete gestützt, die aufrechte Gestalt des Raven of the Reynard. Er war etwa dreißig Jahre alt und seine Proportionen, die durch seine spärliche Kleidung anmutig hervorgehoben wurden, waren außerordentlich perfekt. Seine Gliedmaßen waren rund und schienen voller Kraft und Beweglichkeit zu sein. Um seinen Hals trug er eine Kette aus schwarzen Bärenkrallen, ein zotteliger Mantel aus demselben Tier bedeckte seine Schultern, während eine Tunika und Mokassins aus Hirschleder sein Gewand vervollständigten. Sein Gesicht war auffallend, obwohl hohe Wangenknochen und ein niedriger, zurückweichender Vorderkopf es weniger attraktiv machten, als es sonst hätte sein können. Auf einem großen gefällten Baum in der Nähe saß ein Weißer, mit dem Rücken zum Capitaine, und unterhielt sich mit einem Indianerjungen. Eine junge Squaw, die Petit Gris der Reynard und Ehefrau des Raben, ging emsig im Zelt ein und aus.
Der Capitaine trat ein paar Schritte vor und sprach den Indianerhäuptling in freundlichem Ton an. Ohne auf das Thema einzugehen, das ihm hauptsächlich am Herzen lag, sprach er von der voraussichtlichen Ankunft seiner Familie, von der vorzüglichen Jagdsaison und verschiedenen anderen Dingen, auf die der Häuptling höflich antwortete.
Schließlich sagte er, ermutigt durch die ruhige und bescheidene Art des Reynard, etwas lauter als bisher: »Nun, Rabe, es tut mir leid, dass du so kurzfristig umziehen musst, aber ich habe vor, auf dieser Prärie zu bauen und eine Farm zu gründen. Wenn du also so bald wie möglich ein neues Lager errichten könntest, wäre ich dir sehr dankbar.«
Ohne sich zu rühren und scheinbar ohne zu verstehen, grunzte der indianische Häuptling ein ausdrucksstarkes Ugh!
Capitaine Rienville drückte daraufhin deutlicher aus, was er meinte.
Der Rabe ließ, sobald er begriffen hatte, was der andere meinte, ein leicht sarkastisches Lächeln über seine Züge huschen und fügte dann hinzu, dass es ihm leidtäte, seinen großen skalpierten Vater (Rienville hatte eine Glatze) zu verärgern, aber das Lager sei gut, und er sei keineswegs geneigt, es zu wechseln.
Das Gesicht des Franzosen errötete, als er antwortete: »Aber, Indianer, ich sage dir, dass es so sein muss, und dass ich auf keine deiner Ausreden hören werde. Ich brauche das Land, und ich muss es haben.«
In den Augen des Reynard leuchtete ein fast grimmiger Ausdruck auf. Er richtete sich auf und sagte: »Mein Vater soll seine Krieger mitbringen und versuchen, die Wigwams des Raben zu erobern.«
»Aber, Capitaine Rienville«, sagte der Weiße, der bisher ein schweigsamer Zuhörer gewesen war, »wollen Sie dem Häuptling keine Entschädigung dafür anbieten, dass er diesen schönen Ort verloren hat?«
»Antoine Giard«, antwortete der zornige Soldat, »ich sage Ihnen, dass überall im Wald Land zu finden ist und der Indianer sich ein anderes Lager suchen muss.«
»Nicht, solange ich eine Stimme und einen rechten Arm habe«, antwortete der junge Franzose und erhob sich. »Ich werde nicht zusehen, wie ein so großes Unrecht begangen wird.«
»Und du sprichst so mit mir, Antoine?«, rief der Capitaine aus, der sich ihm näherte und leise sprach. »Man sagt, du strebst nach der Hand meiner Tochter; noch ein solches Wort, und sie ist für dich für immer verloren.«
»Capitaine Rienville«, sagte der Jüngling, errötete und sprach ebenfalls leise, »ich liebe Eure Tochter, und sie erwidert meine Zuneigung, aber niemals werde ich mir Eure Gunst erkaufen, indem ich Unterdrückung und Grausamkeit dulde. Bitte, gebt dem Häuptling, der mein Freund ist, eine angemessene Entschädigung, und ich werde mich verpflichten, mit ihm zu reden.«
»Niemals!«, rief der Soldat. »Das Land werde ich haben, wenn ich den Raben und seine Bande ausrotte.«
»Der weiße Mann sollte besser nach Hause gehen«, sagte der Rabe leise, »oder vielleicht geht die indianische Waffe von selbst los.«
Der Capitaine erschrak und mäßigte sofort seinen Tonfall, während Antoine Giard nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Indianer, der seine Worte kalt aufnahm, seinen zukünftigen Schwiegervater am Arm nahm und ihn von einem Ort wegführte, an dem es für ihn gefährlich gewesen wäre, zu bleiben.
Kaum waren die beiden Weißen außer Sichtweite, rief der Rabe einen seiner wichtigsten Gefolgsleute herbei, mit dem er die Maßnahmen besprach, die zu ergreifen seien, um den von Rienville angedrohten Fall zu verhindern. Der Indianer war ein alter, hässlicher, aber erfahrener Krieger, der in viele Kämpfe mit den Franzosen verwickelt gewesen war, die keine sehr angenehmen Erinnerungen zurückgelassen hatten. Er war daher nur zu bereit, einen Angriff auf das Dorf Prairie du Chien und die Ausrottung aller Einwohner vorzuschlagen. Der Rabe hörte sich seine heimtückischen Ratschläge eine Zeit lang mit Widerwillen an, aber der listige Alte brachte seine ganze wilde Beredsamkeit zum Einsatz, vergrößerte die Beleidigungen, übertrieb die Versäumnisse, malte den Verlust ihres Lagers in glühenden Worten aus und verletzte den Stolz seines Häuptlings so stark wie möglich. Schließlich erhob sich der Rabe, und aus seinem Mund kam der Befehl, dass alle Franzosen umkommen sollten. Daraufhin erteilte er rasche Befehle, schickte Boten aus, um Hilfe von den benachbarten Stämmen herbeizurufen, und handelte insgesamt mit einem Elan und einer Schnelligkeit, die nur noch von der Eile übertroffen wurde, mit der seine Anweisungen befolgt wurden. Sobald alles vorbereitet war, begab sich der Krieger zu seinem Wigwam, wo die junge, bräunliche Schönheit, die ihn Herr nannte, sein Kommen erwartete. Der Rabe teilte seiner Frau mit, dass das Kriegsbeil ausgegraben und der Kriegspfad eingeschlagen worden sei und dass er sich von dieser Stunde an der Vernichtung der Weißen widmen werde. Er forderte sie auf, sich mit den anderen Frauen und den alten Männern in die Berge zurückzuziehen, wohin er bald kommen würde, geschmückt mit den reichen Trophäen des Sieges. In seinem Tonfall lag ein Hochgefühl, das seinen Kummer über die Trennung verbergen sollte, aber seine Gefühle waren vor dem scharfen Auge der Zuneigung nicht verborgen, und die Petit Gris war glücklich, denn sie wusste, dass ihr Mann sie liebte. Sie trennten sich. Der Häuptling ging allein den Pfad entlang, der zum Dorf führte, und seine Squaw war mithilfe von zwei Apachensklaven damit beschäftigt, das Zelt abzubauen und andere Vorbereitungen für die Abreise zu treffen.
Der Rabe war noch nicht viele Minuten auf dem ausgetretenen Pfad unterwegs, als er hinter und vor sich die schweren Schritte von bewaffneten Männern hörte. Sein scharfes Ohr erkannte, dass eine Gruppe seine Wigwams über einen niedrigeren Weg erreicht hatte, während eine andere auf dem Weg vorrückte, dem er selbst folgte. Es dauerte nur einen Augenblick, bis Capitaine Rienville mit etwa zwanzig Gefolgsleuten und in Begleitung von Antoine Giard auftauchte, der zurückblieb, als ob er sich vor ihrem Vorhaben ekelte und durch seine Anwesenheit jeden Exzess zu verhindern suchte. Der Anführer wies seine Männer mit einer Strenge an, die nichts Gutes verhieß, und rief ihnen zu, vorzurücken, und ließ Antoine schnell allein zurück. Auch er wollte gerade weitergehen, als ihn das Krächzen eines getigerten Raben innehalten ließ, und im nächsten Moment standen Reynard und er Seite an Seite. Der junge Franzose erklärte schnell, dass Rienville beschlossen hatte, die Wigwams sofort anzugreifen und damit den Streitfall zu entscheiden.
»Ugh«, sagte der Rabe, »er wird Squaws finden; mit ihnen wird er sehr tapfer sein.«
»Und deine jungen Männer?«, fragte Antoine.
»Einige sind gegangen, um mehr Krieger zu rufen, die meine Wigwams verteidigen, andere, um die Boote zu holen, in denen die Frauen des skalpierten Häuptlings sind!«
»Der Himmel bewahre!«, rief Giard und wurde blass, »sie werden den Frauen doch nichts tun?«
»Sie haben Krieger in den Booten, und meine jungen Männer werden schießen; sie werden nicht sehen, wenn sie schießen, ob es Männer oder Frauen sind.«
»Der Rabe der Reynard«, rief der junge Mann mit einer Ernsthaftigkeit und Feierlichkeit, die die Aufmerksamkeit des Häuptlings fesselte, »in diesen Booten ist mehr als mein Leben. In dem einen ist Marie Rienville, die ich liebe und schon lange liebe. Wir sind Freunde; wenn sie stirbt, hasse ich dich, und du bist für immer mein Feind. Ich werde mich in einen Wolf verwandeln und weder dich noch die deinen würde ich in meinem Zorn verschonen.«
»Ugh«?, sagte der Indianer tief bewegt, »geh und sieh zu, dass der Petit Gris nicht verletzt wird, und das Mädchen soll gerettet werden.« Mit diesen Worten stürzte der Rabe der Reynard in den Wald, während Antoine Giard zum Ort des Geschehens eilte.
Jeder Wigwam stand in Flammen, mehrere der alten Männer und Frauen waren verwundet, und zwei oder drei umringten die Petit Gris, an der Capitaine Rienville als Frau des Raben seine Enttäuschung und Rache ausüben wollte. Wie weit ihn seine heftigen Fieberschübe getrieben haben mögen, lässt sich nicht sagen, denn gerade als er seine Befehle erteilen wollte, stürzte Antoine vor, schlug die Arme derer nieder, die sie festhielten, und schrie: »Halt, du Verrückter; deine eigene Frau und dein eigenes Kind und die vieler anderer sind in den Händen des Raben!«
Der Capitaine und mehrere der bewaffneten Kolonisten schwankten tatsächlich vor Entsetzen, während sich allen die schreckliche Vorstellung von der Vergeltung der Indianer aufdrängte. Sie hatten eine friedliche Siedlung angegriffen und zerstört, hatten alte Männer und Frauen erschossen und verwundet, und nun befanden sich die Boote, die lange abwesende Familien in ihre neue Heimat und zu ihren Ehemännern und Vätern brachten, in den Händen des Mannes, den sie sich zum Feind gemacht hatten. Capitaine Rienville stand da wie ein verurteilter Verbrecher, der auf sein Todesurteil wartet. Er erkannte nun die ganze Ungeheuerlichkeit seines Verhaltens und bat Giard, von Scham und Trauer überwältigt, um eine Erklärung. Der junge Mann tat dies und schlug vor, dass die ausgewählten jungen Leute der Gruppe sofort an Bord gehen und die Boote unterstützen sollten. Rienville, der keine Anstalten machte, das Kommando zu übernehmen, willigte ein, und die Indianer wurden sofort mit einer Eskorte in das Dorf Prairie du Chien gebracht. Antoine schiffte sich daraufhin mit einer tapferen Truppe auf dem Fluss ein und kam mithilfe der Strömung schnell flussabwärts voran. Antoine war nicht ohne Hoffnung, dass er auf die Boote treffen würde, bevor die Indianer sie auf dem Landweg erreichen konnten, und trieb deshalb seine willigen Ruderer zu Höchstleistungen an. Etwa drei Stunden nach Sonnenuntergang hielten sie jedoch an und legten sich kurz zur Ruhe, bereiteten sich aber beim ersten Anflug von Morgengrauen wieder auf den Aufbruch vor. Gerade als sie den ersten Ruderschlag setzten, kam ein Boot um eine Kurve und in Sicht, als ob es um das Leben seiner Besatzung rang. Mit großer Spannung warteten sie auf das Erscheinen des zweiten Bootes, ihres Begleiters. Es war jedoch nur eines. Antoine fühlte, wie ihn eine tödliche Übelkeit überkam, als er sah, dass es sich bei dem einen Schiff nur um Männer handelte. Als sich die Rettung näherte, stießen die jungen Männer einen lauten Jubelschrei aus, doch die Flüchtlinge antworteten nicht, sondern kamen bleich, niedergeschlagen und mit abgewandtem Blick daher. Sie waren am Abend zuvor angegriffen worden, und das zweite Boot befand sich in Küstennähe. Bei der ersten Salve hatten sich die Passagiere, vor allem Frauen, alarmiert erhoben, und im Nu war das Boot gekentert. Sie sahen nichts mehr, da sie zu sehr damit beschäftigt waren, sich nach oben zu kämpfen und ihr eigenes Leben zu retten. Sie waren sich jedoch sicher, dass alle durch die Hand der Indianer oder durch die Fluten des Flusses umgekommen waren. Von plötzlichem Kummer erdrückt, gab Antoine den Befehl, zurückzukehren und die traurige Nachricht in die Siedlung zu bringen.
Es war schon spät am Abend, als sie die Anlegestelle von Prairie du Chien erreichten. Es war ein wunderschöner Ort, der auf beiden Seiten von Bäumen beschattet wurde, da man einen Platz freigemacht hatte, um das Wasser zu erreichen. Die Boote wurden dicht ans Ufer gezogen, und die melancholische Gruppe wandte ihre Schritte in Richtung des Dorfes, als plötzlich ein unbewaffneter Indianer in düsterer Gestalt aus seinem Versteck auftauchte – es war der Rabe!
Er kam auf Antoine zu, legte ihm schwer die Hand auf die Schulter und sagte: »Die Wasser des Vaters der Flüsse seufzen über dem Grab des weißen Mädchens; sie ist ertrunken, aber der Rabe der Reynard hat ihren Tod verursacht; er ist hier, um seinem Freund das Leben zu schenken! Von diesem untrüglichen Beweis für die Trauer des Kriegers über seine Tat getroffen, hätte der junge Mann ihn gerne in die Flucht geschlagen, aber es war zu spät; die Männer schlossen sich streng um ihn und führten ihn gefangen zu Rienville.
Der Capitaine, der Schlimmes erwartete, hörte die Einzelheiten der Ereignisse mit wilder Gelassenheit, und als sie alles erzählt hatten, lächelte er bitter und rief: »Ja, ja, er wird schnell genug sterben, aber nicht jetzt; er wird Zeit haben, darüber nachzudenken. Im Morgengrauen wird er sterben, und mit ihm seine Squaw. Er hat mir Frau und Kind geraubt – ich werde keine Gnade mit ihm haben.«
Der Indianer erwiderte dies mit einem verächtlichen Lächeln und folgte seinen Wächtern in die Hütte, die für seinen Empfang vorgesehen war. Seine Frau, die sich bei seiner Ankunft unter die Menge gemischt hatte und alles mitbekommen hatte, war nirgends zu finden. Als der Rabe dies hörte, senkte er sein Haupt; denn sie, die er in seinen letzten Stunden allein zu sehen wünschte, hatte ihn verlassen und im Stich gelassen. Mürrisch und unglücklich setzte er sich auf einen Baumstamm, äußerlich streng und kalt, aber innerlich traurig; denn in der Trauer und in der Gefahr begehren wir am meisten die Zuneigung und die Gesellschaft eines Menschen, der uns wie eine geliebte Frau mehr bedeutet als wir selbst. Die Nacht verging, und der Morgen brach an – der Morgen, an dem der französische Kommandant ihn dazu verurteilt hatte, den Tod eines Mörders zu erleiden. Der Rabe der Reynard erschien an der Tür seines Wigwams, aufrecht, fest, gesammelt, als hätte er mit der Welt abgeschlossen.
Bevor jedoch irgendwelche Vorbereitungen getroffen werden konnten, bevor Antoine, der halb gebrochenen Herzens war, sein beabsichtigtes Plädoyer für das Leben des Indianers beginnen konnte, erhob sich aus dem Wald ein Wehgeschrei, halb vor Freude, halb vor Schmerz, und im nächsten Augenblick kam der gelbbraune Petit Gris auf die Prärie, halb eine weibliche Gestalt tragend, halb schleifend. In schlammdurchtränkten und nassen Kleidern, mit nackten Füßen, mit zerzaustem und verfilztem Haar und zerfetzten Kleidern, während ihr bleiches und verschmiertes Gesicht kaum wiederzuerkennen war, stand Marie Rienville vor ihrem Vater und Geliebten, der ihre ohnmächtige Gestalt in die Arme nahm.
»Mein Kind«, rief der Capitaine tief bewegt, »sie ist gerettet, aber nicht meine Frau!
»Auch die Squaw ist gerettet«, sagte der Petit Gris eilig, damit die Tatsache, dass seine Tochter allein gerettet war, nicht ausreiche, um ihren Mann aus der Lage zu befreien, in die er sich aus freundschaftlichen Gefühlen zu Antoine freiwillig gebracht hatte.
Als das Boot umkippte, waren die Indianer nämlich so sehr damit beschäftigt, die Männer zu retten, um sich die übliche schreckliche und ekelhafte Trophäe zu sichern, dass sie die Flucht der meisten Frauen, die ins seichte Wasser gefallen waren, zunächst nicht bemerkt hatten. Als sie sich umdrehten, um nach ihnen zu suchen, war es Abend, und keine einzige Frau war in Sicht. Der Rabe stand außer Atem und furchtbar wütend am Ufer. Als jedoch der Rabe der Reynard zum Tode verurteilt wurde, hatte sich seine junge Frau, überzeugt, dass einige von ihnen entkommen sein könnten, in der Verwirrung davongeschlichen und eilte in Richtung des letzten Schauplatzes des Konflikts, wo sie glücklicherweise auf die Gruppe der Frauen traf, die erschöpft und müde in Richtung Prairie du Chien unterwegs waren.
Für das, was geschehen war, gab es kein Heilmittel. Capitaine Rienville, der durch seine Niederlage ernüchtert war, erklärte sich auf die ernsthafte Bitte von Antoine Giard bereit, mit dem Raben der Reynard einen feierlichen Friedensvertrag zu schließen, mit dem Versprechen, dass er an seinem Standort niemals belästigt werden sollte. Daraufhin zog sich der Rabe in sein Haus zurück, das er mit einer für einen Indianer erstaunlichen Nachsicht ohne Murren wieder aufbaute. Es dauerte lange, bis Marie oder auch nur eine der Frauen sich von der Szene im Boot erholte. Die Salve der Indianer, das Hervorspringen der scheußlich bemalten Krieger, der Sturz in den Fluss, das Ringen um das Ufer, die Nacht im Wald, in dem sie umherwanderten, ohne zu wissen wohin, in ständiger Angst, eingeholt zu werden, waren Dinge, die nicht so schnell aus ihrem Gedächtnis gelöscht werden konnten.
Am Ende von etwa sechs Monaten überzeugte Antoine Giard Marie jedoch, dass sie so gesund, so reizend und so charmant war, wie sie es in ihrem Leben noch nie gewesen war – ja, er fand sogar, dass sie noch reizvoller war – und dass es daher keine bessere Gelegenheit geben könnte, ihn glücklich zu machen. Marie meinte, da es ihr so gut ginge, wüsste sie nicht, warum sie sich ändern sollte, nannte aber schließlich einen Tag. Sie heirateten, und bei ihrer Hochzeit waren der Indianer und seine Frau anwesend. Es war eine fröhliche Hochzeit, und die Geschenke der Freunde an das glückliche Paar waren zahlreich und vielfältig. Am Nachmittag wurde mit Sport und Zeitvertreib begonnen, und als Ort wurde das Lager der Indianer gewählt. Dorthin eilte das ganze Dorf, während der Capitaine, seine Familie und die Neuvermählten folgten. Die Ebene war menschenleer, kein einziger Wigwam war zu sehen, die Füchse hatten sich ein anderes Zuhause gesucht, und Rienvilles lang gehegter Wunsch war in Erfüllung gegangen. Was er mit Gewalt und in Feindschaft nicht erlangt hatte, war seiner Tochter unter dem sanften Einfluss der Freundschaft zuteilgeworden. Es war das Hochzeitsgeschenk des Raben der Reynard.
Ende
Schreibe einen Kommentar