Aus dem Wigwam – Oeche-Monesah oder der Wanderer
Karl Knortz
Aus dem Wigwam
Uralte und neue Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer
Otto Spamer Verlag. Leipzig. 1880
Noch vierzig Sagen
Mitgeteilt vom Navajohäuptling El Zol
Oeche-Monesah oder der Wanderer
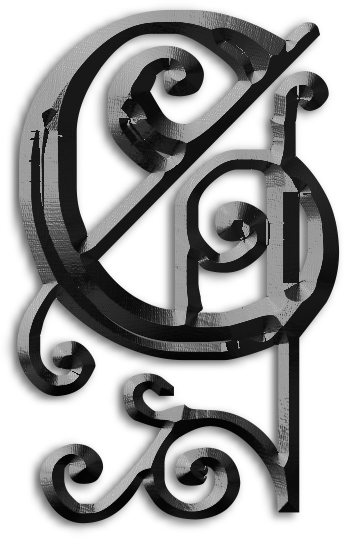 haske war des ewigen Einerlei seines Dorflebens müde geworden und beschloss, eine weite Reise zu unternehmen, um Abenteuer aufzusuchen.
haske war des ewigen Einerlei seines Dorflebens müde geworden und beschloss, eine weite Reise zu unternehmen, um Abenteuer aufzusuchen.
Er brachte also eines Morgens früh seine Waffen in Ordnung und schoss einen Pfeil in die Richtung, die er einschlagen wollte.
»Ich werde jetzt meinem Pfeil folgen«, sagte er zu sich selber, aber es schien eine Unmöglichkeit zu sein, ihn wiederzufinden. Trotzdem marschierte er rüstig weiter. Als ihn aber die Moskitos endlich zu viel quälten, suchte er sich einen Ruheplatz aus und machte ein Feuer an, um jene lästigen Insekten zu vertreiben. Nun wollte er sich auch etwas zu essen suchen. Wie er so im Gebüsch nach Wild herumspähte, fiel sein Blick auf einen frisch getöteten Hirsch. Als er denselben näher betrachtete, sah er, dass sein Pfeil darin steckte. Er schnitt dem Hirsch die Zunge aus. Während er damit beschäftigt war, sie zu rösten, wurde er plötzlich so müde, dass er sich hinlegte und einschlief.
Beim Anbruch des nächsten Tages wurde Chaske geweckt. Als er sich den Schlaf aus den Augen gerieben hatte, sah er eine Frau vor sich stehen, welche nach der Prärie deutete. Er stand auf und folgte ihr.
Unterwegs kam es ihm sehr sonderbar vor, dass sie kein Wort sprach.
»Ich muss sie doch fragen, wer sie ist«, sagte er, doch als er sie anreden wollte, streckte sie auf einmal ihre Arme hoch in die Luft und verwandelte sich in einen schönen blauen Vogel. Chaske war wie aus den Wolken gefallen, aber es freute ihn doch, denn er war auf Abenteuer ausgegangen. Er schoss also einen zweiten Pfeil ab und folgte ihm. Spät am Abend fand er ihn wieder, und zwar in dem Herzen eines Elentieres steckend.
»Diesmal sott mir das Abendessen nicht vereitelt werden«, sagte er, schnitt dem Tier die Zunge heraus und machte ein Feuer an. Dabei überfiel ihn indessen abermals eine solche Müdigkeit, dass er sich schlafen legen musste.
Am nächsten Morgen wurde er wiederum durch eine Frau geweckt, die ihm die Richtung zeigte, welcher er folgen sollte. Diesmal war er etwas dreister und fasste die Frau beherzt am Arm, um ein Gespräch mit ihr anzufangen und herauszufinden, wer sie eigentlich sei. Sie drehte sich herum und verwandelte sich in demselben Augenblick in eine Krähe.
Dies war dem Dakota doch ein wenig zu bunt. An den Frauen war ihm nie etwas gelegen; ja, er hatte sogar stets ihre Gesellschaft gemieden und nie seine Zeit damit vergeudet, ihnen allerlei angenehme Dinge zu sagen. Nun hielten sie ihn in der Fremde zum Narren! Er marschierte also weiter und dachte darüber nach, wie es käme, dass sich bisher noch kein Dakotamädchen in einen Vogel verwandelt habe und fortgeflogen sei.
Am nächsten Tag schoss er einen Bären. Als er sich dessen Zunge rösten wollte, fiel er wieder in einen tiefen Schlaf, aus dem er durch ein Stachelschwein geweckt wurde.
Am vierten Tage fand er seinen Pfeil im Körper eines Büffels. »Nun will ich aber einmal tüchtig essen«, sagte er, »und dann auch herausfinden, wer es eigentlich ist, der mich weckt.« Doch er fiel wie gewöhnlich vor dem Essen in Schlaf und wurde durch ein Mädchen geweckt, das ihm den Rücken zudrehte und ihm den Weg zeigte. Anstatt ihr aber zu folgen, nahm er sie beherzt in seine Arme und war fest entschlossen, sie nicht eher loszulassen, bis sie ihm die verlangte Auskunft gegeben hätte. Ihr Gesicht war so weiß wie Schnee und ihr Haar hing in goldenen Locken auf ihre Schultern herab.
»Lass mich los«, flehte sie. »Ich bin eine Biberfrau und du bist ein Dakotakrieger. Lass mich los und suche dir eine Frau bei deinem Stamm!«
»Jene Mädchen habe ich immer verachtet«, erwiderte er, »aber da du noch viel schöner als die Wassernymphen bist, so musst du meine Frau werden!«
»Dann aber musst du deine Nation auf immer verlassen, denn ich kann nicht leben wie die Dakotafrauen. Komm also mit zu meiner weißen Hütte und lass uns glücklich sein. Sieh, wie schön dort das Wasser von den Felsen stürzt. In der Hitze des Tages werden wir uns an den Fällen abkühlen und am Abend werden uns die Wellen in den Schlaf lullen!«
Darauf nahm sie Chaske und führte ihn in ihre weiße Hütte, wo sie blieben und glücklich waren.
Im nächsten Jahr lachte zur größten Freude der Eltern ein munterer Knabe im Wigwam.
Eins jedoch machte dem Dakota viel Kopfzerbrechen — seine Frau aß nie mit ihm zusammen. Wenn er am Abend von der Jagd zurückkehrte, empfing sie ihn immer freundlich und kochte ihm, während er seine Pfeife rauchte, sein schmackhaftes Abendessen. Wenn er sie aber bat, mitzuessen, sagte sie stets, sie sei nicht hungrig, und suchte sich dann gewöhnlich eine andere Beschäftigung.
Chaske nahm sich nun vor, um jeden Preis herauszufinden, wovon sie eigentlich lebe. Als er eines Morgens wieder mit Pfeil und Bogen auf die Jagd gegangen war, kehrte er auf halbem Weg wieder um und versteckte sich im Gebüsch, um sie unbemerkt beobachten zu können. Bald danach verließ sie mit einer Axt ihre Hütte und schritt einigen Weidenbäumen zu. Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass niemand in ihrer Nähe war, hieb sie mehrere Äste und Zweige ab, trug sie nach Hause und aß sie mit großem Wohlbehagen auf. Darüber wunderte sich Chaske sehr und dachte, da sei doch Wildbret eine bessere Speise. Aber als guter Ehemann ließ er ihr ihren Willen. Als er am Abend nach Hause kam und sein Wild abgeliefert hatte, ging er, während sie das Abendessen bereitete, in den Wald und schnitt eine Anzahl junger Weidenbäumchen um und brachte sie ihr.
»Ich habe endlich herausgefunden«, sagte er, »wovon du lebst.« Diese Bemerkung schien der Biberfrau durchaus nicht angenehm zu sein, denn sie machte ihrem Gemahl zum ersten Mal ein böses Gesicht, nahm ihr Kind auf den Arm und verließ die Hütte. Chaske ahnte nichts Böses; er aß ruhig zu Abend und dachte, bis er fertig sei, sei sie auch wieder in guter Laune zurückgekehrt. Doch da irrte er sich und war gezwungen, sich nach ihr umzusehen. Er marschierte die ganze Nacht durch, fand aber keine Spur von ihr.
Am nächsten Morgen kam er an einen Biberdamm und sah, wie seine Frau mit dem Kind auf dem Arm darauf saß.
»Warum hast du mich verlassen?«, rief er, »ich wäre vor Kummer gestorben, wenn ich dich heute nicht gefunden hätte!«
»Habe ich dir nicht gesagt, dass ich nicht wie die Dakotafrauen leben kann? Du hättest nicht danach forschen sollen, was ich esse. Geh zu deinem Volk zurück; dort wirst du genug Frauen finden, welche Wildbret essen!«
Der kleine Knabe klatschte vor Freude in die Hände, als er seinen Vater sah und wollte zu ihm, aber seine Mutter ließ ihn nicht aus den Armen. Endlich band sie ihm einen Strick an den rechten Fuß und ließ ihn ins Wasser springen, damit er zu seinem Vater schwimme. Sobald er aber in der Nähe des Ufers war, zog sie ihn wieder zurück.
Chaske bot sein ganzes Rednertalent auf, seine Frau zu bewegen, wieder zu ihm zu kommen, aber sie gab ihm gar keine Antwort und kämmte still ihr langes blondes Haar. Das Kind hatte sich mittlerweile müde geschrien und war eingeschlafen. Auch Chaske wurde müde und legte sich nieder.
Nach einer Weile trat eine Frau zu ihm und weckte ihn auf. Da er aber sah, dass es nicht die geliebte Mokassinblume war, nahm er wenig Notiz von ihr.
»Warum«, fragte sie, »liebt ein Dakota eine Frau, die ihn hasst?«
»Die Mokassinblume liebt mich und ist mir stets eine treue, liebevolle Frau gewesen.«
»Ja, gewesen; da hast du recht. Nun aber sehnt sie sich nach ihrer Heimat und nach ihrem früheren Geliebten zurück.«
Chaske geriet in großen Zorn. »Sollte dies möglich sein?«, sprach er und blickte hinüber zu dem Biberdamm, wo sie noch immer saß.
Die Frau neben ihm brachte ihm Speise in einer Birkenschüssel und sprach: »Iss, Dakota, denn du bist hungrig!«
Als dies die Mokassinblume sah, schrie sie laut: »Quäle meinen Gemahl nicht länger; ich kenne dich wohl, du bist die Bärenfrau!«
»Und wenn ich es bin«, erwiderte jene, »so musst du wissen, dass die Bären zum Paradies der Dakota Zutritt haben!«
Der arme Chaske ließ die Frauen zanken und aß. Als er fertig war, sagte seine Wirtin zu ihm: »Komm mit mir, denn du kannst doch nicht im Wasser leben. Ich führe dich zu meiner Hütte, in der wir glücklich sein wollen.«
Er sah sich nach seiner Frau um, aber da sie ihn nicht ermutigte, bei ihr zu bleiben, sagte er: »Ich war immer ein Freund von Abenteuern und will nun wieder auf welche ausziehen.«
Danach folgte er der Bärenfrau, trotzdem sie nicht halb so schön war wie die Mokassinblume. Auch war sie so voller Launen, dass er fast keine ruhige Stunde mehr hatte. Derjenige, der so früher die Dakotamädchen verhöhnt hatte, war nun der Sklave einer Bärenfrau. Glücklicherweise waren keine Krieger in der Umgegend, und so war er sicher, dass er nicht ausgelacht wurde.
Im nächsten Jahr gebar die Frau Zwillinge; das eine Kind war ein schöner Dakotaknabe und das andere ein lebhafter kleiner Bär. Es war sehr unterhaltend, die beiden miteinander spielen zu sehen, doch bei ihren häufigen
Balgereien zog der Bär jedes Mal den Kürzeren und musste zuletzt stets Schutz bei seiner Mutter suchen. Dies schien jener nun durchaus nicht zu gefallen.
Eines Morgens stand sie sehr früh auf. Während sie ihrem Gemahl einen schlimmen Traum erzählte, wurde plötzlich Hundegebell in der Nähe der Hütte gehört.
»Was ist los?«, fragte Chaske.
»Ich weiß es«, erwiderte sie, »draußen steht ein Jäger, der mich töten will; aber ich fürchte mich nicht.«
Darauf streckte sie den Kopf aus der Tür und der Jäger, der dies bemerkte, schoss augenblicklich einen Pfeil darauf ab. Doch er traf sie nicht, und die Bärenfrau nahm ihr Kind auf den Arm und lief fort, so schnell sie konnte.
»Hm«, sprach Chaske, »ich hätte am Ende doch besser getan, ein Dakotamädchen zu heiraten. Die laufen doch erst dann von ihrem Mann weg, wenn dieser noch ein zweite Frau in den Wigwam bringt. Nun bin ich schon zweimal angeführt worden!«
Darauf nahm er seinen Knaben auf den Arm und folgte ihr. Gegen Abend erreichte er sie; aber sie freute sich durchaus nicht, ihn wiederzusehen.
Als er sie fragte, warum sie ihn verlassen habe, antwortete sie: »Ich wollte bei meinem Volk sein!«
»Gut«, sagte der Dakota, »dann gehe ich mit!«
Die Frau wars zufrieden, aber sie hätte doch lieber gesehen, wenn er wieder umgekehrt wäre. Den Datotaknaben würdigte sie nicht des geringsten Blickes.
Nach mehreren Tagesreisen kamen sie an ein Wäldchen, dessen Bäume einen großen Kreis bildeten.
»Dies ist das große Bärendorf«, sagte sie, »darin wohnen viele junge Männer, die mich einst liebten und dich nun hassen, weil ich dir den Vorzug gegeben habe. Nimm deinen Sohn und gehe zu deinem Volk zurück!«
Doch der Dakota fürchtete sich nicht und marschierte ruhig dem Bärendorf zu.
Seine Ankunft verursachte große Aufregung. Die Bären freuten sich, die Bärenfrau wiederzusehen, aber den Dakota hassten sie und beschlossen, ihn umzubringen. Doch sie empfingen ihn freundlich, führten ihn mit seiner Frau in eine Hütte und setzten ihnen Speise und Trank vor. Chaske fand bald heraus, dass er sich unter Feinden befand und hatte ein wachsames Auge auf sie.
Nun hatte sich sein Knabe eines Tages mit einem jungen Bären gezankt und ihn, als er nicht nachgeben wollte, mit einem Pfeil getötet und dann aufgegessen. Da hielten denn die Bären eine geheime Ratsversammlung ab und beschlossen, Vater und Sohn umzubringen.
Chaske hatte nun mit allen erdenklichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine Frau liebte einen Bären, wie er herausgefunden hatte, und versuchte seinen Tod herbeizuführen; aber jedes Mal, wenn er sich mit den Bären stritt, war er siegreich. Wenn sie um die Wette liefen, war er stets zuerst am Ziel; wenn sie schossen, war er immer der Beste, was natürlich die Wut seiner Feinde vergrößerte.
Nach vier Jahren kehrte Chaske wohlbehalten in sein Dakotadorf zurück. Als er seine Abenteuer erzählte, lachten ihn die Mädchen aus; eine Jungfrau aber lachte nicht.
Sie brachte ihm neue Mokassins und sagte: »Chaske, es gibt doch keine Mädchen, die so treu sind wie die Dakota. Ich wäre bis ans Ende der Welt mit dir gegangen, hättest du mich nicht stets zurückgestoßen, doch ich habe meine alte Liebe zu dir bewahrt und will dir, der du nun verlassen bist, in deiner Hütte das Feuer anmachen.«
Von seinen früheren Frauen erzählte Chaske nur, um sie mit seiner jetzigen zu vergleichen; jene waren ebenso treulos und unzuverlässig, wie diese gehorsam und gut.
Schreibe einen Kommentar
Schreibe einen Kommentar