Der Schwur – Dritter Teil – Kapitel 2
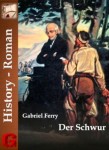 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Dritter Teil
Der See Ostuta
Kapitel 2
Der tollkühne Oberst
Der Teil des Berichts El Gaspachos, der sich auf den Obersten Tres-Villas bezog, lässt keinen Zweifel über den Zweck, zu welchem die acht Retter sich zu einer Beratung in einer Lichtung des Waldes der Ostuta zusammengefunden hatten, aufkommen.
Dies waren die Soldaten Arroyos, die sich zu einer Verfolgung aufgemacht hatten, während es, wie man sich aus den Worten Gaspachos erinnern wird, zehn sein sollten, waren es nur acht.
Bevor wir zur Erklärung dessen schreiten können, wie es sich zugetragen, dass sich ihre Zahl so vermindert hatte, müssen wir bis zu dem Augenblick zurückkehren, in dem Don Rafael das Schlachtfeld von Huajapam verlässt.
Als die Siegesgesänge der Soldaten Trujanos verstummt waren, überlegte Don Rafael, dass er, um allein seine Reise von fast dreißig Stunden durch ein fast ganz insurgiertes Land zu machen, zu gewissen Vorsichtsmaßregeln seine Zuflucht nehmen dürfe, von denen seine Sicherheit abhing.
Seine gestickte Uniform, sein Helm, kurz seine ganze Ausrüstung waren ganz dazu angetan, die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn zu ziehen. Zudem war er noch schlecht bewaffnet. Sein langer Dragonersäbel zerbrach während des Kampfes und es war dringend notwendig alledem abzuhelfen.
Er konnte es ebenso wenig wagen, zu seinem Zelt zurückzukehren, um sich neue Waffen zu holen und seinen Anzug zu wechseln, wie er hoffen konnte, dass es noch nicht wie alles im royalistischen Lager ausgeplündert sei. Dessen ungeachtet begab sich Don Rafael wieder zurück, in der Hoffnung, auf dem Schlachtfeld das, was er nötig hatte, zu finden. Seine Mutmaßung täuschte ihn kaum.
Ohne sich den Insurgenten so nahe zu wagen, dass er Gefahr lief, von Neuem angefallen zu werden, fand der Oberst weit auf dem von Huajapam entfernten Punkt, wo er und Caldelas den Stoß Morelos’ aufzuhalten gehabt hatten, einen zweischneidigen Degen, durch den er den seinen ersetzte. Er vertauschte dann seinen Helm mit dem Filzhut eines Insurgenten, dessen innere Wandung aus einem schmutzigen Lumpen bestand, der die Worte enthielt: Freiheit oder Tod! Er zerriss den Lappen, trat ihn unter die Füße und stülpte den Hut auf.
Statt seiner Uniform als Kavallerie-Offizier zog er die Jacke eines Infanteristen an. Nach dieser Ausstattung schlug er, obgleich sein Aufzug durch seine Zusammenstellung ziemlich merkwürdig war, nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass seine Pistolen im guten Zustand in den Holstern steckten und seine Patronentasche gefüllt war, den vorigen Weg wieder ein und trieb entschlossen sein Pferd an.
Wir übergehen die Einzelheiten aller der Vorsichtsmaßregeln, die der Oberst nehmen wollte, um nicht in die Hände des Teils der Insurgenten, der das flache Land durchzog, zu fallen, führen aber noch an, dass er nur des Nachts reiste.
Selbst das Reisen bei Nacht bot kein hinreichendes Mittel für seine Sicherheit dar. Der Oberst hatte mehr als ein Mal seiner Kaltblütigkeit bedurft, um sich aus misslichen Lagen zu ziehen.
Am Abend des dritten Tages nach seiner Abreise war er in der Dämmerung in die Nähe seines Besitztums gekommen und hoffte nun in einigen Minuten in Sicherheit zu sein, als zwei Posten der Bande Arroyos, die del Valle belagerte oder eigentlich blockierte, ihn bemerkten und sich auf ihn stürzten, um ihn gefangen zu nehmen.
Arroyo hatte befohlen, auf diese Weise beim Anblick eines jeden zu verfahren, der sich in der Nähe der Hacienda sehen ließe.
Ohne zu wissen, dass er mit den Soldaten des Guerilleros handgemein geworden war, den er von der Erde zu vertilgen geschworen hatte, war Don Rafael dennoch nicht der Mann, von irgendjemand einen so ungestümen und unhöflichen Angriff hinzunehmen. Wir wissen schon, wie es den beiden Angreifern erging, nur hatte El Gaspacho die Wahrheit in seinem Bericht ein wenig geschmückt.
Dem einen war die Schulter so nahe am Herzen zerschmettert worden, dass er seinen Geist aufgab, und was den anderen betrifft, so hatte der Oberst, bevor er ihn so unsanft zur Erde warf, die vorläufige Vorsicht gebraucht, ihm seinen Dolch zwischen die Schultern zu bohren.
Bei diesen Vorsichtsmaßregeln, sich vor der Geschwätzigkeit der beiden Banditen zu schützen, hatte der Oberst aber unglücklicherweise durch das Abfeuern seiner Pistole Alarm gemacht. Da die Belagerer den Befehl hatten, Tag und Nacht eine Anzahl Pferde vollständig gesattelt und gezäumt bereitzuhalten, so warfen sich ein Dutzend Reiter in den Sattel, als sie den Schuss vernahmen.
Der Oberst hatte einen Augenblick gezögert, unentschlossen, ob er seinen Weg fortsetzen oder wieder umkehren sollte, um dann zurückzukehren, wenn die Nacht dunkler geworden wäre. Dieser eine Augenblick der Unentschlossenheit war schuld daran, dass die Reiter, die sich auf seine Verfolgung gemacht hatten, ihn bemerken konnten. Einer unter ihnen, Pepe Lobos, erkannte ihn, ungeachtet der ziemlich vorgerückten Tageszeit zuerst an seiner Haltung und seinem Wuchs, dann auch an dem Schnauben seines Pferdes wieder.
Der Hass, den Arroyo gegen den Oberst gefasst hatte, war dessen Rettung. Einige Karabinerschüsse hätten ohne Zweifel seiner Laufbahn ein Ziel gesetzt, wenn nicht die Hoffnung auf eine ansehnliche Belohnung, die der wilde Bandit dem versprochen hatte, der ihm den Obersten lebend überlieferte, die Reiter bewogen hätte, seine Gefangennahme zu versuchen.
Der Oberst ergriff bei ihrem Anblick die Flucht in der begründeten Hoffnung, in der Mitte des Waldes, den er soeben verlassen hatte, einen für sein Pferd undurchdringlichen Schlupfwinkel zu finden. Er trieb sein Pferd heftig an und so gelang es ihm, vor seinen Verfolgern die krumme, mitten durch den Wald angelegte Straße nach Huajapam zu erreichen. Er jagte auf dieser Straße im gestreckten Galopp zurück. Als er glaubte, genug Vorsprung vor seinen Verfolgern erreicht zu haben, sprengte er in das tiefe Dickicht und hielt keinen Moment an, bis es ihm unmöglich war, in dem Unterholz, das ihm den Weg versperrte, weiter vorzudringen. Er sprang nun vom Pferd, zog dasselbe hinter sich her und gelangte an ein sehr dichtes Gebüsch, wo er es anband.
Dann beschäftigte er sich damit, eine Stelle aufzufinden, die ihm als Lager dienen könnte und auf dem er sich, ohne von seinen Feinden bemerkt zu werden, im Fall sie ihre Verfolgung fortsetzen sollten, einige Zeit ausruhen konnte.
Eine herrliche Zeder, deren dichtes Blattwerk, für das Auge undurchdringlich war, befand sich in der Nähe. Er beschloss, hinaufzuklettern. Obgleich er den ungeheuren Stamm nicht umspannen konnte, um bis in die Zweige zu klettern, so gelangte er dahin mithilfe einiger starken Lianen, die wie Tauwerk vom Gipfel des Baumes bis auf die Erde herabhingen.
Der Oberst platzierte sich so bequem wie möglich zwischen zwei dicke Zweige und beschloss dort den Tag zu erwarten, um einen Entschluss zu fassen. Er hoffte, dass entweder seine Feinde die Spur verlieren und dann von einer Verfolgung absehen würden, oder dass sie, um ihn zu umzingeln und den Rückzug abzuschneiden, von den Pferden steigen und sich trennen würden, indem sie zu zweit gingen.
In diesem letzteren Fall traute er sich hinter Bäumen gedeckt und durch das Dickicht geschützt, genug Kraft und Mut zu, um nicht zu verzweifeln, sie Mann für Mann niederzumachen.
Die Nacht war angebrochen und der Mond verbreitete vom Gewölbe des gestirnten Himmels herab seine Helligkeit. Einige Strahlen, die sich durch das dichte Laubwerk stahlen, warfen in das Versteck Don Rafaels’ ein schwaches Licht, der Abenddämmerung ähnlich, wenn ihre letzten Lichtwellen im Begriff sind, zu verschwinden.
Der Oberst horchte mit gespannter Aufmerksamkeit auf das leiseste Geräusch, das er zu vernehmen glaubte. Alles blieb, mit Ausnahme des Säuselns des Windes in den Blättern der Bäume und dem entfernten Bellen des Schakals, der Stimme des Spottvogels und dem leichten Rascheln einer Eidechse auf den dürren Blättern, ruhig und still.
Die frische und balsamische Luft, die Don Rafael einatmete, der Schleier der Nacht, der ihn rings umgab, diese großartige und feierliche Stille, die um ihn her herrschte, alles schien ihn einzuladen, sich den Annehmlichkeiten des Schlummers in die Arme zu werfen. Er fühlte seine Augenlider nach und nach schwerer werden und bald bemächtigte sich eine unwiderstehliche Mattigkeit seines ganzen Körpers.
Der durch die Ermattungen des Körpers und der Seele Erschöpfte bedarf der Ruhe, die gütige Vorsehung sendet ihm den Schlummer, um seine Kräfte zu ersetzen. In ihrer unaussprechlichen Güte sendet sie ihn auch manchmal dem Verurteilten in der seiner Hinrichtung vorangehenden Nacht, und nur in ihr kann man sich den tiefen Schlaf gewisser Eroberer erklären, die am nächsten Morgen die Herrschaft der Welt dem zweifelhaften Glück einer Schlacht anheimstellen.
Ohne gerade sehr besorgt zu sein, glaubte der Oberst doch, dass es die Klugheit erfordere, sich wach zu halten. Lange Zeit kämpfte er gegen den Schlaf, jedoch vergebens. Der Schlaf war der Stärkere. Nur wickelte er um einen starken Zweig des Baumes und um seinen Leib einen langen seidenen Gürtel, wie ihn noch heutzutage in jenem Land die Offiziere desselben Ranges tragen. Klugerweise hatte er sich diesen aufbewahrt und unter der Jacke verborgen.
Kaum sicherte er sich auf diese Weise gegen die Gefahren eines Herabfallens, als er auch sogleich auf seinem Baum in einen tiefen Schlaf versank.
Der größte Teil der Leute, die bei Arroyo Dienste genommen hatten, bestand aus Landleuten, die von klein auf dazu angewiesen waren, auf dem Boden alle Arten von Eindrücken zu unterscheiden. Wenn es nicht Nacht gewesen, wären sie gewiss nicht an der Stelle vorbeigeritten sein, wo der Oberst plötzlich die gebahnte Straße verlassen hatte, um sich in das Dickicht zu werfen, ohne sie zu bemerken. Bei dem ungewissen Licht des Mondes, das den Pfad nur durch die Lücken des Laubes beschien, waren die Person des Obersten und die Spuren seines Pferdes ihren Augen unsichtbar.
Schon waren sie eine tüchtige Strecke über die ersten Gebüsche hinaus, hinter denen Don Rafael verschwunden war, als sie instinktiv anhielten. Wenn sie alle zusammen in den Wald eindrangen, vergaben sie sich jeder Möglichkeit, den zu finden, den sie verfolgten, und deshalb trennten sie sich, wie es der Oberst vorausgesehen hatte, und drangen zu zweit in den Wald.
Sie bestimmten sich ein Gebiet zum Absuchen und trennten sich, nachdem sie noch untereinander verabredet hatten, sich nach Verlauf einiger Stunden in der Lichtung, nahe bei dem Weg, wo sie eben vom Pferd stiegen, zu treffen, um ihre Treibjagd zu beginnen.
Wenn auch mit großer Vorsicht, die der schreckliche Ruf, dessen Don Rafael genoss, zu rechtfertigen schien, so erfüllten sie doch im Anfang ihre Aufgabe ziemlich gewissenhaft. Nach und nach, als der erste Eifer ein wenig verraucht war, tauchte fast zu gleicher Zeit in allen derselbe Gedanke auf. Alle hatten gesehen, mit welcher entsetzlichen Leichtigkeit derselbe sich zweier von ihnen entledigte, und sie sahen ein, wie unrecht sie getan hatten, ihre Kraft durch eine derartige Teilung zu zersplittern. Da sie nun aber nicht daran denken konnten, sogleich wieder zur Lichtung, die ihnen als Sammelplatz bestimmt war, zurückzukehren, bevor – um wenigstens den Schein zu retten – ein genügender Zeitraum verstrichen wäre, setzten sie ihre Nachforschungen mit sichtbarer Nachlässigkeit fort.
»Caramba! Der herrliche Mondschein!«, sagte Pepe Lobos zu seinem Gefährten. »Das lässt mich daran denken …«
»Dass uns der Oberst kommen sehen könnte?«, unterbrach ihn sein Gefährte.
»Ah bah! Dieser Teufelskerl ist nicht aufzufinden und ich dächte, da man hier wie am hellen Tage sieht, lehrtest du mich nur das, worauf du mich schon so lange hoffen lässt, ich meine das Kunststückchen mit dem Volteschlagen. Ich habe gerade ein neues Kartenspiel in der Tasche.«
»Das geht leichter mit einem ganz alten Spiel, da ich ein Stück darauf halte, dir gefällig zu sein. Und da doch, wie du sehr richtig sagtest, der Teufelskerl unauffindbar ist, füge ich mich deinen Wünschen, aber nur für kurz.«
»Ohne Zweifel nicht länger als nötig ist, ein wenig zu mischen …«
Die beiden Insurgenten setzten sich in das weiche Moos, an einen Ort, wohin der Mond sein volles Licht warf. Pepe Lobos zog sein Spiel Karten aus der Tasche und der Unterricht begann. Er dehnte sich durch den Eifer des Lehrers und die Gelehrigkeit des Schülers so maßlos aus, dass dem Obersten in seinem luftigen Bett vollkommen die Zeit blieb, alle die Träume, die seine Fantasie ihm vorgaukelte, zu durch Leben, ehe sie daran dachten, seinen Schlaf zu stören. Seit einiger Zeit befleißigten sich zwei andere einer ähnlichen Artigkeit gegen Don Rafael.
»Also, Suarez«, sagte der Erste der beiden Männer, »es sind ja wohl fünfhundert Piaster, nicht wahr, die der Hauptmann dem versprochen hat, der den Obersten lebendig einliefert?«
»Ja, fünfhundert Piaster, ein hübsches Sümmchen!«
»Hat der Hauptmann auch eine Belohnung versprochen für den Fall, dass man sich einen Arm oder ein Bein zerschmettern lässt, ohne seinen Zweck zu erreichen?«
»Dass ich nicht wüsste. Wenn man ihm indessen ein Zeugnis in aller Form beibrächte …«
»Vom Obersten?«
»Gewiss!«
»Höre, Freund Suarez! Du hast Familie und ich bin Junggeselle, ich glaube dir unrecht zu tun, wenn ich dir die Gelegenheit nähme, die fünfhundert Piaster zu verdienen. Ich überlasse dir als guter Kamerad die Möglichkeit ganz allein, diesen Teufelsobersten zu fangen, der einen Reiter zu Boden wirft, wie ein anderer eine junge Ziege von sechs Wochen, oder wenigstens die, ein Zeugnis in aller Form von ihm zu verlangen.«
Bei diesen Worten warf sich der Bandit in das Gras.
»Ich habe nun seit zwei Nächten nicht mehr geschlafen«, fügte er hinzu, »ich falle vor Müdigkeit um. Wenn du den Obersten gefangen hast, komm zurück und wecke mich, vergiss es aber nicht, sonst schlafe ich bis zum hellen Tag.«
»Hasenherz!«, erwiderte Suarez. »Ich werde mir den Preis ganz allein verdienen.«
Suarez war noch nicht aus dem Bereich seines Gefährten, als dieser schon wie eine Ratte schnarchte.
Von zehn hatten also jetzt schon drei die Verfolgung aufgegeben, während sich an einem anderen Ort folgendes Gespräch zwischen zweien entspann.
»Teufel! Das ist ein lächerlicher Mond mit seiner Helligkeit!«, sagte der Erste, indem er ganz das Gegenteil von dem am Mondlicht auszusetzen hatte, wie Pepe Lobos, der diese Helligkeit so günstig für ein Spielchen fand. »Dieser verdammte Oberst braucht uns nur zu sehen!«
»Die Wahrheit wäre«, entgegnete der Zweite, »dass wir dabei zu kurz kämen, denn er würde gleich Reißaus bei unserer Annäherung nehmen.«
»Hm! Ich weiß nicht. Er sieht mir gar nicht so aus, als ob er das Ausreißen liebte!«
»Hast du gesehen, mit welcher Kraft er Panchito Jolas aus dem Sattel gerissen hat?«
»Ich bin schon mehrere Male mit dem Pferd gestürzt und befinde mich darum um nichts schlimmer. Es läuft mir aber noch ganz eiskalt über den Rücken, wenn ich an den Sturz des armes Jolas denke. Heilige Muttergottes! Hast du nichts gehört?«
Die beiden Banditen spitzten die Ohren, mehr als Don Rafael erschreckt, der ungestört auf seinem Baum weiterschlief.
Es war nichts weiter als ein blinder Alarm. Die beiden Banditen hatten so treuherzig den Schrecken verraten, den ihnen der schreckliche Oberst einflößte, dass sie, nachdem nun die Maske, unter welcher einer den anderen zu täuschen gesucht hatte, gefallen war, übereinkamen, klugerweise die Lichtung, die ihnen zum Rendezvous bestimmt war, so schnell wie möglich aufzusuchen, wenn sie sich nicht der Gefahr aussetzten, den zu finden, den sie suchten.
Die vier anderen setzten ihre Nachforschungen mit so viel Nachlässigkeit fort, wie die Furcht, die ihnen der Mut und die athletische Kraft Don Rafaels eingeflößt hatte, vollständig rechtfertigte, sodass nach drei oder vier Stunden von den zehn Reitern sich acht wieder in der Lichtung einfanden, ohne dass einer glücklicher gewesen wäre als der andere.
Der Grund der Abwesenheit der beiden anderen war ganz einfach. Als Suarez es über sich genommen hatte, ganz allein die versprochene Belohnung zu verdienen, hatte er mit ruhigem Blut darüber nachgedacht, warum er, da sein Gefährte, der noch Junggeselle war, so viel Sorge für seinen Leichnam trug, in seiner Eigenschaft als Familienvater sein Leben möglicherweise in die Schanze schlagen sollte. Glücklich, einen Beweis seiner ungeheuren Courage, der ihn nichts kostete, gegeben zu haben, legte sich Suarez hundert Schritte von seinem Gefährten entfernt nieder, um mit Muße an seine Frau denken zu können, indem er sich heimlich Glück wünschte, ihre üble Laune diesen Abend auf seinem Moosbett nichts ertragen zu brauchen. Er nahm sich vor, seinen Genossen später zu wecken und ihm seine Feigheit derb vorzuhalten.
Unglücklicherweise hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht, der ihn gegen seinen Willen beschlich, der Schlaf nämlich, ein ebenso tiefer Schlaf, wie der seines Kameraden. Beide schliefen nun ganz fest, während ihre acht Genossen, nachdem sie vergeblich ihre Rückkehr erwartet hatten, eine Beratung abhielten, welche die Nachforschung dieses Mal ernster machen sollte.
Der Mond, der seit einiger Zeit untergegangen war, beleuchtete die auf der Lichtung versammelten Banditen nicht mehr. Ihre abgenutzten Kleidungsstücke, die in den Biwaks unter freiem Himmel beschmutzt wurden, ihr halb militärischer, halb bäuerlicher Anzug sowie ihre finsteren Gestalten gewährten beim Schein der herrschenden Dämmerung einen zugleich schrecklichen und malerischen Anblick.
Während die zehn Pferde um sie herum ihren Hunger zu stillen suchten, indem sie die Blätter der Büsche abrissen, ihre Gebissstangen verhinderten ihre magere Kost zu zermalmen, lauschten die acht Reiter, die Patronentasche am Gürtel, den Karabiner auf den Knien und den Dolch im Knieband ihres Stiefels, auf die Rede Pepe Lobos’.
»Suarez und Pacheco werden nie wiederkommen«, sagte er. »Es liegt ja wohl klar auf der Hand, dass dieser Oberst des Beelzebubs sie in der Stille mit seinem Dolch abgemurkst oder zu Brei geschlagen hat, wie den armen Panchito Jolas. Obgleich wir das Gehölz die ganze Nacht durchstreift haben, ohne etwas Verdächtiges zu finden …«
»Wir haben mit dem größten Eifer gesucht«, unterbrach ihn einer der beiden Insurgenten, der eine so große Furcht hatte, mit dem Obersten zusammenzutreffen.
»Das haben wir alle getan, zum Donnerwetter!«, erwiderte Pepe Lobos. »Fragt meinen Gefährten. Obwohl sich der Oberst unseren eifrigen Nachforschungen zu entziehen gewusst hat, so beweist doch die Abwesenheit zweier der Unsrigen aufs Klarste, dass er diesen Teil des Waldes, in dem er sich verbirgt, noch nicht verlassen hat. Sobald der Tag anbricht, werden wir von Neuem die Spur seines Pferdes aufsuchen und genau den Ort erforschen, wo er die Straße verlassen hat. Ist das nicht euer aller Meinung?«
Ein allgemeiner Beifall antwortete der Frage Pepe Lobos’.
»Jetzt«, fügte er hinzu, »vor allem Rache, Rache! Zum Teufel mit der Prämie von fünfhundert Piastern für den, der den Obersten lebend gefangen nimmt. Wir müssen ihn tot erwischen.«
»Vielleicht bewilligt der Hauptmann die Hälfte der Prämie«, warf einer der Banditen ein.
»Wenn wir erst bestimmt den Ort wissen, wo er den Weg verlassen und sich ins Dickicht geschlagen hat, teilen wir uns in zwei Abteilungen von je vier Mann. Die Erste verfolgt den Weg zu der Ostuta, die Zweite kommt von der Ostuta herauf und wendet sich zu der Straße in einer vorher bestimmten Richtung. So nehmen wir den Mann zwischen uns, und der Erste, der ihn bemerkt, gibt auf ihn Feuer, wie auf einen tollen Hund. Wenn ihm dann noch ein Fünkchen Leben bleibt, so ist die Prämie unser.«
Die Ansicht Pepe Lobos’ erhielt einstimmigen Beifall und man kam überein, dass sich mit Anbruch des Tages alle auf den Weg machen sollten, um das Terrain zu untersuchen und die letzten Spuren der Hufe des Pferdes Don Rafaels aufzufinden.
Der Aufgang der Sonne ließ weniger lange auf sich warten, als die Rückkehr Suarez’ und Pachecos, die noch immer schliefen. Ihre ersten Strahlen vergoldeten kaum die Gipfel der höchsten Palmen, als die acht Banditen, über den Weg, der von Huajapam zu der Furt der Ostuta führte, zerstreut, auf dem Boden die am vorhergegangenen Abend zurückgebliebenen Spuren ihrer Pferde von denen des Pferdes Don Rafaels zu unterscheiden suchten.
Das war keine leichte Sache, denn der von den Hufen der elf Pferde, die einige Stunden zuvor auf derselben Straße in rasendem Galopp dahingebraust waren, zertretene und zerstampfte Boden bot nur unförmliche Spuren dar. Ein Europäer hätte es niemals unternommen, die einzelnen Spuren eines Pferdes zu suchen, die mit so vielen anderen untermischt waren. Für mexikanische Hirten, Gauchos von Chili, oder für Landleute aus jedem anderen Teil Amerikas war dies nur eine Sache der Geduld.
Weniger als eine halbe Stunde genügte für Pepe Lobos, der die Höhe des Weges untersuchte, das zu finden, was er suchte. Er rief seine Kameraden herbei, ihnen die Spuren zu zeigen, die er gefunden hatte.
Mitten unter den Spuren, aus denen jeder die seines Pferdes heraus erkannte, ließen eine schräge, auf dem Boden ausgehöhlte Linie, ein Grashalm, der auf der grünen Linie, welche den Pfad einfasste, zertreten war, ein in Mannshöhe eines Reiters abgebrochener Zweig den Banditen keinen Zweifel mehr, dass genau an dieser Stelle der Oberst den Weg verlassen und sich in das Dickicht gewendet habe.
Zur selben Zeit durchwatete das von Arroyo zur Verfolgung der beiden Flüchtlinge ausgesandte Kommando die Furt des Flusses und fasste einige Minuten später auf dem linken Ufer Posten, als es sah, dass vier Reiter auf dem Pfad, der das Gehölz durchschnitt, auf sie zukamen.
Diese vier Reiter waren die, welche nach dem Vorschlag Pepe Lobos’ die Spur des Obersten quer durch das Gehölz von der Ostuta bis zur Straße nach Huajapam verfolgen sollten.
Die beiden Gruppen erkannten sich sogleich, aber der Anführer des zuerst Angekommenen, ein alter aus Neu-Mexiko gebürtiger Soldat, der lange Zeit hindurch dort die wilden Indianer bekämpft hatte und alle Kriegslisten kannte, hielt es doch für gut, sich das der Bande von Arroyo gegebene Losungswort nennen zu lassen. Als ihm nun kein Zweifel übrig blieb, ließ er sich durch die neu Angekommenen belehren, wie sie, anstatt sich bei der Hazienda del Valle zu befinden, zu dieser frühen Stunde dazu kämen, die Wälder zu durchstreifen.
»Ah«, sagte er, »ihr sucht den Oberst Tres-Villas! Drei Flüchtlinge statt zwei! Das wird ein lustiger Tag!«
Der alte Wachtmeister billigte die Taktik Pepe Lobos’ und bildete ein nettes Kommando von fünf Mann, die in einer entgegengesetzten Richtung in den Wald dringen sollten, während er selbst mit den fünf Mann, die ihm nun noch blieben, es unternahm, in einer allen drei Gruppen entgegengesetzten Richtung vorzurücken.
Von diesem Augenblick an hatten die Banditen einen Anführer und zwar einen, der ebenso gewandt als unerschrocken war, der ihnen genaue Unterweisungen gab und bei ihnen den Mut wieder anfachte, der, wie wir gesehen haben, sie gänzlich verlassen hatte.
Der Befehl wurde aber beibehalten, den Obersten aus der Ferne zu töten, wenn es zu gefährlich würde, sich ihm zu nähern. Nur die beiden anderen Flüchtlinge sollten nach dem Willen Arroyos lebend eingefangen werden.
Von jetzt an wurde die Lage Don Rafaels gefährlich. Die geringste Gefahr, die er lief, war die, fechtend zu sterben, wenn er nicht durch einen unglücklichen Zufall lebend in die Hände seiner unerbittlichen Feinde fiel.
Als der alte Refino, das war der Name des Kriegers, seine Anordnungen getroffen hatte, erwachte Don Rafael. Seine Augen waren in einem Moment vom Sonnenschein geblendet und er fragte sich noch, wo er sich befände, als er zwei Menschen bemerkte, die sich vorsichtig seinem Baum näherten.
Schreibe einen Kommentar