Der Schwur – Erster Teil – Kapitel 4
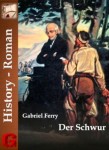 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Erster Teil
Der Dragoner der Königin
Kapitel 4
Die Überschwemmung
Während der Indianer und der Schwarze ihre wunderlichen Zeremonien abhielten, deren Augenzeuge der Hauptmann gewesen war, hatte sich der Mond glänzend am Himmel erhoben und verbreitete eine Helle, wie sie in diesem gesegneten Klima gewöhnlich ist.
Don Rafael hatte aus seiner eigenen Erfahrung einsehen gelernt, dass ein geschickter Mann nicht länger als eine Viertelstunde brauchte, um mitten durch die üppige Vegetation, welche die Seiten der Schlucht unwegsam machte, in der das fremdartige Schauspiel stattfand und dessen Augenzeuge er durch Zufall geworden war, den Ort zu erreichen, wo sein Pferd angebunden war. Er hatte ferner bemerkt, dass die beiden Personen, die dort ihr Unwesen getrieben, sich auf die entgegengesetzte Seite des Flusses geschlagen hatten. Er beschloss nun sein Ross wieder aufzusuchen, den Fluss schwimmend zu überschreiten, und wenn möglich, beide in der Nähe des Wasserfalls zu erwarten.
Der Vollmond beleuchtete den Fluss und seine Ufer mit hellem Glanz. Der Offizier machte einen kurzen Umweg und beeilte sich ohne Zeitverlust, sein Vorhaben auszuführen.
Wie gedacht, zog er sein Pferd in weniger als zehn Minuten am Zaum nach sich, eine Furt suchend, an dem er dasselbe mit weniger Gefahr in den Fluss führen konnte, um ihn zu durchschwimmen.
Währenddessen glaubte er durch das Gebrüll des Wasserfalls, von dem er sich mehr und mehr entfernte, eine Art dumpfen Geschrei zu hören, das von der Seite des Flusses kam, die er zu gewinnen strebte. Diese raue Stimme, die er nicht mit dem Gekläff der Schakale, das er so oft auf seinen weiten Reisen vernommen hatte, verwechseln konnte, glich in ihrem dumpfen Klang dem Brüllen des Stiers, und verursachte dem Reiter ein Gefühl des Unbehagens. Es war das erste Mal, dass er diese dumpfen Töne vernahm. Ohne die Art der Gefahr eigentlich zu kennen, fühlte er instinktiv, dass irgendeine solche ihm drohe.
Sein Pferd schien auch seine Befürchtungen zu teilen, wie er aus dem Zittern seiner Nüstern folgerte.
Um auf jeden Fall vorbereitet zu sein, schnallte er seine lange Flinte vom Sattel los und begann seine Untersuchungen.
Ein sanfter Abhang wurde gefunden. Ob der Fluss tief sei oder nicht, er schwang sich in den Sattel und trieb sein Pferd in den Strom, welches halb watend, halb schwimmend das gegenüberliegende Ufer erreichte. In der Furt hob er seine Büchse über den Kopf, damit sie trocken blieb.
Entschlossen, noch einige Zeit auf die Ankunft der beiden einzigen lebenden Wesen, die er in diesen Einöden seit seiner Trennung von dem Studenten erblickt hatte, zu warten, ging der Offizier wieder eine Strecke stromaufwärts und stellte sich voller Erwartung in der Nähe des Wasserfalls auf.
Nun zog er, um sich den Augen derer, die er suchte, leichter bemerkbar zu machen, ein Feuerzeug hervor, zündete eine Zigarre an und erwartete so, unbeweglich wie eine zwischen zwei Bäumen aufgestellte Reiterstatue, die Ankunft des Schwarzen und des Indianers.
Die tiefe Einsamkeit, das fahle Mondlicht, das gerade Erlebte, das sonderbare Schauspiel, das der Schwarze und sein Gefährte dem Auge des Kreolen geboten hatte, sowie die unbekannten Töne, die von Zeit zu Zeit an sein Ohr drangen, und in denen er den dumpfen Widerhall der vorhin gehörten Stimmen zu erkennen glaubte, verursachten dem Offizier eine unwillkürliche Schauer. Auch fühlte er manchmal sein Pferd zwischen seinen Schenkeln zittern und konnte den Gedanken nicht von sich abwehren, dass er irgendeiner Beschwörung des Fürsten der Finsternis beiwohne, dessen Stimme diese dumpfen Töne seien.
Don Rafael war ein Kreole, daher in Unwissenheit und Aberglauben erzogen. Er erinnerte sich, gehört zu haben, dass die Tiere bei der Anwesenheit eines Geistes aus der anderen Welt zitterten, ähnlich dem, welches sich seines Pferdes bemächtigt hatte. Don Rafael war aber auch zugleich eine jener starken Seelen, von denen der Indianer gesprochen hatte, die die Furcht zwar für einen Augenblick beugen, nie aber für die Dauer beherrschen kann. Er blieb deshalb auf seinem Posten, ohne seine Furcht auf andere Weise merkbar werden zu lassen als durch ein beschleunigtes Atmen und dass er seine Lippen fest auf seine Zigarre kniffte, deren Feuer in der Finsternis hell aufleuchtete.
Währenddessen kletterten der Indianer und der Sklave, die in ihrer Beschwörung des Wassergeistes gestört worden waren, den Abhang der Schlucht hinauf, sich mühsam durch die Vegetation, die jeden Ausweg zu versperren schien, Bahn brechend.
Der Indianer stieß seinen Verdruss in Drohungen gegen den Eindringling aus, dessen Gegenwart ohne Zweifel das Erscheinen des Geistes, den er anrief, verhindert hatte.
Clara fluchte zwar auch, im Grunde seines Herzens aber war er weniger unzufrieden, als er sich den Anschein gab, es zu sein.
»Erscheint denn die Sirene nur in dem Augenblick, in dem der Mond aufgeht?«, fragte der Schwarze, sich dicht an seinen Gefährten haltend.
»Ohne Zweifel«, erwiderte Costal, »nur in dem Augenblick erscheint der Geist. Wenn sich aber irgendein Profaner und unter einem Profanen verstehe ich einen Weißen, in der Nachbarschaft befindet, erscheint sie nicht.«
»Hat sie vielleicht Furcht vor der Inquisition?«, entgegnete fragend der Afrikaner.
Costal zuckte die Achseln.
»Ihr seid ein Einfaltspinsel, Freund Clara. Geht zum Teufel! Glaubt Ihr denn, dass der mächtige Geist der Gewässer Furcht haben soll vor Euren langröckigen Mönchen? Sie würden Furcht vor ihm haben und sich vor ihm auf die Erde werfen.«
»Alle Teufel! Wenn sich der Geist schon vor einem einzigen Weißen fürchtet und aus dieser Ursache nicht zu erscheinen wagt, muss er um so viel mehr Grund haben, sich vor einer Masse von Mönchen zu verbergen, die doch abscheulich hässlich sind, was nicht zu leugnen ist.«
»Möge ein Blitz des Himmels den Ungläubigen zerschmettern, der den Erfolg meiner Beschwörung zunichte gemacht hat!«, schrie der Indianer, in umso größeren Zorn versetzt, je mehr er sich durch die Gründe des Schwarzen geschlagen fühlte.
»Ihr hattet unrecht, Freund Costal, das Feuer so eilig zu verlöschen.«
»Ich wollte dem Auge des Profanen die Geheimnisse entziehen, die sich uns zeigen sollten.«
»Ihr besteht also darauf, dass uns jemand belauscht hat?«
»Ich bin davon überzeugt.«
»Und dass er mit Steinen nach uns geworfen hat?«
»Jedenfalls.«
»Wohl an, auf meine Ehre! Ich wäre geneigt, etwas ganz anderes zu glauben.«
»Was denn?«, fragte der Indianer, sich an den Stamm eines Baumes lehnend.
»Ich glaube«, erwiderte Clara, seinem Genossen nachahmend, »dass unsere Angelegenheit zu einem gewünschten Erfolg geführt hätte, wärt Ihr nur ein wenig geduldiger gewesen. Ich möchte wetten«, fügte er mit einer Miene innigster Überzeugung hinzu, »dass ich in dem Augenblick, als der Wasserfall den Glanz des Feuers von den Ufern zurückstrahlte, in Mitte der beiden Bäume etwas wie ein Diadem aus glänzendem Gold habe erscheinen sehen. Nun richte ich an Euch die Frage, wer kann hier im Herzen dieser Waldung ein goldenes Diadem tragen, wenn es nicht der Wassergeist ist.«
»Du täuschst dich, Clara, das ist unmöglich.«
»Ich bin meiner Sache gewiss und glaube demgemäß, dass das, was Ihr für Steine hieltet, nichts als pure Goldkörner waren, die uns der Geist zuwarf.«
»Und du hast zugegeben, dass ich die Tiefe der Schlucht verließ, ohne dass du dich dem widersetztest!«, schrie der Indianer aufgeregt und einen Augenblick von den Worten des Schwarzen erschüttert.
»Wir haben unser letztes Stückchen Schwamm verbraucht, konnten daher unser Feuer doch nicht wieder anzünden.«
»Wir hätten es wenigstens versuchen sollen.«
»Ja«, erwiderte der Schwarze mit einem Anflug von Ironie, »es ist leicht, in dieser Finsternis ein Stück Gold von einem Kieselstein zu unterscheiden.«
»Nach dem Gewicht ist es doch leicht.«
»Wir liefen aber dabei Gefahr«, sagte der Schwarze, dieses Mal den Grund seiner Gedanken verratend, »dass wir, indem wir ein Stück Gold suchten, den Bestien von Tigern begegneten, die ihrerseits den Rest des Büffels suchten und erfreut gewesen wären, uns an dessen Stelle zu finden.«
»Was scheren mich die Jaguare?«, rief der Indianer mit schlecht verhehltem Verdruss.
»Aber mich!«, erwiderte der Schwarze.
Der Indianer sagte nichts, sonder beschleunigte seinen Schritt. Der Sklave, wenig beruhigt, folgte ihm wie sein Schatten.
Plötzlich stand der Indianer still und rief vor die Stirn schlagend: »Ich hatte gehofft, morgen die Jaguare zu jagen, aber morgen ist dazu keine Zeit mehr und wir werden gut tun, diesen Aufenthalt schleunigst zu verlassen.«
»Warum?«, fragte begierig der Schwarze, erschreckt über die außergewöhnliche Unruhe Costals, den doch sonst nichts außer Fassung bringen konnte.
»Ich habe ganz außer Acht gelassen, dass es in dieser Jahreszeit zu Vollmond immer der Moment ist, in dem die Ströme unseres Staates anschwellen, sich verbinden und in jedem Jahr unsere Landschaften überfluten. Du weißt, dass die Überschwemmung wie der Blitz eintritt. Hörst du nicht schon in der Ferne das Murmeln der Gewässer?
»Gott sei Dank, ich höre nichts als das Brüllen des Wasserfalls, welches uns zwingt, so laut zu schreien, damit wir uns verständigen können. Beeilen wir uns aber.«
»O!«, erwiderte Costal, »wenn wir erst einmal die Schlucht hinter uns haben, ist nichts mehr zu fürchten. Der Gipfel eines Baums wird uns als Zufluchtsort dienen, sollte uns die Flut überraschen.«
»Meinetwegen, aber hier?«
»Hier wäre es um uns geschehen.«
Die beiden Abenteurer kletterten den schroffen Abhang schweigend mit einer Schnelligkeit hinauf, welche durch die Furcht vor einer Gefahr, aus der sie nichts befreien konnte, wie die Schnelligkeit ihrer Füße verdoppelt wurde.
Auf Händen und Füßen kletternd, um das Hinaufsteigen zu erleichtern, machte Costal seinem Zorn gegen den Ungläubigen Luft, dem er das Fehlschlagen seiner Hoffnungen zuschrieb. Bald erreichte er den Kamm des Abhangs, und Clara stieß einen Seufzer aus, als er den Fuß auf den Gipfel des ungeheuren und tiefen Abhangs setzte.
Plötzlich den Arm Costals mit einem nervösen Zittern ergreifend, zeigte er mit dem Finger auf einen Gegenstand, der ihm fremdartig erschien.
Es war dies eine schwarze, unbeweglich unter den Bäumen, die das Ufer des Flusses einfassten, dastehende Gestalt, darüber ein heller Glanz, der den einen Augenblick leuchtete, um im nächsten sofort wieder zu verschwinden.
»Das Diadem des Geistes!«, sagte der Schwarze, seinen Mund dem Ohr Costals nähernd, damit das Gebrüll des Wasserfalles seine Stimme nicht verwehte.
Costal folgte der vom Schwarzen bezeichneten Richtung. Bei dem plötzlich aufleuchtenden Schein sah er in der Tat etwas wie einen goldenen Reiter inmitten der Finsternis glänzen.
Der Schwarze und der Indianer sollten nicht lange im Ungewissen bleiben, wofür sie diese unerwartete Erscheinung zu halten hatten. Bei einer Bewegung, die das Pferd machte, fiel ein Mondstrahl auf den Reiter, dessen Büste nun klar hervortrat.
Eine breite goldene Borte, die nach mexikanischer Mode über seinen Hut herabhing, hatte dadurch, dass sie sich in dem allmählich auf flackernden Glanz der Zigarre spiegelte, das zweite Mal die Verwunderung Claras hervorgerufen.
»Wie ich sagte«, rief Costal, »ein Ungläubiger verhinderte das Erscheinen des Geistes. Hatte ich unrecht?«
»Nein!«, erwiderte der Schwarze ziemlich verwirrt.
»Es ist ohne Zweifel ein Offizier«, nahm der Indianer beim Anblick der militärischen Haltung Don Rafaels das Wort, der fortwährend unbeweglich blieb, seinen Federstutz in der einen Hand, den Zaum und die Zigarre in der anderen haltend.
Übrigens wurde dem Dragoner die Zeit lang. Ein derber Soldatenfluch zeigte seine Ungeduld an, als eine Stimme, stark genug, um sich durch das Gebrüll des Wasserfalls vernehmbar zu machen, sich hören ließ.
»Wer ist da?«, rief diese drohende Stimme.
»Wer da?«, entgegnete Don Rafael, seine ganze Sicherheit vor menschlichen Wesen wiedererlangend, selbst wenn sie als Feinde kamen.
In demselben Augenblick wurden zwei Menschen sichtbar, in denen der Dragoner die wiedererkannte, denen er den Ehrentitel ›Wilde‹ zu geben geneigt war.
»Ich bin froh, Euch endlich sprechen zu können, meine Freunde«, sagte er mit echt militärischer Ungeniertheit, sein Pferd ein ungestümes Manöver ausführen lassend, das ihn plötzlich mit den beiden Unbekannten in ein unmittelbares Gegenüber brachte, während diese hinter ihm auf das hohe Ufer des Flusses hervortraten.
»Vielleicht sind wir es nicht«, erwiderte Costal in gereizter Stimmung und ließ zu gleicher Zeit seinen Karabiner nicht ganz ohne alle Prahlerei von einer Schulter zur anderen gleiten.
»Bei Gott, ich muss auch böse werden«, nahm der Dragoner das Wort, mit soldatischer Freimütigkeit lachend, »denn ich bin kein Egoist und will nicht allein zufrieden sein.«
Bei diesen Worten schnallte Don Rafael seine Flinte wie eine unnütze Waffe wieder an den Sattel, indem er dabei den Indianer nachahmte, der in seiner fast feindlichen Stellung verharrte.
»Vielleicht«, fügte er hinzu, in seiner Westentasche suchend, »habt Ihr noch einen Groll gegen mich wegen der Steine, die ich auf Euch in den Fluss hinab geworfen habe, wo Ihr mit Dingen, die mich nicht kümmern, sehr emsig beschäftigt ward. Ihr müsst aber hierbei einen verirrten Reisenden entschuldigen, dessen Stimme durch das Brüllen der Kaskade übertäubt wurde, und der nicht wusste, auf welche Weise er Eure Aufmerksamkeit auf sich lenken sollte.«
Nach Beendigung dieser Verteidigungsrede zog der Dragoner einen Piaster aus seiner Tasche und bot ihn dem Indianer an.
»Danke schön«, sagte dieser, während Clara hastig nach dem Geldstück griff. »Wohin geht Ihr?«
»Zur Hazienda las Palmas, bin ich davon noch weit?«
»Das kommt auf den Weg an, den Ihr zu nehmen gedenkt.«
»Ich suche den kürzesten, ich hab’s eilig.«
»Der Weg, der Euch am sichersten dahin führen würde, ohne dass Ihr befürchten müsstet, Euch noch einmal zu verirren, ist der, wenn Ihr dem Lauf des Flusses folgt«, sagte Costal, der trotz seines Grolls gegen den Fremden es dennoch nicht wagte, einem Reisenden, der auf dem Weg zur Hazienda las Palmas war, in der er diente, eine falsche Unterweisung zu geben.
»Wollt Ihr aber einen noch näheren …« Ein raues und abgebrochenes Geheul, das der Offizier im Verlauf dieses Abends schon einige Male gehört hatte, unterbrach die Unterweisungen Costals.
»Was war das?«, fragte der Offizier.
»Es ist die Stimme eines Jaguars, der Beute sucht«, erwiderte Costal.
»Ah!«, sagte der Dragoner, »ich fürchtete, dass es irgendetwas anderes wäre.«
»Der kürzeste Weg für Euch ist nach dort«, fuhr der Indianer fort, mit dem Lauf seines Karabiners in die Richtung zeigend, woher das Gebrüll kam.
»Ihr meint, das sei der kürzeste?«
»Ja!«
»Nun, ich danke Euch, ich werde ihn einschlagen.«
Bei diesen Worten zog der Offizier die Zügel an, bereit, der Richtung zu folgen, die der Indianer ihm angegeben hatte.
»Hört, Señor Kavalier«, sagte er mit mehr Herzlichkeit, als er bis jetzt gezeigt hatte, »es ist nicht immer damit abgemacht, ein mutiger Mann zu sein, wie Ihr es scheint, um jeder Gattung von Gefahren zu entgehen. Man muss auch die Gefahr selbst kennen.«
Don Rafael Tres-Villas hielt sein Pferd an. »Sprecht, mein Freund«, sagte er, »ich höre und danke Euch im Voraus. Was ist das für eine schreckliche Gefahr, die mir droht?«
»Eine Gefahr, gegen welche die, die uns alle Tiger, die in diesen Savannen heulen und brüllen mögen, bereiten können, ein Kinderspiel ist. Es ist die Überschwemmung, welche vielleicht vor Ablauf einer Stunde die Ebenen mit brüllenden Wogen überdeckt und aus ihnen wütende Meere macht und selbst Tiger, trotz ihrer Schwimmfertigkeit fortreißt, wenn sie sich nicht auf einen Baum retten können. Sowohl der Arriero und sein Maultier als auch der Hirte und seine Herden werden gleichermaßen verschlungen, wenn sie nicht ein Asyl in der Hazienda finden, wohin Ihr wollt.«
»Ich werde Eure Vorschriften nicht außer Acht lassen«, sagte der Offizier, der sich nun noch erinnerte, den Studenten ungefähr zwei Stunden von dem Ort, wo er sich jetzt befand, gelassen zu haben.
Er erzählte in wenigen Worten sein Abenteuer mit demselben dem Indianer.
»Bekümmert Euch deshalb nicht. Wenn er noch lebt, bringen wir ihn morgen in die Hazienda. Denkt jetzt nur an Euch und an die, welche Euren Tod beweinen könnten. Was die Jaguare betrifft, so habt Ihr nichts von ihnen zu fürchten. Wenn Euer Pferd sich bei ihrem Anblick erschreckt und sich weigert, geradewegs vorwärts zu gehen, so ermuntert es durch Zuruf. Solltet Ihr zu sehr in ihre Nähe kommen, schreit auch sie an, denn die menschliche Stimme ist dazu angetan, allen Tieren Respekt einzuflößen, selbst den aller wildesten. Die Weißen wissen dies nicht, weil es ihre Beschäftigung nicht ist, mit denselben in unaufhörlicher Fehde zu leben, wie die des roten und schwarzen Mannes. Ich könnte Euch aus meinen eigenen Jagdabenteuern mit Jaguaren Belege dafür … Ah, da ist er schon davon.«
Der Indianer hielt inne, denn Tres-Villas hörte in der Tat nichts mehr. Nur mit der Sorge beschäftigt, der Überschwemmung zu entgehen, jagte er schon auf der vom Vollmond mit fahlem Licht übergossenen Savanne in Richtung auf die Hazienda dahin.
»Er ist mutig und offenherzig«, sagte dieser, »es wäre schade, wenn ihn ein Unglück trifft.«
»Hm!«, unterbrach ihn Clara, »ich dachte, das wären genug Abenteuer für einen Tag, und namentlich diese Nachbarschaft der Tiger …«
»Pfui, Clara, du solltest dich schämen. Sieh diesen braven jungen Mann, der in seinem Leben noch keinen Tiger gesehen hat, und der sich um sie nicht mehr kümmert, als um eine Schar Feldratten.«
»Mag sein! Nun, was könnten wir noch anfangen?«, erwiderte Clara in ziemlich mürrischem Ton. Was soll nun aus dem jungen Mann werden, den uns der Reiter empfohlen hat?«
»Wir müssen versuchen, zu ihm zu gelangen. Unterdessen wollen wir unser Boot auf den Gipfel des Cerro de la Mesa (Tafelberg) tragen, wo wir ruhig eine Nacht als Zufluchtsort vor den Tigern und der Überschwemmung zubringen können.«
»Das passt mir«, sagte der Schwarze, wieder erheitert durch die Aussicht auf eine ruhige Nacht; »denn ich habe großes Bedürfnis nach Schlaf.«
Während dessen sprengte Don Rafael ungesäumt in der angezeigten Richtung zur Hazienda weiter.
Während der ersten halben Stunde seines Ritts war die Savanne so friedlich in der Beleuchtung des Mondes, die Palmen schaukelten sich sanft unter dem mit Sternen besäten Himmel, während ein leiser Abendwind den Wohlgeruch der duftgeschwängerten Pflanzen über die Ebene trug, dass der Reiter wohl glauben konnte, der Indianer habe sich über seine Leichtgläubigkeit belustigen wollen. Deshalb mäßigte er fast unwillkürlich den Gang seines Pferdes und überließ sich jener melancholischen Träumerei, die der Reiz jener köstlichen Nächte in den Tropen hervorbringt.
Indessen erinnerte sich der Reisende unwillkürlich wieder an die verlassenen Hütten, die er auf seinem Weg angetroffen hatte, an die an den Bäumen in die Höhe gezogenen Boote, gleichsam als letztes Rettungsmittel für diejenigen, welche die Überschwemmung unvorhergesehen überraschte. Seine Begeisterung schwand plötzlich und er trieb aufs Neue sein Pferd an.
Nach Verlauf der zweiten halben Stunde hörten wie mit einem Zauberschlag die Grillen auf, unter dem Gras zu zirpen. Die ganze Savanne schien in tiefes Schweigen versunken, und der mit balsamischen Wohlgerüchen durchwehten Luft, die so regelmäßig ging, dass man sie für den Atem der unter dem nächtlichen Sternenmantel entschlummernden Natur hätte halten mögen, folgte ein von Modergeruch geschwängerter Wind, stoßweise und schnaubend, wie der Atem des Schreckens.
Diese beängstigende Stille war nur von kurzer Dauer. Bald darauf glaubte der Reiter immer noch den entfernten und dumpfen Lärm des Wasserfalls, den er schon weit hinter sich hatte, zu vernehmen. Nur schien dieses Getöse an einem anderen Platz, nicht hinter, sondern vor ihm, zu sein.
Jetzt schlug sein Herz schneller, weil nun, wenn er den Worten des Indianers Glauben schenken durfte, eine Gefahr sich näherte, gegen die weder seine Büchse noch sein ausgezeichneter Degen, noch endlich sein mutiges Herz, das der Offizier in Verbindung mit einem tapferen Arm besaß, ihm von irgendeinem Nutzen sein konnte.
Die stählernen Sehnen seines Pferdes waren seine einzige Verteidigung, sein letztes Rettungsmittel.
Glücklicherweise waren die Kräfte des edlen Tieres noch von keinem zu langen Weg erschöpft, das seinerseits die Ohren spitzte und mit weit geöffneten Nüstern den feuchten Wind einatmete, den die Wasser gleichsam als Vorläufer vor sich her sandten.
Jetzt sollte sich also ein Wettlauf zwischen dem Reiter und der Wasserflut entspinnen, in dem der, welcher zuerst die Hazienda las Palmas erreichte, Sieger blieb.
Der Offizier ließ die Zügel fallen, die Räder seiner eisernen Sporen drangen in die Weichen seines Pferdes, der Kampf der Schnelligkeit hatte begonnen. Die Savanne flog an dem Reiter vorüber, zu seiner Rechten und Linken schienen die Büsche und Palmen zu fliehen.
Die Überflutung zog von Ost nach West, der Reiter dagegen sprengte von Westen nach Osten. Bei der Schnelligkeit ihrer entgegengesetzten Bewegung mussten sie sich einander begegnen. Aber an welchem Punkt?
Der Abstand zwischen beiden verringerte sich von Sekunde zu Sekunde. Das zuerst dumpfe und entfernte Geräusch näherte sich immer mehr und glich dem des Donners.
Die Savanne und die Palmen flogen noch immer wie Schatten am Reiter vorüber, noch immer war der drohende Wasserschwall nicht sichtbar.
Das Pferd ließ nicht nach, seine Flanken zitterten, es keuchte, und die Luft, die es im rasenden Lauf ausatmete, fing an seinem Körper zu mangeln.
Der Offizier hielt einen Augenblick an, um sein Pferd verschnaufen zu lassen, aber immer näher und näher drang das Brausen der vorrückenden Flut.
Don Rafael verzweifelte fast an seiner Rettung, als er den schrillen Ton einer fernen Glocke vernahm. Er kam von der Hazienda, die dadurch das Land von der äußersten Gefahr benachrichtigte, dass sie die Sturmglocke ertönen ließ.
Der Offizier rief sich die Worte des Indianers in das Gedächtnis zurück: Denkt nur an die, die Euren Tod beweinen würden. War in der Hazienda, in der er erwartet wurde, jemand, der ihn vielleicht schmerzlicher als die übrigen beweint hätte? Bei diesem Gedanken empörte sich der Reisende gegen das Schicksal, welches ihm drohte, und er beschloss einen letzten Versuch zu machen, ihm zu entgehen.
Sein Pferd bedurfte indessen, um mehr Aussicht auf Erfolg zu versprechen, einer abermaligen Ruhe, und der Offizier besaß, trotz der drohenden Gefahr, Kaltblütigkeit genug, diese gebieterische Notwendigkeit nicht zu verkennen. Er stieg ab und schnallte den Sattelgurt lockerer, um den Flanken des keuchenden Tieres mehr Spielraum zu verschaffen.
Der Reisende zählte mit Angst die Minuten, die verrannen, als das Echo ihm das Geräusch zu trug, welches das Pferd eines zweiten Reiters verursachte, der in derselben Richtung hin jagte. Er wandte sich um, ein Mann sprengte auf einem kräftigen Fuchs herbei. Nur noch einen Augenblick und der Reiter, der die Hitze seines Pferdes auf eine eben nicht sanfte Manier bändigte, hatte ihn erreicht.
»Was macht Ihr da?«, schrie er; »hört Ihr denn die Alarmglocke nicht? Wisst Ihr nicht, dass die Gewässer sogleich die ganze Ebene überfluten werden?«
»Ich weiß es«, erwiderte der Offizier, »aber meinem Pferd ist der Atem ausgegangen, und ich erwarte …«
Der Unbekannte warf einen raschen Blick auf den Braunen des Don Rafael und sprang aus dem Sattel.
»Haltet mein Pferd«, sagte er zum Offizier, ihm die Zügel zuwerfend, dann, sich dem Pferd des Dragoner nähernd, hob er den Sattel auf und legte die Hand auf den Widerrist des Tieres, um das Pulsieren seiner Lungen zu fühlen.
»Gut!«, fügte er hinzu, wie ein über den Pulsschlag seines Patienten zufrieden gestellter Arzt.
Nun ergriff er einen faustgroßen Kieselstein und rieb damit heftig und abwechselnd die Brust und die dampfenden Kniekehlen des Pferdes.
Während dieser Zeit betrachtete Don Rafael den Unbekannten, der wenig bekümmert schien, sein eigenes Leben zu retten, und der mit so viel Großmut und Sorgfalt für das Pferd eines Reisenden sorgte, der ihm ganz und gar unbekannt war. Der Ankömmling trug das Kostüm der Maultiertreiber, einen niedrigen Hut aus grobem Filz, eine Art grauen Leinwandkittel mit schwarzen Streifen. Darüber war ein kurzes Schurzfell aus dickem Leder umgürtet, weite, flatternde, leinene Beinkleider und ziegenlederne Halbstiefel auf seinen nackten oder vielmehr strumpflosen Füßen. Er war von kleiner Statur, sein von der Sonne gebräunter Teint nahm seinem Gesicht nichts von seiner natürlichen Sanftmut, und eine unerschütterliche Ruhe thronte trotz des erschreckten Moments auf seiner Stirn.
Don Rafael ließ ihn gewähren, aber mit einem Gefühl tiefer Erkenntlichkeit.
Als der Maultiertreiber glaubte, das Pferd genug gerieben zu haben, um ihm eine augenblickliche Elastizität wieder zu geben, sagte er:
»Das Tier hat Gehalt, noch ist es nicht verfangen, denn es lässt sich noch kein Pulsieren der Lungen am Bug spüren. Helft mir jetzt bei dem, was ich vornehmen will, und beeilen wir uns, denn das Verderben bringende Geräusch brüllt schon da unten, und die Sturmglocken läuten mit verdoppelter Geschwindigkeit.«
Das alles war leider nur zu wahr, und der Wind trug zu gleicher Zeit mit dem furchtbaren Gebrüll der Fluten das beschleunigte Läuten der Glocken herüber, um als Vorläufer der Totenglocke allen, die sich auf dem flachen Land befanden, zu sagen: Beeilt Euch, solange es noch Zeit ist!
»Verbindet Eurem Pferd die Augen mit Eurem Taschentuch«, fügte er dann noch hinzu.
Während der Dragoner sich beeilte, zu gehorchen, zog er aus der Tasche seines ledernen Schurzfelles einen Strick, mit dem er die Nase gerade oberhalb der Nüstern umwand.
»Haltet diesen Strick mit allen Kräften fest«, sagte er zu Rafael.
Nun zog der Maultiertreiber ein scharfes Messer aus der Scheide, dessen Klinge er in die durchsichtige Scheidewand zwischen den beiden Nasenlöchern des Pferdes stieß.
Das Blut spritzte hervor, das Tier bäumte sich, trotz der Anstrengungen seines Retters, es zu halten. Kaum berührten aber seine Vorderhufe wieder den Boden, als der Maultiertreiber das blutige Heft des Messers ergreifend, es mit Heftigkeit aus der Wunde riss.
»Jetzt«, sagte er, »wird Euer Pferd wenigstens so weit laufen, wie es seine Füße tragen. Wenn Ihr irgendwie gerettet werden könnt, ist es nur auf diese Weise möglich.«
»Euer Name?«, rief Don Rafael dem Maultiertreiber zu, ihm die Hand drückend, »Euer Name, damit ich ihn nie vergesse.«
»Valerio Trujano, ein armer Maultiertreiber, der viel Plage ausstehen muss, um seinen Obliegenheiten Ehre zu machen, der aber in der Erfüllung seiner Pflicht Trost findet und es im Übrigen auf Gott ankommen lässt. Hier war es meine Pflicht, Euch nicht infolge falscher Rettungsmittel untergehen zu lassen«, setzte er einfach hinzu. »Der Name des Allerhöchsten sei gesegnet, wir sind in seiner Hand, fleht ihn an, dass er von seinen Dienern die schreckliche Gefahr, in der sie sich je befunden haben, gnädig abwenden möge.«
Bei diesen mit hinreißender Feierlichkeit gesprochenen Worten kniete Trujano auf den Sand, zog seinen Hut ab, der bisher einen dichten Wald stark gelockter Haare bedeckt hatte. Dann sprach er, die Augen gen Himmel erhoben, mit einer Stimme, deren männliche Kraft bis im Grund des Herzens Don Rafaels erzitterte, folgende Worte.
»De profundis clamavi ad te, Domini! Domini, exaudi vocem meam! (Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr! Herr; erhöre meine Stimme.)«
Als er den zweiten Vers des Trauerpsalms beendet hatte, warf er sich in den Sattel, Don Rafael tat dasselbe und so jagten sie zusammen, auf die fliegenden Mähnen ihrer Rösser geneigt, die Savanne entlang. Der feuchte Wind, den die ausgetretenen Gewässer zurückwarfen, pfiff in ihren Haaren. Das unheildrohende Brüllen der Wassermasse näherte sich, untermischt mit dem hellen Ton der Glocke, von Minute zu Minute.
Schreibe einen Kommentar