Die Trapper in Arkansas – Band 2.13
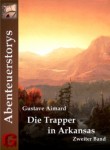 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 2
Zweiter Teil – Waktehno – der, welcher tötet
Kapitel 2 – Die Piraten
Es wurde Abend, ungefähr in der Mitte des Weges zwischen dem Lager der Mexikaner und demjenigen der Comanchen, als in einer von zwei hohen Hügeln eingeschlossenen Schlucht eine Anzahl von ungefähr vierzig Männern an mehreren Feuern lagerten, welche so verteilt waren, dass deren Schein ihre Gegenwart nicht verraten konnte.
Der seltsame Anblick, welchen die Gesellschaft Abenteurer mit düsterem Antlitz, wildem Blick und schmutzigen, wunderlichen Anzügen darbot, wäre ein würdiger Gegenstand für den satirischen Griffel Callots oder den Pinsel Salvator Rosas gewesen.
Die Männer, eine heterogene Mischung aller Nationalitäten, welche die zwei Welthälften von den Russen bis zu den Chinesen bevölkern, war die vollständigste Sammlung von Schurken, die man sich vorstellen kann. Räuber und Mörder ohne Heimat und Religion, ohne Treue und Glauben, der wahre Abschaum der Zivilisation, welche sie ausgestoßen und genötigt hatte, in den Prärien des Westens einen Zufluchtsort zu suchen. Sogar in jenen Einöden bildeten sie eine Gesellschaft für sich, kämpften bald gegen die Jäger, bald gegen die Indianer und übertrafen sich gegenseitig an Grausamkeit und Schurkereien.
Jene Männer waren mit einem Wort, was man dem allgemeinen Übereinkommen nach die Piraten der Prärien genannt hat.
Eine Bezeichnung, die in jeder Beziehung auf sie passt, da sie gleich ihren Namensbrüdern auf dem Meer, alle Flaggen aufziehen oder vielmehr mit Füßen treten, alle Reisenden anfallen, die sich allein in die Prärien wagen, die Karawanen angreifen und plündern, und, wenn sie keine andere Beute haben, sich hinterlistig im hohen Gras auf die Lauer legen, um die Indianer abzufangen, zu töten und damit die Prämie zu gewinnen, welche die väterliche Regierung der Vereinigten Staaten für das Haar eines Eingeborenen ausgesetzt hat, wie man in Frankreich die Köpfe der Wölfe bezahlt.
Die Bande wurde von dem Captain Waktehno, den wir schon Gelegenheit hatten, vorzuführen, befehligt.
Es herrschte unter jenen Räubern eine Aufregung, die auf ein geheimnisvolles Unternehmen schließen ließ. Einige putzten und luden ihre Gewehre, andere besserten ihre Kleidungsstücke aus, oder rauchten und tranken Mezcal, oder schliefen, in ihre zerlöcherten Mäntel eingewickelt.
Die gesattelten und zum Aufsitzen fertigen Pferde waren an Pfähle gebunden.
An verschiedenen Orten hatte man Schildwachen aufgestellt, die sich schweigend und unbeweglich, wie Standbilder von Erz, auf ihre lange Büchsen lehnten und für die Sicherheit aller wachten.
Die blassen Lichter des allmählich verlöschenden Feuers warfen rötliche Reflexe auf das Bild, welche den Piraten einen noch wilderen Ausdruck verliehen.
Der Captain schien sich in großer Unruhe zu befinden. Er ging mit langen Schritten unter seinen Untergebenen umher, stampfte zornig mit dem Fuß und hielt von Zeit zu Zeit inne, um den Lauten der Prärie zu lauschen.
Die Nacht wurde dunkler und dunkler, der Mond war verschwunden, der Wind heulte dumpf in den Bergen, die Räuber hatten sich einer nach dem anderen allmählich dem Schlummer überlassen.
Der Captain wachte noch allein.
Plötzlich glaubte er in der Ferne einen Schuss zu hören, dann einen zweiten, worauf die vorige Stille wieder eintrat.
»Was soll das bedeuten?«, murmelte der Captain zornig, »haben sich meine Schlingel etwa überfallen lassen?«
Dann hüllte er sich sorgfältig in seinen Mantel und ging mit großen Schritten in die Richtung, wo der Schuss gefallen war.
Die Finsternis war so groß, dass sich der Captain trotz seiner Ortskenntnis durch die Wurzeln und das Gestrüpp, die ihm bei jedem Schritt den Weg versperrten, nur langsam fortbewegen konnte. Mehre Male sah er sich genötigt, stehen zu bleiben, um sich zu orientieren, ehe er seinen Weg, den die Felsenblöcke und das Dickicht vor ihm ihn beständig zu verlassen nötigten, fortsetzen konnte.
Während einer dieser Haltepunkte glaubte er ein leises Rauschen in den Blättern und Zweigen zu hören, ähnlich demjenigen, welches durch den eiligen Lauf eines Menschen oder wilden Tieres im Dickicht verursacht wird.
Der Captain versteckte sich hinter den Stamm eines riesigen Anjoubaumes, ergriff seine Pistolen, lud sie, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein, und lauschte mit vorgestrecktem Kopf.
Alles war still um ihn. Es war zu jener geheimnisvollen Stunde der Nacht, wo die Natur zu schlafen scheint, und wo alle namenlosen Laute der Wildnis verstummen, um, nach der indianischen Redeweise, nur das Schweigen hörbar zu machen.
»Ich habe mich geirrt«, murmelte der Räuber und machte eine Bewegung, um wieder umzukehren. In dem Augenblick wiederholte sich das Geräusch deutlicher und näher und ein ersticktes Stöhnen folgte unmittelbar darauf.
»Bei Gott!«, sagte der Captain, »das fängt an, interessant zu werden, und ich muss es ergründen.«
Nach einigen Minuten eines schnellen Laufes sah er wenige Schritte vor sich den undeutlichen Umriss eines Menschen durch die Dunkelheit gleiten. Der Mensch, wer es immer auch sein mochte, schien mit Mühe zu gehen. Er stolperte bei jedem Schritt und hielt von Zeit zu Zeit inne, um Kräfte zu sammeln.
Zuweilen stieß er einen erstickten Seufzer aus. Der Captain warf sich ihm entgegen, um ihm den Weg zu versperren.
Als ihn der Fremde erblickte, stieß er einen Schrei des Schreckens aus, fiel auf beide Knie nieder und murmelte mit vor Entsetzen bebender Stimme: »Gnade! Gnade! Tötet mich nicht!«
»Was tausend!«, sagte der Captain erstaunt, »das ist ja Schwätzer! Wer Teufel hat ihn denn so zugerichtet!«
Er beugte sich zu ihm herab.
Es war wirklich der Führer.
Er war ohnmächtig.
»Dass dich die Pest, Dummkopf!«, murmelte der Captain ungeduldig, »wie soll ich ihn jetzt ausfragen?«
Aber der Pirat war ein Mann, der sich zu helfen wusste. Er steckte seine Pistolen wieder in den Gürtel und den Verwundeten aufhebend, lud er ihn auf seine Schulter.
Mit dieser Last beladen, die ihn keineswegs zu hindern schien, ging er mit hastigen Schritten den Weg, den er gekommen war, zurück und betrat wieder sein Lager.
Er legte den Führer neben ein halb verlöschtes Kohlenfeuer, auf welches er einige Arme voll trockenen Holzes warf, um es wieder zu beleben. Bald erlaubte ihm eine helle Flamme, den Mann, der ohne Besinnung zu seinen Füßen lag, näher zu betrachten.
Das Gesicht Schwätzers war erdfahl, ein kalter Schweiß war auf seiner Stirn und aus einer Wunde in der Brust floss das Blut in Strömen.
»Cascaras!«, murmelte der Captain, »der arme Teufel ist übel zugerichtet. Wenn er nur, ehe er abfährt, sagen kann, wer ihm so mitgespielt hat und was aus Kennedy geworden ist.«
Wie alle Waldläufer besaß auch der Captain einige praktische, medizinische Kenntnisse. Er wusste eine Schusswunde wohl zu behandeln.
In Folge der Pflege, die er dem Räuber angedeihen ließ, kam dieser in Kurzem wieder zu sich. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, öffnete die starren Augen und konnte ziemlich lange kein Wort reden. Indessen gelang es ihm, nach einigen vergeblichen Versuchen sich mithilfe des Captains aufrecht zu setzen. Er schüttelte den Kopf zum wiederholten Mal und sagte mit stockender Stimme traurig zu ihm: »Alles ist verloren, Captain! Unser Unternehmen ist gescheitert.«
»Tausend Teufel! …«, rief der Räuber aus und stampfte wütend mit dem Fuß. »Wie ist denn das Unglück über uns gekommen?«
»Das junge Mädchen ist ein Satan!«, fuhr der Führer mit immer schwächer werdender Stimme fort, indessen sein pfeifender Atem bewies, dass er nur noch wenige Augenblicke zu leben habe.
»Sage mir«, erwiderte der Captain, der den Ausruf des Verwundeten nicht verstanden hatte, »sage mir, wenn du kannst, was sich zugetragen hat, und wer dein Mörder ist, damit ich dich rächen kann.«
Ein düsteres Lächeln glitt mühsam über die bläulichen Lippen des Führers. »Der Name meines Mörders?«, sagte er in spöttischem Ton.
»Ja.«
»Es ist Donna Luz.«
»Donna Luz!«, rief der Captain erstaunt aufspringend aus, »unmöglich!«
»Hört!«, fuhr der Führer fort, »meine Stunden sind gezählt, bald werde ich tot sein. In meiner Lage pflegt ein Mann nicht mehr zu lügen. Lasst mich reden, ohne mich zu unterbrechen. Ich weiß nicht, ob ich Zeit haben werde, Euch alles zu sagen, bevor ich abgerufen werde, um dem Rechenschaft abzulegen, der alles weiß.«
»Rede«, sagte der Captain.
Und da die Stimme des Verwundeten immer schwächer und schwächer wurde, kniete er neben ihm nieder, um keines seiner Worte zu überhören.
Der Führer schloss die Augen, sammelte sich einige Minuten und sagte dann mühsam: »Gebt mir Branntwein!«
»Bist du toll, der Branntwein wird dich umbringen.«
Der Verwundete schüttelte den Kopf.
»Er wird mir die nötigen Kräfte geben, damit Ihr alles hören könnt, was ich Euch zu sagen habe. Bin ich nicht bereits halb tot?«
»Das ist wahr!«, murmelte der Captain.
»So zögert nicht«, fuhr der Verwundete, der ihn gehört hatte, fort, »ich habe Euch wichtige Dinge mitzuteilen.«
»Nun gut!«, murmelte der Räuber nach einigem Zögern, fasste nach seiner Feldflasche und führte sie an die Lippen des Führers.
Dieser trank ziemlich lange in gierigen Zügen. Eine fieberhafte Röte färbte seine Wangen, seine beinahe erloschenen Augen hellten sich auf und erhielten einen lebhaften Glanz.
»Jetzt«, sagte er mit ziemlich fester und lauter Stimme, »unterbrecht mich nicht. Sobald Ihr seht, dass ich schwächer werde, lasst Ihr mich trinken, vielleicht habe ich Zeit, Euch alles zu berichten.«
Der Captain machte eine zustimmende Bewegung, und Schwätzer begann.
Seine Erzählung währte lange, wegen der oftmaligen Unterbrechungen, zu denen ihn seine Schwäche zwang.
Als er geendet hatte, fügte er hinzu: »Wie Ihr seht, ist das Mädchen, wie ich schon früher gesagt habe, ein Satan. Sie hat Kennedy und mich getötet. Gebt es auf, sie zu fangen, Captain, es ist ein zu gefährliches Wild, Ihr werdet Euch ihrer nicht bemächtigen können.«
»Bah!«, sagte der Captain und runzelte die Stirn. »Meinst du, dass ich meine Pläne so leicht aufgebe?«
»Glück auf den Weg!«, murmelte der Führer, »was mich betrifft, so sind meine Geschäfte beendet, meine Rechnung ist abgeschlossen. Lebt wohl, Captain«, fügte er mit seltsamem Lächeln hinzu. »Ich fahre zum Teufel, wir werden uns dort unten schon wiedersehen! …«
Er stürzte nieder.
Der Captain wollte ihn aufrichten, – er war tot.
»Glückliche Reise«, murmelte er gleichgültig.
Er lud die Leiche auf seine Schultern, trug sie in das Dickicht, wo er ein Loch grub und sie hineinwarf. Nachdem er dieses Geschäft in wenigen Minuten beendet hatte, kam er zum Feuer zurück, hüllte sich in seinen Mantel, streckte sich, mit den Füßen gegen das Feuer, auf den Boden und schlief mit den Worten ein: »In einigen Stunden wird es Tag sein, dann werden wir sehen, was zu tun ist.«
Die Räuber schliefen nicht lange. Bei Sonnenaufgang war in dem Lager der Piraten alles in Bewegung. Sie machten sich zum Aufbruch bereit.
Anstatt seinen Plan aufzugeben, hatte der Captain im Gegenteil beschlossen, die Ausführung desselben zu beschleunigen, damit die Mexikaner nicht Zeit hätten, sich unter den weißen Trappern der Prärien Verbündete zu suchen, was das Gelingen unmöglich gemacht haben würde.
Sobald er sich versichert hatte, dass die von ihm erlassenen Befehle wohl begriffen worden seien, gab der Captain das Zeichen zum Aufbruch. Die Truppe machte sich auf Art der Indianer auf den Weg, indem sie nämlich dem Ort, an welchen sie sich begeben wollten, buchstäblich den Rücken kehrten.
Als sie an einer Stelle angekommen waren, die ihnen genügende Sicherheit zu bieten schien, stiegen die Piraten von den Pferden, vertrauten dieselben einigen entschlossenen Männern an und schickten sich an, indem sie wie Nattern am Boden hinkrochen oder von einem Zweig zum anderen und von Baum zu Baum sprangen, mit aller Vorsicht, welche man bei Überfällen zu brauchen pflegt, in das Lager der Mexikaner einzudringen.
Schreibe einen Kommentar