Comanchengold
Die Sonne steht als grellweiße Scheibe senkrecht am Himmel. Die Luft flimmert und der Wind, der durch die Cap Rocks weht, ist so heiß, als würde er aus einem Backofen kommen.
Es ist kurz nach Mittag, als Pete Lanner die Ausläufer dieses wüstenähnlichen Hügellandes erreicht.
Er schwitzt, seine Kehle ist rau und ausgetrocknet und der feine Staub, der die Luft erfüllt, hat sich auf seiner Haut festgesetzt und sein Gesicht mit einer Maske aus Schweiß und Sand bedeckt.
Er ist längst nicht mehr so schnell und beweglich wie noch am Morgen, kurz, nachdem sein Pferd in einen Präriehundebau getreten ist und sich den Vorderlauf gebrochen hat. Er schleppt sich jetzt nur noch mühsam vorwärts, ohne Sattel, ohne Wasserflasche und ohne Gewehr.
Seine Erschöpfung wird mit jedem Yard, den er zurücklegt, größer und der Durst macht ihn fast verrückt.
Er ist schon mehr als einmal in die Knie gegangen, aber er hat sich immer wieder aufgerafft und ist weitergelaufen. Wie eine Maschine stapft er stetig gen Norden, schwankend, zerschlagen und mit tonnenschweren Füßen.
Lanner ist ein Mann der Brasada, jenem Dornenbuschland, das sich im Westen von Texas zwischen den Flüssen Colorado, Brazos und Wichita bis weit nach Südosten hin erstreckt. Er kennt das mit tiefen Schluchten, Gräben, Mulden und gelben Kalksteinformationen durchzogene Land wie seine Westentasche.
Er weiß genau: Wenn er sich jetzt in den Sand setzt oder irgendwo in den Schatten eines Felsen legt, wird ihn die Sonne töten.
Deshalb läuft er zielstrebig in jene Richtung, in der er die nächste, von Menschen bewohnte Siedlung, vermutet. Am Fuß einer lang gezogenen Bodensenke bleibt er schließlich schwer atmend stehen und blickt sich Hilfe suchend um. Aber das Land um ihn herum scheint nur aus Felsen, Sand und Hitze zu bestehen und nirgendwo ist auch nur das geringste Anzeichen von Leben zu erkennen. Allmählich begreift Lanner, dass fast schon ein kleines Wunder nötig sein wird, wenn er diesen Tag überleben will.
Er beginnt deshalb lautlos zu fluchen.
Aber nur für wenige Augenblicke, dann läuft er weiter, trotz seiner Schwäche. Ihm ist klar, dass Fluchen alleine ihn nicht vorwärts bringt.
Er kommt jedoch nicht mehr allzu weit.
Die glühende Hitze, der Durst und die Erschöpfung fordern ihren Tribut.
Von einem Moment zum anderen wird ihm plötzlich schwarz vor Augen und er geht in die Knie. Stechende Schmerzen erfüllen seinen Körper.
Das ist das Ende, schießt es ihm durch den Kopf, bevor er das Bewusstsein verliert.
***
Als Pete Lanner wieder zu sich kommt, verspürt er Wärme. Dann öffnet er die Augen und sieht rote und gelbe Lichtpunkte aufblitzen. Er zuckt in wilder Panik zusammen und will aufschreien, aber dann erkennt er, dass er auf der Seite liegt und in ein Feuer starrt.
Die Flammen brennen klein und beinahe rauchlos und tauchen die umliegenden Felswände in orangefarbenes Licht. Als er den Kopf zur Seite dreht, stellt er fest, dass er sich in einer Höhle befindet.
Und er ist nicht allein.
Neben dem Feuer sitzt ein alter Comanche. Der Indianer hat die Beine verschränkt und ist trotz der Kühle der Wüstennacht nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Er ist unglaublich dürr, die Rippen zeichnen sich deutlich unter der Haut ab. Aschgraues Haar fällt ihm in sein Gesicht, das so hager und eingefallen ist, dass es im fahlen Schein des Feuers wie ein Totenschädel wirkt, der mit gegerbtem Leder überzogen ist. Seine Augen liegen in tiefen Höhlen und sein Mund ist nicht mehr als ein Strich aus zusammengepressten, blutleeren Lippen. Vor ihm liegt eine mit Perlen und Federn geschmückte Rassel auf dem Boden, zu seiner Rechten stehen mehrere tönerne Schalen und Schüsseln.
Als der Indianer erkennt, dass Pete die Augen aufgeschlagen hat, beugt er sich über eines dieser Gefäße, entnimmt ihm ein helles Pulver und wirft es ins Feuer.
Sofort steigt Rauch auf und ein seltsamer, bitterer Geruch erfüllt die Höhle.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Lanner immer ruhiger und entspannter wird, obwohl auf seinen Lippen tausend Fragen brennen.
»Wie kann ein Mann nur so dumm sein, zu Fuß durch dieses Land zu ziehen?«
Wie aus weiter Ferne klingt die Stimme des Indianers an sein Ohr.
Pete versucht sich zu rechtfertigen, zu erklären, dass er in Fort Elliott Vieh an die Armee verkaufen konnte und sein Pferd auf dem Weg nach Hause in einen Präriehundebau getreten ist. Aber stattdessen kommt nur ein jämmerliches Krächzen aus seiner Kehle. Der Comanche gibt daraufhin einen Laut von sich, der wie ein Grunzen klingt, beugt sich dann über ihn und hält ihm eine tönerne Schale an den Mund. Pete Lanner fühlt eine warme Flüssigkeit auf seinen aufgeplatzten Lippen, schluckt und wird danach erneut ohnmächtig.
Als er wieder zu sich kommt, sitzt der Indianer immer noch neben ihm.
»Wenn die Sonne wieder aufgeht, wirst du gesund sein. Dann kannst du nach Hause reiten.«
»Mein Pferd ist tot«, röchelt Lanner.
Der Comanche nickt wissend und deutet mit einer knappen Geste auf etwas, das sich hinter Lanners Rücken befindet. Im gleichen Augenblick hört Pete das Schnauben.
»Mein Pferd wird genügen, um dich damit zu deinen Leuten zu bringen.«
Lanners Augen gehen in die Richtung, aus der das Schnauben gekommen ist. Die Stelle liegt im Halbdunkel. Der schwache Schein des kleinen Feuers reicht nicht aus, um die ganze Höhle auszuleuchten, aber er genügt ihm, um die Umrisse des Pferdes zu erkennen.
Nachdem sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt haben, sieht er, dass es sich bei dem Tier um einen weiß gefleckten Pinto handelt. Er sieht jedoch noch etwas anderes.
Etwas, das dort fast den gesamten Boden bedeckt. Dieser Anblick ist so unglaublich, dass er sich die Hand auf den Mund pressen muss, um nicht laut zu schreien.
***
Eigentlich ist Lee Marlowe an diesem Morgen nur losgeritten, um auf der Südweide den Stand der Herde festzustellen und den Futterwuchs zu beobachten.
Der sehnige, dunkelhaarige Mann, der mit seinem Aussehen und seiner Art, sich zu bewegen, unwillkürlich an einen Indianer erinnert, ist einer der Besitzer der Drei Balken Ranch.
Das Anwesen liegt mitten in der Brasada.
Ein Umstand, der den Männern auf dieser Ranch alle Kraft abverlangt. Lee weiß genau, dass er keinen Moment in seinen Bemühungen, den Boden urbar zu machen, nachlassen darf, sonst ist er die längste Zeit Eigentümer dieser Ranch gewesen.
Die Brasada kennt keine Gnade.
Sie verzeiht den Menschen, die hier leben, keine Nachlässigkeit, sondern lauert ständig auf eine Möglichkeit, um das Land wieder in eine Wildnis zu verwandeln. Man kann also sagen, dass mit jedem neuen Tag auch ein neuer Kampf ums Überleben beginnt.
Lee Marlowe reitet also nicht nur zum Spaß auf die Südweide. Aber dann kommt, wie so oft in diesem Land, wieder alles ganz anders.
Es beginnt damit, dass er seinen Nachbarn und Freund Pete Lanner auf dem Überlandweg entdeckt. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, schließlich führt der Weg an Lanners Pferderanch vorbei. Ungewöhnlich ist nur, das Lees Freund scheinbar waffenlos und zu Fuß unterwegs ist. Ein Umstand, der in diesem Teil der Brasada einem Selbstmord gleichkommt. Es wimmelt hier nur so von skalplüsternen Indianern, Comancheros, Giftschlangen, Taranteln und Skorpionen. Dazu kommen noch Sträucher und Büsche, deren fingerlange Dornen nur darauf warten, einen unvorsichtigen Mann oder dessen Pferd aufzuspießen. Und dazu noch Wildrinder, Longhorns, die auch Schluchtlöwen oder Höllenbiester genannt werden und im Laufe der Jahre in dem Dornenbuschland Fähigkeiten entwickelt haben, die selbst Büffelwölfe und Jaguare veranlassen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Die Chance, in dieser Gegend längere Zeit ohne Pferd und noch dazu unbewaffnet zu überleben, ist also geringer als die eines Schneeballs auf einer glühenden Herdplatte.
Deshalb reitet er Lanner sofort entgegen und spricht ihn an.
»Hi Pete, ist es nicht ein bisschen gefährlich, so ohne Pferd und Waffen hier spazieren zu gehen?«
Lanner hebt den Kopf und bleckt die Zähne.
»Leck mich«, sagt er trocken.
Lee verzieht sein Gesicht zu einem breiten Grinsen.
Nach einem kurzen Wortwechsel lässt er Pete hinter sich aufsitzen und bringt ihn zu seiner Ranch, obwohl dies ein großer Umweg für ihn ist, wenn er danach noch zur Südweide will.
Aber Lanner ist schließlich sein Freund.
Der Ritt verläuft zunächst schweigsam.
Erst als sie am Küchentisch bei einer Tasse Kaffee sitzen, platzt es aus Lees Freund heraus.
Die Worte sprudeln nur so über Lanners Lippen.
»Das musst du dir einmal vorstellen, der ganze Boden war mit diesem Zeug bedeckt. Becher, Kerzenleuchter, Pokale, Münzen, alles aus purem Gold.«
»Woher willst du das so genau wissen?«
»Ich habe schließlich Augen im Kopf, außerdem hat er es mir ja erzählt.«
»Und woher stammt das ganze Zeug?«
Lanner macht eine ungeduldige Handbewegung.
»Irgendwelche spanischen Mönche und Konquistadoren haben diesen Schatz anscheinend in der Höhle deponiert, nachdem ihnen klar geworden war, dass ihre Chancen, die Cap Rocks lebend zu durchqueren, erheblich größer sind, wenn sie diese Dinge zurücklassen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, schließlich habe auch ich auf meinen Sattel und das Gewehr verzichtet, um diesem Backofen zu entkommen.«
»Und warum erzählst du mir das alles? Was hast du vor?«
Als Lee nach dieser Frage in das Gesicht seines Freundes blickt, kennt er die Antwort bereits.
Das Funkeln und Blitzen in Lanners Augen ist nicht zu übersehen.
»Ich muss diesen Indianer wiedersehen. Mir wäre es aber recht, wenn ich dabei einen Freund wie dich an meiner Seite hätte.«
Lee muss nicht lange für eine Antwort überlegen. Er schüttelt nur mitleidig den Kopf.
»Das halte ich für keine so gute Idee. Warum lässt du den Indianer nicht einfach in Ruhe, er hat dir schließlich das Leben gerettet.«
Lanners Kinn ruckt hoch und seine Augen werden so groß wie Spiegeleier.
»Bist du verrückt? Habe ich dir nicht gerade erzählt, dass der Alte in seiner Höhle auf einem Schatz sitzt, der uns alle zu reichen Männern machen könnte?«
»Mag sein, aber irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Warum hat der Comanche, wenn der Schatz tatsächlich so wertvoll ist, wie du erzählst, nicht schon längst etwas davon verkauft? Irgendwie gefällt mir das alles nicht. Ich glaube, es ist das Beste, wenn du die ganze Sache wieder vergisst.«
Pete Lanner springt auf.
Dabei ist er so ungestüm, dass der Stuhl, auf dem er gesessen hat, hinter ihm zu Boden poltert und sogar der schwere Holztisch in der Küche zu schwanken beginnt.
»Was zum Teufel redest du da? Die Rothaut sitzt auf einem Berg aus Gold und weiß nichts damit anzufangen. Was ist falsch daran, wenn ich mir einen Teil davon hole? Verdammt Lee, damit hätten wir beide bis an unser Lebensende ausgesorgt.«
Lee Marlowe hat darauf mehr als nur eine Antwort parat.
Er will seinem Freund gerade etwas von Anstand, Stolz und Ehre erzählen, als er im nächsten Augenblick ein Scharren hört.
Mit zwei, drei schnellen Schritten ist er an der Tür und reißt sie auf.
Ein junger Bursche von etwa achtzehn Jahren fällt ihm regelrecht in die Arme.
Er ist so dürr und knochig wie ein Wolf nach einem langen Winter, hat kurze, weizenblonde Haare und mehr Sommersprossen im Gesicht als Texas Einwohner.
Lee tritt zur Seite, lässt den jungen Mann ins Zimmer stolpern und wirft einen fragenden Blick auf seinen Freund.
Pete zuckt mit den Achseln.
»Das ist Mike Manson, er arbeitet seit ungefähr vier Wochen als Stallbursche für mich. Keine Ahnung, was er hier macht.«
»Ich denke mal, er hat gelauscht«, sagt Lee. »Habe ich recht?«
Er dreht den Kopf und sieht Mike dabei direkt in die Augen. Sein Gesicht wirkt jetzt hart und ausdruckslos.
Der weizenblonde Junge schüttelt aufgeregt den Kopf.
»Nein, habe ich nicht«, sagt er schnell.
Marlowes Meinung nach etwas zu schnell.
»Ich wollte Mister Lanner nur fragen, ob ich Feierabend machen kann. Die Pferde sind jetzt alle versorgt und ich würde gerne noch zum Fluss gehen, um Katzenfische zu angeln.«
Lanner nickt wohlwollend und schickt ihn mit einer knappen Geste wieder nach draußen.
»Du hast dich geirrt, Lee. Mike geht tatsächlich mehrmals in der Woche angeln.«
»Ich behaupte trotzdem, dass er lügt!«, sagt Marlowe knapp, während er dem Jungen durch das Küchenfenster nachblickt.
»Wie kommst du darauf?«
»Er hat gesagt, dass er Katzenfische angeln will. Warum geht er dann nach Norden, wenn der Fluss im Süden liegt?«
***
Es ist schon Mittag, als Lee das Haus seines Freundes verlässt.
Nachdenklich lenkt er das Pferd auf eine Hügelkette zu. Er kennt Pete Lanner nun schon seit mehr als zwei Jahren, aber so fremd wie heute war er ihm noch nie. Sein merkwürdiges Verhalten war schließlich nicht zu übersehen und auch das seltsame Glitzern in seinen Augen ist ihm nicht verborgen geblieben. Lee macht sich inzwischen so seine Gedanken.
Die Art seines Freundes war stets offen und ehrlich, aber seit der Sache mit dem Comanchen hat noch etwas anderes den Weg in sein Wesen gefunden. Es ist unübersehbar, es lässt seine Augen vor Begehrlichkeit funkeln und überzieht sein Gesicht mit einer hektischen Röte, sobald er nur davon spricht. Lee Marlowe ist erfahren genug, um zu wissen, dass dies nichts anderes ist als die unersättliche Gier nach Gold.
In seinem Bauch breitet sich langsam ein ungutes Gefühl aus. Er versucht es zu unterdrücken, aber es gelingt ihm nicht. Immer wieder ertappt er sich dabei, wie er sich im Sattel umdreht und von den Hügeln aus Lanners Anwesen beobachtet.
Als er schließlich die Hügelkette erreicht hat, bestätigt sich sein Gefühl.
Ein Pferd wiehert schrill, und einen Atemzug später sieht er, wie Pete Lanner vom Stall aus wie ein Verrückter nach Südosten galoppiert. In jene Richtung also, in der irgendwo das Lager des alten Comanchen liegen muss.
Kurz darauf kommt erneut Hufschlag auf. Marlowes Blick geht nach rechts und seine Revolverhand legt sich unwillkürlich auf die Waffe an seiner Hüfte.
Aus einer versteckten Bodenfalte heraus bewegen sich langsam drei Reiter.
Einer von ihnen ist ein Mexikaner mit einem wagenradgroßen Sombrero, der andere ein breitschultriger, grobschlächtiger Kerl, der wie ein Schollenbrecher oder Krautbauer wirkt.
Lees Rechte umklammert den Revolvergriff wie ein Schraubstock, als er den letzten Mann des Trios erkennt. Es ist niemand anderes als Mike Manson, jener weizenblonde Junge, der ihm schon bei seiner Ankunft auf Lanners Ranch unangenehm aufgefallen ist.
Schnell wird ihm klar, dass diese Männer auf Lanners Spur reiten.
Also hat Manson doch gelauscht.
Er muss nicht lange überlegen, was passieren wird, wenn diese Männer seinen Freund stellen.
Mit einem wilden Fluch zieht er sein Pferd herum und folgt den Reitern.
Drei Stunden und etliche Meilen später weiß Lee Marlowe, wie die ganze Sache enden wird.
Er weiß es in dem Moment, als er mit seinem Pferd auf eine Anhöhe zusteuert und ihm aus der lang gezogenen Talsenke am Fuß der Erhebung Schussdetonationen entgegenwehen. Er gibt seinem Tier die Sporen und zügelt es schließlich zwischen zwei haushohen Felsen.
Durch das Tal jagen vier Reiter.
Einer von ihnen ist Pete Lanner.
Weit im Sattel nach vorn gebeugt reitet er durch die Senke. Aber er hat keine Chance. Seine Verfolger sind in der Überzahl und halten alle Gewehre in den Händen. Auch wenn ein gezielter Schuss vom Rücken eines galoppierenden Pferdes kaum möglich ist, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Pete getroffen wird. Ob gezielt oder durch Zufall spielt letztendlich keine Rolle, der Kugelhagel, der durch die Senke peitscht, ist einfach zu dicht.
Lee hat diese Gedanken kaum zu Ende gebracht, als es tatsächlich so geschieht.
Lanners Pferd bricht unvermittelt in vollem Galopp zusammen.
Er überschlägt sich und fliegt durch die Luft. Er stürzt hart zu Boden, rafft sich benommen wieder auf und läuft ein paar Schritte. Dann trifft auch ihn eine Kugel. Der Aufprall des Geschosses wirbelt ihn einmal um die eigene Achse und er fällt danach wie ein leerer Getreidesack zu Boden.
Dort bleibt er reglos liegen.
Seine Verfolger umringen ihn und reden wie wild auf ihn ein.
Trotz der Entfernung kann Lee deutlich erkennen, wie sie zu ihren Worten hektisch mit den Armen rudern. Kurz darauf reiten sie weiter.
Als Lee eine Viertelstunde später sein Pferd neben dem Niedergeschossenen zügelt und aus dem Sattel gleitet, weiß er, dass Pete Lanner sterben wird.
Sein Freund liegt auf der Seite und röchelt unentwegt.
Eine Kugel hat ihn in den Rücken getroffen und auf seiner Brust ein faustgroßes Austrittsloch hinterlassen. Unentwegt sickert Blut aus der Wunde in den Sand.
Als Marlowes Schatten über den Sterbenden fällt, hebt dieser den Kopf.
»Verdammt Lee«, krächzt Lanner. »Du hattest wie immer recht. Aber diesmal kommt deine Warnung leider zu spät. Ich fürchte, mit mir geht es zu Ende.«
Lee Marlowe nickt bitter.
Er hat in seinem Leben oft genug gesehen, wie ein Mann zu Boden fällt, nachdem er von einer Kugel getroffen wurde. Inzwischen kann er bereits schon an der Art, wie jemand zu Boden geht, erkennen, ob jener wieder aufsteht oder nicht. Irgendwie ahnt er, dass sein Freund tödlich getroffen wurde. Nachdem er nun die roten Schaumbläschen auf Lanners Lippen gesehen hat, weiß er es genau.
»Was haben Manson und seine Freunde jetzt vor?«
»Sie wollen sich das Gold des Comanchen holen.«
»Was hast du ihnen erzählt?«
Lanner zuckt mit den Achseln und verzieht sein Gesicht daraufhin sofort zu einer schmerzvollen Miene.
»Viel zu viel«, sagt er, während ihm das Blut aus dem Mundwinkel rinnt.
»Verdammt Lee, ist das kalt hier. Du hast nicht zufällig einen Schluck Whisky dabei, der deinen alten Freund aufwärmen könnte?«
Lee schüttelt bedauernd den Kopf.
Es wundert ihn nicht, dass sich Petes Gedanken in den letzten Sekunden seines Lebens um so etwas Profanes wie Schnaps drehen.
Er kennt keinen Mann, der sich im Angesicht des Todes normal verhält.
Manche schreien, manche zerfließen vor Selbstmitleid, andere beginnen einfach nur zu reden.
Er stöhnt unvermittelt. Fast gleichzeitig fällt sein Kopf nach rechts und einen Herzschlag später ist er tot.
***
Vorsichtig folgt Lee der Spur des mörderischen Trios.
Er weiß durch Lanners Bericht in etwa, wo sich das Versteck des Comanchen befinden muss, und wird deshalb auch nicht unruhig, als die Fährte auf dem nackten Felsgestein eine ganze Weile beinahe unsichtbar bleibt. Als der Boden zwei Meilen später dann wieder sandiger wird, sieht er sich in seinen Vermutungen, wo die Schatzhöhle liegt, bestätigt.
Die Fährte führt ihn direkt auf ein hoch gelegenes Plateau, auf dem außer den obligatorischen Dornensträuchern auch vereinzelt Cottonwoods, Zedern und Palo Verde Bäume stehen.
Ein sicheres Zeichen, dass es hier irgendwo auch Wasser geben muss, obgleich davon weit und breit nichts zu sehen ist.
Der Anstieg ist mehr als beschwerlich.
Lee weiß inzwischen, dass die Männer vom Goldfieber besessen sind. Ohne dieses Fieber würde kein vernünftiger Mensch das Hochklettern auf dieses Plateau in Kauf nehmen. Der Weg ist so steil und unwegsam, dass man jeden Augenblick damit rechnen muss, vom Pferd zu stürzen und sich sämtliche Knochen zu brechen.
Unentwegt folgt er den Mördern seines Freundes und muss dabei nicht einmal besonders vorsichtig sein. Die Gier nach Gold hat bei ihnen jegliche Vernunft aus dem Kopf verbannt.
Dass er das Plateau erreicht, ist nur seiner Erfahrung und weisen Voraussicht zuzuschreiben, bei den anderen ist es einfach unwahrscheinliches Glück.
Lee zügelt sein Pferd inmitten einer dichten Zederngruppe, als er bemerkt, wie das Trio zielsicher auf einen Felsen zusteuert, das einem steinernen Finger gleich in den wolkenlosen Himmel ragt. Obwohl sie mindestens eineinhalb Meilen vor ihm sind, lassen ihn ihre Gesten und ihre Art zu reiten vermuten, dass die Männer ihr Ziel bald erreicht haben.
Fünf Minuten später werden seine Ahnungen bestätigt.
Am Fuß des Felsenfingers blitzt Waffenstahl auf, und als Lee die Augen zusammenkneift, kann er dort eine hagere Gestalt mit Federn im Haar erkennen, die mit einem Gewehr auf die Männer zielt.
Der Comanche sucht offensichtlich sofort die Entscheidung.
Lee Marlowe sieht sich in seinen Gedanken bestätigt, als der Indianer zu sprechen beginnt.
»Kehrt um, oder ihr werdet sterben!«
Die Worte sind in der Stille der Wüste, die nur durch das Krächzen eines Zopilotes unterbrochen wird, klar und deutlich zu verstehen.
Der Aasvogel fliegt mit weit ausgebreiteten Flügeln hoch am Himmel und es scheint, als würde er ahnen, dass er schon bald Nahrung finden wird. Die Kreise, die er über den Männern zieht, werden von Minute zu Minute immer enger.
»Hola Amigo!«, antwortet der Mexikaner und schwenkt seinen riesigen Sombrero.
»Warum so unfreundlich, wir sind nur drei durstige Reiter, die sich verirrt haben und Hilfe brauchen.«
Der Indianer schüttelt energisch den Kopf.
»Hierher verirrt sich kaum jemand, dazu ist der Anstieg viel zu steil und mühsam. Also hört auf mich anzulügen.«
Der Mexikaner zuckt mit den Schultern und verliert sich in irgendwelche Gespräche über Pete und dessen Dankbarkeit für seine Rettung.
Für einen Augenblick sieht es so aus, als würde der Comanche diesen Worten Gehör schenken.
Er winkt die Männer sogar heran.
Sie gleiten vom Rücken der Pferde und gehen lachend auf den Indianer zu.
Die Gier nach dem Comanchengold lässt sie alle Vorsicht vergessen. Sie rennen, schreien und brüllen wie Wölfe, die man von ihrem Mahl verjagt hat. Lee folgt ihnen stumm.
Die Entfernung zwischen ihm und den Männern beträgt ungefähr noch eine Steinwurfweite, als er plötzlich verharrt.
In der klaren Wüstenluft kann er deutlich sehen, dass der Indianer anscheinend einen Trumpf in der Hinterhand besitzt. Je näher ihm die Männer kommen, umso mehr beschäftigt er sich mit etwas, das sich an der Nordseite des Felsenfingers befindet. Da Marlowes Blick nicht von der Gier nach Gold getrübt ist, glaubt er zu erkennen, dass es sich dabei um eine Art Hebel handelt. Irgendeine Vorrichtung, mit der man etwas Bestimmtes in die Tat umsetzen kann.
Sekunden später weiß er auch, was es ist.
Als das Trio den Felsenfinger erreicht hat, ist der Indianer verschwunden, genauso wie der Hebel an der Seite des Felsens. Dafür beginnt das steinerne Monument plötzlich zu schwanken und neigt sich nach vorne.
Dann ist die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten.
Der Fels kracht donnernd und heulend auf die Männer nieder. In ihrer Gier nach dem Gold des Comanchen sind sie blindlings in ihr Verderben gelaufen. Die Steine zerquetschen sie wie Streichholzschachteln, die sich unter der Faust eines Betrunkenen biegen. Während die Männer in einer Wolke aus Staub, Geröll und Sand ihr Leben aushauchen, wird das Gelächter des alten Indianers einem Echo gleich zwischen den Felsen hin und her geworfen.
***
Die kreisrunde Mündung der altertümlichen Sharps-Flinte zeigt genau auf seinen Bauch, als sich die Staubwolke über dem Ort der Zerstörung verzogen hat.
Lee Marlowe schluckt trocken.
Er war Armeescout, Büffeljäger und Revolverheld.
Er kennt das Land wie seine Westentasche. Er ist hart und erfahren genug, um in diesem Land zu überleben. Trotzdem hat ihn der Indianer überrascht. Er taucht praktisch wie aus dem Nichts vor ihm auf.
»Steig auf dein Pferd und reite zurück.«
Im gleichen Moment weiß Lee, dass sein Leben an einem seidenen Faden hängt.
»Die Falle, die du vorbereitet hast, war perfekt. Hast du von Anfang an mit Schwierigkeiten gerechnet?«
Der Indianer zuckt vielsagend mit der Schulter und schweigt.
»Was hat dich davon abgehalten, mich ebenfalls zu töten?«, will Lee schließlich wissen.
»Du weißt alles, trotzdem bist du der Einzige, der noch bei klarem Verstand ist und dessen Augen bei dem Gedanken an das Gold nicht zu funkeln beginnen. Warum?«
»Gold alleine macht nicht glücklich. Dazu gehört schon mehr.«
Der Indianer nickt.
»Männer wie du sind wie das Salz der Erde, es sollte mehr davon geben. Ich wollte, Lanner wäre auch so gewesen, um die anderen ist es nicht schade.«
»Pete war mein Freund«, sagt Lee betroffen.
Der Comanche nickt.
»Ich weiß, er hat es mir erzählt, als er im Fieberwahn an meinem Feuer lag. Es wäre für uns alle besser gewesen, wenn er auf dich gehört hätte.«
Lee tritt so nahe neben den Indianer, dass sich ihre Schultern fast berühren.
»Ich wünschte, er hätte es getan … Verdammtes Gold«, murmelt er leise.
Mehr ist seiner Meinung nach dazu nicht zu sagen.
ENDE
Copyright © 2013 by Kendall Kane
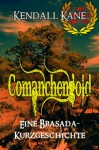
Schreibe einen Kommentar