Die Brille des Teufels – III
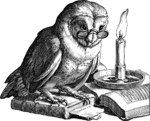 Die Brille des Teufels
Die Brille des Teufels
Nach dem Englischen von Wilkie Collins
Diese Geschichte erschien ursprünglich in der New Yorker Zeitschrift The Spirit of the Times am 20. Dezember 1879 als The Magic Spectacles. Sie wurde unter demselben Titel in The Seaside Library im Juni 1880 nachgedruckt. In Großbritannien erschien es unter Wilkies bevorzugtem Titel The Devil’s Spectacles in lokalen Zeitungen, darunter dem Bath Herald in zwei Teilen am 20. und 27. Dezember 1879.
Im Januar 1887 schrieb Collins eine Notiz zu The Devil’s Spectacles, Love’s Random Shot und Fie! Fie! Or, the Fair Physician: »Diese Geschichten haben in Zeitschriften ihren Zweck erfüllt, sind aber einer Wiederveröffentlichung in Buchform nicht würdig. Sie wurden in Eile geschrieben, und je eher sie in den Wassern des Vergessens ertränkt werden, desto besser. Ich wünsche, dass sie nach meinem Tod nicht wieder veröffentlicht werden.
Sie wurden alle aus der Sammlung von Kurzgeschichten Little Novels ausgeschlossen, die im März 1887 veröffentlicht wurde.
Collins’ eigene Sehkraft hatte sich stark verschlechtert, als er The Devil’s Spectacles schrieb. Er erhielt 35 Pfund für die Geschichte.
III
Der Test der Brille
Die erste Person, der ich bei meiner Rückkehr ins Haus begegnete, war der Butler. Er kam mir in der Halle entgegen, mit einer quittierten Rechnung in der Hand, die ich ihn hatte bezahlen lassen. Der Betrag belief sich auf fast hundert Pfund, und ich hatte ihn sofort bezahlt.
»Gibt es keinen Rabatt?«, fragte ich und schaute auf die Quittung.
»Die Parteien erwarten Bargeld, Sir, und berechnen entsprechend.«
Er sah so respektabel aus, als er diese Antwort gab, er hatte uns so viele Jahre gedient, dass ich eine unwiderstehliche Versuchung verspürte, die Teufelsbrille an dem Butler auszuprobieren, bevor ich es wagte, die Damen meiner Familie durch sie zu betrachten. Unser ehrlicher alter Diener wäre ein hervorragender Test.
»Ich fürchte, meine Sehkraft lässt mich im Stich«, sagte ich.
Mit dieser überaus einfachen Erklärung setzte ich die Brille auf und schaute den Butler an.
Der Saal wirbelte mit mir herum; bei meinem Ehrenwort, ich zittere und werde kalt, während ich jetzt davon schreibe. Septimus Notman hatte die Wahrheit gesagt!
In einem Augenblick wurde das Herz des Butlers abscheulich sichtbar – ein fettes Organ, gesehen durch das Medium der Höllenbrille. Der Gedanke in ihm war für mich in diesen Worten deutlich lesbar: »Denkt mein Herr, ich gebe ihm die fünf Prozent von der Rechnung? Ungeheuerliche Gemeinheit, sich in die Pfründe des Butlers einzumischen.«
Ich nahm meine Brille ab und steckte sie in meine Tasche.
»Sie sind ein Dieb«, sagte ich zu dem Butler. Sie haben das Diskontgeld dieser Rechnung – fünf Pfund bis auf ein oder zwei Schilling – in Ihrer Tasche. Schicken Sie Ihre Rechnungen ein; Sie verlassen meinen Dienst.«
»Morgen, Sir, wenn Sie wollen!«, antwortete der Butler entrüstet. »Nachdem ich Ihrer Familie fünfundzwanzig Jahre lang gedient habe, als Dieb bezeichnet zu werden, weil ich nur meine Nebeneinkünfte genommen habe, ist eine Beleidigung, Mr. Alfred, die ich nicht verdient habe.«
Er hielt sich das Taschentuch vor die Augen und verließ mich.
Es war wahr, dass er uns ein Vierteljahrhundert lang gedient hatte; es war auch wahr, dass er seine Nebeneinkünfte genommen und darüber geflunkert hatte. Aber er hatte seine ausgleichenden Tugenden. Als ich ein Kind war, hatte er mich so manches Mal auf seinem Schoß reiten lassen und mir so manches Mal Wein und Wasser gestohlen. Sein Kellerbuch war immer ehrlich geführt worden; und seine Frau selbst gab zu, dass er ein vorbildlicher Ehemann war. Bei anderen Gelegenheiten hätte ich mich daran erinnern sollen, ich hätte gefühlt, dass ich voreilig gewesen war, und hätte ihn um Verzeihung gebeten. Diesmal empfand ich nicht das geringste Mitleid mit ihm, und ich wankte keinen Augenblick in meinem Entschluss, ihn wegzuschicken. Welche Veränderung war über mich gekommen?
Die Tür der Bibliothek öffnete sich, und ein alter Schulkamerad und Studienfreund von mir schaute heraus.
»Ich dachte, ich hätte Ihre Stimme in der Halle gehört«, sagte er, »ich warte schon seit einer Stunde auf Sie«.
»Gibt es etwas sehr Wichtiges?«, fragte ich und führte ihn zurück in die Bibliothek.
»Nichts, was für Sie von der geringsten Bedeutung wäre«, antwortete er bescheiden.
Ich wollte keine weitere Erklärung. Mehr als einmal hatte ich ihm schon Geld geliehen, und früher oder später hatte er es mir immer zurückgezahlt.
»Noch ein kleines Darlehen?«, erkundigte ich mich mit einem freundlichen Lächeln.
»Ich schäme mich wirklich, dich noch einmal zu fragen, Alfred. Aber wenn du mir fünfzig Pfund leihen könntest – sieh dir nur diesen Brief an?«
Er machte irgendeinen Scherz, der durch das kuriose Aussehen der Brille nahegelegt wurde. Ich war zu sehr beschäftigt, um seinen Sinn für Humor zu erkennen. Was hatte er gerade zu mir gesagt? Er hatte gesagt: »Ich schäme mich, Sie noch einmal zu fragen.« Und was hatte er gedacht, während er sprach? Er hatte gedacht: Wenn man eine Milchkuh zur Verfügung hat, wer außer einem Dummkopf würde das nicht ausnutzen?
Ich reichte ihm den Brief zurück (von einem Anwalt, der mit einem Verfahren drohte) und sagte in meinem härtesten Ton: »Es ist nicht opportun, Ihnen diesmal zu helfen.«
Er starrte mich an wie ein vom Donner gerührter Mann.
»Ist das ein Scherz, Alfred?«, fragte er.
»Sehe ich aus, als würde ich scherzen?«
Er hob seinen Hut. »Es gibt nur eine Entschuldigung für dich«, sagte er. »Deine gesellschaftliche Stellung ist zu viel für dein schwaches Gehirn – dein Geld ist dir in den Kopf gestiegen. Guten Morgen.«
Ich war ihm für allerlei freundliche Dienste in der Schule und auf dem College zu Dank verpflichtet gewesen. Er war ein ehrenwerter Mann und ein treuer Freund. Wenn das Gefühl seiner eigenen geringen Mittel ihn zu Unrecht verächtlich gegenüber reichen Leuten machte, war das zweifellos ein Fehler (in meinem Fall ein ärgerlicher Fehler). Aber wer ist schon vollkommen? Und was sind fünfzig Pfund für mich? Das hätte ich einmal fühlen sollen, bevor er Zeit genug gefunden hätte, zur Tür zu kommen. Wie die Dinge lagen, ließ ich ihn gehen und wähnte mich eines gemeinen Mitläufers, der mich nur wegen meines Geldes schätzte, entledigt.
Da ich nun frei war, die Damen zu besuchen, läutete ich und fragte, ob meine Mutter zu Hause sei. Sie war in ihrem Boudoir. Und wo war Fräulein Cecilia? Auch im Boudoir.
Als ich das Zimmer betrat, fand ich Besucher im Weg, und ich verschob die Brillenprobe, bis sie sich verabschiedet hatten. Gerade als sie gehen wollten, kündigte ein donnerndes Klopfen an der Tür weiteren Besuch an. Diesmal entkamen wir glücklicherweise ohne schlimmere Folgen als die Übergabe von Karten. Wir hatten tatsächlich zwei Minuten für uns. Ich ergriff die Gelegenheit, meine Mutter daran zu erinnern, dass ich von Natur aus unzugänglich für die Ansprüche der Gesellschaft sei und dass wir das Haus für eine halbe Stunde oder so für uns allein haben könnten.
»Sagen Sie unten Bescheid«, sagte ich, »dass Sie nicht zu Hause sind.«
Meine Mutter – prächtig in ihrer alten Spitze, ihrem bewundernswert frisierten grauen Haar und ihrem fein fallenden Gewand aus violetter Seide – schaute über den Kamin zu Cecilia – groß und träge und schön, mit lieblichen braunen Augen, üppigem schwarzen Haar, einem warm-blassen Teint und einem bernsteinfarbenen Kleid – und sagte zu mir: »Du vergisst Cecilia. Sie mag die Gesellschaft.«
Cecilia schaute meine Mutter mit einem Anflug von träger Überraschung an. »Was für ein außergewöhnlicher Fehler!«, antwortete sie. »Ich hasse die Gesellschaft.«
Meine Mutter lächelte – läutete – und gab den Befehl – nicht zu Hause. Ich brachte meine Brille hervor. Es gab einen Aufschrei, weil sie so hässlich war. Ich schob die Schuld auf meinen Augenarzt und wartete auf das, was zwischen den beiden Damen folgen würde. Meine Mutter sprach. Daraufhin sah ich meine Mutter an.
Ich gebe zuerst ihre Worte wieder, dann ihre Gedanken in Klammern.
»Du hasst also die Gesellschaft, meine Liebe? Hast du deine Meinung in letzter Zeit nicht geändert?« (Es ist ihr egal, wie sie lügt, solange sie sich bei Alfred einschmeicheln kann. Falsches Geschöpf.)
Ich berichte Cecilias Antwort nach demselben Schema.
»Verzeihen Sie; ich habe meine Meinung nicht im Geringsten geändert – ich hatte nur Angst, sie zu äußern. Ich hoffe, ich habe keinen Anstoß erregt, indem ich sie jetzt ausspreche.« (Sie kann ohne Klatsch und Tratsch nicht existieren, und dann versucht sie, ihn auf mich zu übertragen. Weltliches altes Luder!)
Was ich anfing, von meiner Mutter zu denken, schäme ich mich, festzuhalten. Was ich von Cecilia dachte, lässt sich in zwei Worten ausdrücken. Ich war begieriger denn je, den Engel der Schule zu sehen, die gute und liebe Zilla.
Meine Mutter unterbrach den weiteren Verlauf meiner Nachforschungen. »Nimm diese scheußliche Brille ab, Alfred, oder überlass uns unseren Besuchern. Ich sage nicht, dass deine Sehkraft nicht nachlässt; ich sage nur, dass du deinen Augenarzt wechseln sollst.«
Ich nahm die Brille ab, umso bereitwilliger, als ich begann, mich wirklich vor ihr zu fürchten. Das Gespräch zwischen den Damen ging weiter.
»Dein Geständnis ist seltsam, meine Liebe«, sagte meine Mutter zu Cecilia. »Darf ich fragen, welches Motiv eine so junge Dame haben kann, die Gesellschaft zu hassen?«
»Nur das Motiv, mich verbessern zu wollen«, antwortete Cecilia. »Wenn ich ein wenig mehr von den modernen Sprachen wüsste, und wenn ich beim Aquarellieren etwas Besseres als eine schwache Amateurin wäre, würdest du mich vielleicht für würdiger halten, Alfreds Frau zu werden. Aber die Gesellschaft ist immer im Weg, wenn ich mein Buch aufschlage oder meine Pinsel in die Hand nehme. In London habe ich keine Zeit für mich und ich kann es wirklich nicht verbergen, das frivole Leben, das ich führe, ist nicht nach meinem Geschmack.«
Ich fand das – (meine Brille war ja in der Tasche, Sie erinnern sich) – sehr gut und sehr schön gesagt. Meine Mutter schaute mich an.
»Ich bin ganz der Meinung von Cecilia«, sagte ich und erwiderte den Blick. »Wir können nicht damit rechnen, in London von morgens bis abends fünf Minuten für uns zu haben.«
Während ich sprach, klopfte es erneut an der Haustür, was meine Ansichten lautstark unterstützte. Wir wagen es nicht einmal, aus dem Fenster zu schauen», bemerkte ich, »aus Angst, die Gesellschaft könnte im selben Moment hochschauen und sehen, dass wir zu Hause sind.
Meine Mutter lächelte. »Ihr seid wirklich zwei bemerkenswerte junge Leute«, sagte sie mit einem Hauch von satirischer Nachsicht – und hielt einen Moment inne, als ob ihr eine Idee gekommen wäre, die mehr als gewöhnlich der Erwägung wert war. Wäre ihr Blick in diesem Augenblick nicht auf mich gerichtet gewesen, ich glaube, ich hätte meine Brille aus der Tasche geholt.
»Ihr seid euch beide so einig in eurer Abneigung gegen die Gesellschaft und eurer Verachtung für London«, fuhr sie fort, »dass ich es als gute Mutter für meine Pflicht halte, euer Leben ein wenig mehr in Einklang mit eurem Geschmack zu bringen, wenn ich kann. Du beklagst dich, Alfred, dass du dich nie darauf verlassen kannst, fünf Minuten mit Cecilia für dich zu haben, Cecilia beklagt sich, dass sie in ihrem lobenswerten Bemühen, ihren Geist zu verbessern, ständig unterbrochen wird. Ich biete euch beiden an, den ganzen Tag für euch zu haben, Woche für Woche, für die nächsten drei Monate. Wir werden den Winter in Long Fallas verbringen.«
Long Fallas war unser Landsitz. Es gab keine Jagd; die Schießerei war verpachtet; der Ort war sieben Meilen von der Stadt Timbercombe und dem Bahnhof entfernt; und unser nächster Nachbar war ein junger ritualistischer Geistlicher, von dem im Dorf berichtet wurde, dass er sich zu Tode hungerte. Ich lehnte den außergewöhnlichen Vorschlag meiner Mutter ohne einen Moment des Zögerns ab. Cecilia nahm ihn mit der bereitwilligsten und süßesten Unterwerfung an.
Dies war unsere erste offene Meinungsverschiedenheit. Auch ohne die Brille konnte ich sehen, dass meine Mutter dies als gutes Zeichen wertete. Sie hatte im Frühjahr in unsere Heirat eingewilligt, ohne im Geringsten ihre Meinung zu ändern, dass die engelsgleiche Zilla die richtige Frau für mich sei.
»Klärt das unter euch, meine Lieben«, sagte sie und verließ ihren Stuhl, um nach ihrer Arbeit zu sehen.
Cecilia stand sofort auf, um ihr die Mühe zu ersparen.
Sobald sie mir den Rücken zudrehten, setzte ich die schreckliche Brille auf. Gibt es in der Anatomie so etwas wie eine Rückenansicht des Herzens? Ja, wenn man durch die Teufelsbrille schaut, schon.
Die privaten Empfindungen meiner Mutter präsentierten sich mir wie folgt: »Wenn sie sich nicht in einem Winter in Long Fallas gründlich überdrüssig werden, gebe ich alle Menschenkenntnis auf. Er wird Zilla noch heiraten.«
Cecilias Motive drückten sich mit durchsichtiger Schlichtheit in diesen Worten aus: »Seine Mutter rechnet fest damit, dass ich Nein sage. So schrecklich die Aussicht auch ist, ich werde sie enttäuschen, indem ich Ja sage.«
Schrecklich wie die Aussicht ist war in meinen Augen ein sehr abscheulicher Ausdruck, wenn man bedenkt, dass ich persönlich in die Aussicht einbezogen war. Der schelmische Test meiner Mutter über unsere gegenseitige Zuneigung stellte sich mir nun im Licht eines vernünftigen Vorgehens dar. In der Einsamkeit von Long Fallas sollte ich sicher herausfinden, ob Cecilia mich um meines Geldes oder um meiner selbst willen heiraten wollte. Ich verbarg meine Brille und sagte zunächst nichts. Aber später, als meine Mutter den Salon betrat, um zum Abendessen auszugehen, wich ich ihr aus, durchaus bereit, nach Long Fallas zu gehen. Cecilia kam ebenfalls zum Essen gekleidet herein. Sie hatte noch nie so unwiderstehlich reizend ausgesehen, wie als sie von meinem Meinungswechsel erfuhr.
»Was für eine glückliche Zeit wir haben werden«, sagte sie und lächelte, als ob sie es wirklich meinte.
Sie gingen weg zu ihrer Party. Ich war in der Bibliothek, als sie zurückkamen. Als ich die Kutsche vor der Tür halten hörte, ging ich in die Halle und wurde auf dem Weg zu den Damen plötzlich von einer Männerstimme aufgehalten.
»Vielen Dank, ich bin jetzt in der Nähe des Hauses.«
Es folgte die Stimme meiner Mutter: »Ich werde Ihnen Bescheid geben, wenn wir aufs Land fahren, Sir John. Werden Sie zu uns herüberreiten?«
»Mit dem größten Vergnügen. Gute Nacht, Miss Cecilia.« Der Tonfall, in dem diese letzten vier Worte gesprochen wurden, war nicht zu überhören. Sir Johns Akzent drückte eine unbeschreibliche Zärtlichkeit aus. Ich zog mich wieder in die Bibliothek zurück.
Meine Mutter kam herein, gefolgt von ihrer charmanten Begleiterin.
»Hier gibt es eine neue Komplikation«, sagte sie. »Cecilia will nicht nach Long Fallas gehen. Ich fragte, warum.
Cecilia antwortete, ohne mich anzuschauen: »Oh, ich habe meine Meinung geändert.«
Sie wandte sich zur Seite, um meiner Mutter den Pelzmantel abzunehmen.
Ich zog sofort meine Brille zu Rate und erhielt meine Information in dieser mysteriösen Form: »Sir John geht nach Timbercombe.«
Sehr kurz, und doch deutet es auf mehr als eine Interpretation hin. Eine kleine Untersuchung machte die Fakten klarer. Sir John war einer der Gäste beim Dinner gewesen, und er und Cecilia hatten sich wie alte Freunde die Hände geschüttelt. Auf den Wunsch meiner Mutter hin war er ihr vorgestellt worden. Er hatte einen so ausgezeichneten Eindruck gemacht, dass sie ihn einen Teil des Heimweges in ihrer Kutsche mitgenommen hatte. Sie hatte auch herausgefunden, dass er im Begriff war, einen Verwandten zu besuchen, der in Timbercombe lebte (ich glaube, das wurde bereits als unsere nächste Stadt erwähnt). Eine weitere Gelegenheit mit der Brille vervollständigte meine Entdeckungen. Sir John hatte Cecilia einen (erfolglosen) Heiratsantrag gemacht, und da er immer noch unsterblich in sie verliebt war, wollte er nur eine günstige Gelegenheit haben, ihr erneut einen Antrag zu machen. Der ausgezeichnete Eindruck, den er auf meine Mutter gemacht hatte, war nun vollkommen verständlich.
Hatte Cecilia Angst vor Sir John oder Angst vor sich selbst, als sie sich weigerte, ihrem abgewiesenen Liebhaber diese andere Gelegenheit zu geben? Meine Brille verriet mir, dass sie es bewusst ablehnte, sich dieser Frage zu stellen, selbst in ihren Gedanken.
Unter diesen Umständen wurde der Versuch einer tristen Winterresidenz in Long Fallas in meinen Augen wertvoller denn je. Allein konnte Cecilia erfolgreich den Schein wahren und andere Menschen täuschen, mich jedoch nicht. Aber in Verbindung mit Sir John bestand die Möglichkeit, dass sie den wahren Stand ihrer Gefühle offen verriet. Wenn ich der bevorzugte Mann war, würde sie mir natürlich lieber sein als je zuvor. Wenn nicht (mit einem besseren Beweis als der Teufelsbrille, um mich zu rechtfertigen), musste ich nicht zögern, die Verlobung zu lösen.
»Zweite Gedanken sind nicht immer die besten, liebe Cecilia«, sagte ich. »Tu mir einen Gefallen. Lass uns Long Fallas ausprobieren, und wenn wir den Ort nicht ertragen können, lass uns nach London zurückkehren.«
Cecilia sah mich an und zögerte – sah meine Mutter an und fügte sich Long Fallas auf die süßeste Weise. Je mehr sie insgeheim zerstritten waren, desto besser schienen sich die beiden Damen zu verstehen.
Wir fuhren erst drei Tage später aufs Land. Das Zusammenpacken war eine ernste Angelegenheit, und meine Mutter verlängerte die Verzögerung durch einen Besuch bei ihrer Nichte in der Schule auf dem Land. Sie hielt den Besuch vor Cecilia geheim. Aber selbst, als wir allein waren und ich nach Zilla fragte, erhielt ich nur eine sehr kurze Antwort. Sie hob nur ihre Augen zum Himmel und sagte: »Ganz reizend!
Schreibe einen Kommentar