Die Trapper in Arkansas – Band 2.14
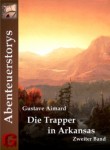 Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Gustave Aimard (Olivier Gloux)
Die Trapper in Arkansas Band 2
Zweiter Teil – Waktehno – der, welcher tötet
Kapitel 3 – Die Sendung
Der Doktor hatte, wie wir in einem früheren Kapitel bereits erzählt haben, das Lager der Mexikaner verlassen, um im Auftrag von Donna Luz dem Schwarzen Hirsch eine Botschaft zu überbringen.
Wie alle Gelehrten, deren Name auf us endet, war auch der Doktor, trotz des besten Willens von der Welt, von Natur aus sehr zerstreut.
Anfangs zerbrach er sich, nach Art seiner Kollegen, den Kopf, um den Sinn der, wie er meinte, etwas kabbalistischen Worte, die er dem Trapper hinterbringen sollte, zu erraten.
Er konnte nicht begreifen, welche Hilfe ein halbwilder Mensch, der allein in der Prärie lebte und dessen Leben mit Jagen und dem Aufstellen von Biberfallen ausgefüllt war, seinen Freunden leisten könne.
Die Bereitwilligkeit, mit der er die Sendung übernommen hatte, fand nur in der treuen Freundschaft, welche er für die Nichte des Generals hegte, ihre Erklärung. Trotzdem er sich keinerlei günstigen Erfolg davon versprach, hatte er sich doch entschlossen auf den Weg gemacht, in der Hoffnung, die Unruhe des jungen Mädchens dadurch zu beschwichtigen. Er hatte, mit einem Wort, eher den Wunsch eines Kranken erfüllen wollen, als etwas wirklich Wichtiges zu unternehmen.
Daher war er, statt, wie er es gesollt hätte, sich im gestreckten Galopp zum Hatto des Schwarzen Hirsches zu begeben, in der festen Überzeugung, dass die Botschaft, die man ihm aufgetragen hatte, eine überflüssige sei, vom Pferd gestiegen, hatte die Zügel desselben über den Arm gehängt und fing an, Pflanzen zu suchen, in welches Geschäft er sich so gründlich vertiefte, dass er die Worte der Donna Luz sowie die Ursache, weshalb er das Lager verlassen hatte, gänzlich vergessen.
Unterdessen verging die Zeit. Die Hälfte des Tages war bereits verstrichen. Der Doktor, der längst hätte zurückgekehrt sein sollen, war noch nicht wieder da.
Die Sorge um ihn war groß im mexikanischen Lager.
Der General und der Captain hatten alles zu einer energischen Gegenwehr, für den Fall, dass sie angegriffen würden, vorbereitet.
Niemand erschien.
In der Umgebung herrschte die größte Stille. Schon fingen die Mexikaner an zu glauben, dass sie ein falscher Lärm geschreckt habe.
Nur Donna Luz fühlte, wie ihre Besorgnis von Stunde zu Stunde wuchs, und ihre Augen schauten in der Ebene umsonst nach dem wiederkehrenden Boten aus.
Plötzlich kam es ihr vor, als ob das hohe Gras der Prärie sich in ungewöhnlicher Weise wellenförmig bewege.
Es regte sich in der Tat kein Lüftchen, eine drückende Hitze herrschte allenthalben, die Blätter der Bäume, auf welche die Sonne brannte, waren unbeweglich, nur das hohe Gras fuhr fort, sich langsam und wellenförmig zu bewegen.
Ja, was besonders merkwürdig war, diese kaum merkliche Bewegung, die zu erkennen, schon ein gewisser Grad von Aufmerksamkeit gehörte, war nicht allgemein, sondern zeigte sich im Gegenteil als fortschreitend und rückte mit einer Regelmäßigkeit heran, die auf eine leitende Ursache schließen ließ, sodass, als die zunächst befindlichen Gräser anfingen, sich zu bewegen, die entfernteren in die frühere Ruhe zurückkehrten, aus der sie nicht wieder gestört wurden.
Die an den Verschanzungen aufgestellten Schildwachen wussten nicht, was sie von der Bewegung, die ihnen unbegreiflich war, denken sollten.
Der General beschloss, als erfahrener Soldat, die Sache zu untersuchen, denn obgleich er noch nie mit Indianern zu tun gehabt hatte, so war ihm ihre Art, Krieg zu führen, doch genügsam erzählt worden, um ihn zu der Vermutung zu berechtigen, dass irgendeine List dahinter stecke.
Da er das Lager, das aller seiner Kräfte zur Verteidigung bedurfte, nicht von Mannschaft entblößen wollte, beschloss er, das Abenteuer selbst zu wagen und auf Kundschaft auszugehen.
In dem Augenblick, als er sich anschickte, die Verschanzungen zu erklettern, hielt ihn der Captain zurück, indem er ehrerbietig den Arm auf seine Schulter legte.
»Was wollen Sie, mein Freund?«, fragte der General und drehte sich um.
»Ich möchte Ihnen, mit Ihrer Erlaubnis, eine Frage vorlegen, General«, antwortete der junge Mann.
»So tun Sie es.«
»Sie verlassen das Lager?«
»Ja.«
»Wahrscheinlich um auf Kundschaft auszugehen?«
»Um auf Kundschaft auszugehen, ganz recht.«
»Die Sendung kommt mir zu, General.«
»Warum das?«, fragte der General erstaunt.«
»Mein Gott, General, das ist sehr einfach, ich bin nur ein armer Teufel von einem Subaltern-Offizier, der Ihnen alles verdankt.«
»Weiter?«
»Die Gefahr, die ich laufen würde, gesetzt, dass es eine solche gibt, würde den Erfolg Ihrer Reise in nichts hindern, indessen …«
»Indessen?«
»Wenn Sie getötet werden?«
Der General machte eine Bewegung.
»Man muss alles bedenken«, fuhr der Captain fort, »wenn man solche Feinde wie die, welche uns bedrohen, vor sich hat.«
»Das ist richtig, weiter?«
»Nun denn, das Unternehmen würde scheitern und keiner von uns würde ein zivilisiertes Land wiedersehen. Sie sind der Kopf, wir Übrigen sind nur die Arme, bleiben Sie daher im Lager.«
Der General besann sich einige Augenblicke, dann drückte er herzlich die Hand des jungen Mannes und sagte: »Ich bin Ihnen dankbar, doch muss ich mit eigenen Augen sehen, was man gegen uns im Schilde führt. Die Sache ist zu wichtig, als dass ich sie selbst Ihnen überlassen könnte.«
»General, Sie müssen bleiben«, fuhr der Captain dringender fort, »wenn es nicht unsertwegen ist, so tun Sie es wegen Ihrer Nichte, jenem unschuldigen, schwachen Geschöpf, das, wenn Ihnen ein Unglück zustieße, allein und verlassen unter wilden Völkerschaften sein würde, ohne Stütze und ohne einen Beschützer. Was liegt an meinem Leben, der ich ohne Angehörige bin und Ihrer Güte alles verdanke? Die Stunde ist gekommen, wo ich Ihnen meine Dankbarkeit beweisen kann, lassen Sie mich meine Schuld abtragen.«
»Aber«, wollte der General einwenden.
»Sie wissen wohl, dass, wenn ich Sie bei Donna Luz ersetzen könnte, so würde ich es mit Freuden tun. Doch bin ich noch zu jung, um eine so wichtige Aufgabe zu übernehmen. Lassen Sie mich daher Ihre Stelle einnehmen, General, sie kommt mir zu.«
Es gelang ihm, den alten Offizier halb gegen seinen Willen zu bewegen. Er schwang sich auf die Verschanzungen, überstieg sie mit einem Sprung und nachdem er dem General ein letztes Lebewohl zugewinkt hatte, entfernte er sich mit schnellen Schritten.
Der General folgte ihm mit den Augen, solange er ihn sehen konnte, dann fuhr er mit der Hand über seine sorgenvolle Stirn und murmelte: »Wackerer Bursche! Vortreffliches Herz.«
»Wohl wahr, Onkel?«, antwortete Donna Luz, die sich ihm ungesehen genähert hatte.
»Warst du hier, liebes Kind?«, sagte er, indem er sich vergeblich bemühte, heiter zu lächeln.
»Ja, mein guter Onkel, ich habe alles gehört.«
»Gut, liebe Kleine«, sagte der General mit Anstrengung, »doch ist jetzt nicht der Augenblick, gerührt zu sein. Ich muss auf deine Sicherheit bedacht sein. Komm mit mir, hier könnte dich eine indianische Kugel gar zu leicht treffen.«
Er nahm sie sanft bei der Hand und führte sie in ihr Zelt zurück.
Nachdem sie in dasselbe getreten waren, drückte er einen Kuss auf ihre Stirn, empfahl ihr an, nicht mehr auszugehen, und kehrte zu den Schanzen zurück, wo er mit der größten Aufmerksamkeit beobachtete, was in der Ebene vorging, während er im Kopf die Zeit überrechnete, welche seit dem Fortreiten des Doktors verflossen war, und sich wunderte, dass er noch nicht wieder da sei.
»Er wird unter die Indianer geraten sein«, sagte er, »wenn sie ihn nur nicht umgebracht haben.«
Der Captain Aguilar war ein tapferer Soldat. Während der unaufhörlichen Kriege in Mexiko aufgewachsen, wusste er den Mut mit Klugheit zu verbinden.
Als er sich in einiger Entfernung vom Lager befand, streckte er sich flach auf den Boden und kroch bis zu einem Felsenvorsprung, welcher vortrefflich gelegen war, um ihm als Versteck zu dienen.
Alles schien um ihn herum ruhig zu sein, und kein Zeichen ließ darauf schließen, dass sich der Feind näherte. Nachdem er das Terrain eine geraume Zeit rekognosziert hatte, schickte er sich in der Überzeugung, dass sich der General geirrt und dass keine Gefahr drohe, an, in das Lager zurückzukehren, als plötzlich zehn Schritte von ihm entfernt ein Asshata erschrocken aufsprang und mit gespitzten Ohren und zurückgeworfenem Kopf, mit unglaublicher Schnelligkeit und den Zeichen eines großen Schreckens davonrannte.
»Oho!«, murmelte der junge Mann, »ist wirklich etwas dort? Ich will doch sehen?«
Er verließ den Felsen, hinter welchem er sich versteckt gehalten hatte, und schritt vorsichtig einige Schritte weiter, um sich zu überzeugen, ob seine Befürchtung begründet sei.
Das Gras bewegte sich heftig, und zehn Männer richteten sich plötzlich rings um ihn auf, ehe er noch Zeit gefunden hatte, sich zur Wehr zu setzen oder das Versteck, das er unvorsichtigerweise verlassen hatte, wieder zu erreichen.
»Desto besser«, sagte er mit geringschätziger Kaltblütigkeit, »jetzt weiß ich, mit wem ich es zu tun habe.«
»Ergebt Euch!«, schrie ihm einer der Männer, die auf ihn eingedrungen waren, zu.
»Welcher Einfall!«, sagte er mit ironischem Lächeln, »Ihr seid verrückt, erst müsst Ihr mich schönstens umbringen, ehe Ihr mich haben könnt.«
»So wird man Euch töten, mein schönes Herrchen«, antwortete der, welcher zuerst gesprochen hatte.
»Darauf rechne ich auch«, sagte der Captain im spöttischen Ton, »ich werde mich verteidigen. Das wird Lärm machen, meine Freunde werden Euch hören. Euer Überfall wird misslingen und das ist es gerade, was ich will.«
Diese Worte wurden mit einer Ruhe gesprochen, welche die Piraten nachdenklich machte. Die Leute gehörten zu der Bande des Hauptmanns Waktehno. Er befand sich selbst unter ihnen.
»Ja«, antwortete der Anführer der Ränder hohnlachend, »Euer Einfall ist gut, aber man kann Euch auch umbringen, ohne Lärm zu machen, und dann ist auch Euer Plan vereitelt.«
»Bah! Wer weiß?«, sagte der junge Mann.
Ehe ihm die Piraten zuvorkommen konnten, sprang er mit einem großen Satz zurück, warf zwei Männer um und lief mit großer Eile in der Richtung des Lagers davon.
Als der erste Augenblick der Überraschung vorüber war, eilten die Räuber, ihn zu verfolgen.
Der Wettlauf dauerte von beiden Seiten ziemlich lange, ohne dass die Piraten dem Flüchtling bedeutend näher gekommen wären. Da sie, indem sie ihn verfolgten, immer darauf bedacht waren, von den mexikanischen Wachen nicht gesehen zu werden, sahen sie sich gezwungen, Umwege zu machen, welche notwendigerweise ihren Lauf aufhalten mussten.
Der Captain war den seinen auf Hörweite nahe gekommen, er warf einen Blick zurück. Die Räuber, welche den Halt, den er gemacht hatte, um Atem zu schöpfen, benutzt hatten, waren indessen bedeutend näher gekommen. Der junge Mann sah ein, dass, wenn er seine Flucht fortsetzte, er das Unglück, welches er verhüten wollte, herbeiführen würde.
Sein Entschluss war augenblicklich gefasst. Er beschloss zu sterben, doch wollte er wie ein Soldat sterben und im Fallen denen, für welche er sich aufopferte, nützlich sein.
Er lehnte sich gegen einen Baum, stellte seine Machete auf Armlänge neben sich, zog seine Pistolen aus dem Gürtel und rief, indem er sich nach seinen Feinden, welche nur noch dreißig Schritte von ihm entfernt waren, wandte, in der Absicht, die Aufmerksamkeit seiner Freunde zu erregen, mit überlauter Stimme: »Habt Acht! Habt Acht! Der Feind ist da.«
Dann schoss er seine Pistolen mit der größten Kaltblütigkeit wie bei einem Scheibenschießen ab. Er hatte vier Doppelpistolen und rief bei jedem fallenden Piraten wiederholt: »Habt Acht! Hier ist der Feind! Sie umringen uns, seht Euch vor! Seht Euch vor!«
Die Banditen, welche die hartnäckige Gegenwehr erbitterte, stürzten mit Wut über ihn her, wobei sie alle bisher beobachtete Vorsicht vergaßen.
Nun begann ein großartiges und fürchterliches Handgemenge eines einzigen Mannes gegen zwanzig oder dreißig, denn für jeden Piraten, der fiel, stellte sich ein anderer in die Reihen.
Der Kampf war entsetzlich.
Der junge Mann hatte sein Leben zum Opfer gebracht, doch wollte er es so teuer wie möglich verkaufen.
Wie wir schon gesagt haben, wiederholte er bei jedem Schuss, den er abfeuerte, bei jedem Hieb mit der Machete sein Warnungsgeschrei, welches die Mexikaner damit beantworteten, dass sie ihrerseits ein knatterndes Musketenfeuer auf die Piraten richteten, die sich ohne Rückhalt zeigten und den Mann, der ihnen den Weg mit einer unüberwindbaren Mauer seiner tapferen Brust versperrte, wütend verfolgten.
Endlich fiel der Captain auf ein Knie. Die Piraten stürzten sich bunt durcheinander auf ihn los und brachten sich gegenseitig in der blinden Wut, mit der sie ihn umzubringen trachteten, Wunden bei.
Ein solcher Kampf konnte unmöglich lange dauern.
Der Captain Aguilar fiel, doch kostete sein Fall zwölf Piraten, die er erlegte und die ihm ein blutiges Geleit gaben, das Leben.
»Hm!«, murmelte der Hauptmann Waktehno, ihn mit Bewunderung betrachtend, indem er das Blut, welches aus einer tiefen Wunde, die er selbst in die Brust erhalten hatte, floss, zu hemmen suchte.
»Welch ein hartnäckiger Bursche, wenn ihm die anderen alle gleichen, so werden wir nimmermehr mit ihnen fertig. Nun«, sagte er und wandte sich zu seinen Begleitern, die seine Befehle erwarteten. »Wir wollen uns nicht länger wie Tauben zusammenschießen lassen. Herbei zum Angriff! Bei Gott, zum Sturm!«
Die Piraten folgten ihm, ihre Waffen schwingend und fingen an, den Felsen zu erklettern, indem sie brüllten: »Zum Sturm! Zum Sturm!«
Die Mexikaner ihrerseits, die Zeugen von dem heldenmütigen Ende des Captains Aguilar gewesen waren, bereiteten sich vor, ihn zu rächen.
Ende des zweiten Bandes
Schreibe einen Kommentar