Aus dem Wigwam – Die Wahl eines Gottes
Karl Knortz
Aus dem Wigwam
Uralte und neue Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer
Otto Spamer Verlag. Leipzig. 1880
Noch vierzig Sagen
Mitgeteilt vom Navajohäuptling El Zol
Die Wahl eines Gottes
Erzählung eines Narragansett
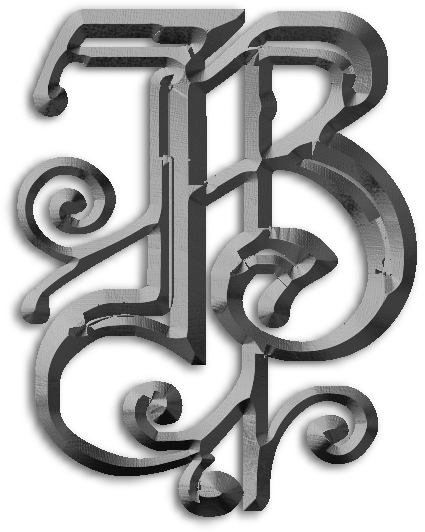 rüder! Ich bin ein Narragansett und mein Vater und meine Mutter waren es auch. Ihr werdet sagen, dieser Name ist uns unbekannt und dann fragen, welche Taten jene Indianer verrichtet haben. Sind sie kriegerisch? Können sie lange hungern, weit reisen und die Qualen des Marterpfahls ausstehen, ohne zu weinen und zu seufzen? Die Stämme des Nordens, des Südens und des Westens, des Großen Flusses, des Breiten Sees und des Rückgrats des Großen Geistes werden dies bezweifeln, denn sie kennen uns nicht. Unsere Jagdgründe liegen weit weg und unsere Kriegspfade gehen durch die entlegensten Wälder. Nur denjenigen, welche die Stürme des Großen Sees nie brausen hörten, und die nie den Fisch töteten, dessen Körper einem Berg gleicht, sind die Narragansett unbekannt. Unsere Nachbarn aber kennen uns sehr gut, denn sie haben uns gesehen und gefühlt. Wer friedfertig zu uns kommt, dem steht ein jeder Wigwam offen und wir werden die fettesten Tiere für ihn schießen und die schmackhaftesten Fische mit den glänzenden Schuppen fangen. Kommt aber jemand mit Kriegsfarben geschmückt und mit Keulen, Pfeil und Bogen, so zünden wir ebenfalls die Kriegspfeife an und lassen das Kriegsgeschrei ertönen, dass der Reiher aus Furcht sein Versteck aufsucht. Dann werden unsere Stimmen so laut erschallen wie das Rollen des Walfischsees im Heringsmonat.
rüder! Ich bin ein Narragansett und mein Vater und meine Mutter waren es auch. Ihr werdet sagen, dieser Name ist uns unbekannt und dann fragen, welche Taten jene Indianer verrichtet haben. Sind sie kriegerisch? Können sie lange hungern, weit reisen und die Qualen des Marterpfahls ausstehen, ohne zu weinen und zu seufzen? Die Stämme des Nordens, des Südens und des Westens, des Großen Flusses, des Breiten Sees und des Rückgrats des Großen Geistes werden dies bezweifeln, denn sie kennen uns nicht. Unsere Jagdgründe liegen weit weg und unsere Kriegspfade gehen durch die entlegensten Wälder. Nur denjenigen, welche die Stürme des Großen Sees nie brausen hörten, und die nie den Fisch töteten, dessen Körper einem Berg gleicht, sind die Narragansett unbekannt. Unsere Nachbarn aber kennen uns sehr gut, denn sie haben uns gesehen und gefühlt. Wer friedfertig zu uns kommt, dem steht ein jeder Wigwam offen und wir werden die fettesten Tiere für ihn schießen und die schmackhaftesten Fische mit den glänzenden Schuppen fangen. Kommt aber jemand mit Kriegsfarben geschmückt und mit Keulen, Pfeil und Bogen, so zünden wir ebenfalls die Kriegspfeife an und lassen das Kriegsgeschrei ertönen, dass der Reiher aus Furcht sein Versteck aufsucht. Dann werden unsere Stimmen so laut erschallen wie das Rollen des Walfischsees im Heringsmonat.
Es ist ein Häuptling unter uns, dessen Gesicht die Farbe einer gerupften Taube hat. Er kommt — wenn er nicht lügt — aus einem sehr schönen Land, dessen Bewohner aber nicht so klug und kriegerisch, wie wir sind. Er hat Vater und Mutter, Frau und Kinder verlassen, um Weisheit von uns zu hören. Sollen wir ihn belehren?
Brüder! Die Narragansett haben eine alte Sage, die wir alle glauben, denn sie ist uns von unseren Vätern erzählt worden, und diese waren Männer der Wahrheit. Ich will sie euch mitteilen; merkt also auf.
Die Narragansett sind die ältesten Menschen der Welt; sie sind älter als die Pequod und die Irokesen. Wann sie geschaffen wurden, weiß niemand außer dem Großen Geist. Wir lebten, als wir herausfanden, dass wir Atem hatten, mehr weiß ich nicht über unsere älteste Geschichte. Wie kann ein Mann, der in tiefem Schlaf nach einem ihm gänzlich unbekannten Land gebracht wird, sagen, wo er sich befindet und wie er dorthin gekommen ist? Aber wir wissen, dass wir, wenn wir geboren werden, hilflose Kinder sind. Dies waren auch einst die Narragansett, und als sie die gewöhnliche Mannsgestalt erlangt hatten, waren ihre Krieger doch nicht mächtiger als große Buben und ihre Häuptlinge nicht weiser als alte Weiber. Sie hatten weder Pfeil noch Bogen, weder Wigwam noch Kanu und waren so unwissend und närrisch wie die Bleichgesichter. Die Spur des Elentieres sahen sie für die einer wilden Katze an und eine Eule betrachteten sie als den größten Leckerbissen. Sie hatten nichts als Füße zum Gehen, Hände zum Fischfangen und Zungen, um Lügen und Dummheiten zu reden. Sie dienten nur den bösen Geistern, deren Häuptling sie Hobbamock nannten. Trotzdem sie dieselben Tag und Nacht verehrten, so erhielten sie doch gar wenig für ihren Dienst. Wenn sie einen Hirsch fingen, so war es sicherlich ein kranker, der kein bisschen Fett im Leibe hatte, und wenn sie einen Fisch speerten, so bestand derselbe größtenteils nur aus einem Rückgrat.
Da kam einst ein sehr weiser Medizinmann unter sie, dessen Name Sasaquit war. Er diente dem Guten Geist und sagte zu den Narragansett: »Wenn ihr bessere Männer wäret und meinem Meister, dem Herrn des Lebens, dientet, so würde er euch alles, was ihr braucht, in reichlichstem Maße geben. Dann würdet ihr nicht Fische fangen, deren Kopf so dick wie der meine ist und die sonst kaum die Dicke eines Armes haben; ihr könntet alsdann die fettesten Fische mit der größten Bequemlichkeit fangen. Auch würde euch der Gute Geist noch andere Dinge zeigen, an die ihr bisher noch gar nicht gedacht habt.«
»Sasaquit spricht gut«, sagte der Häuptling, »aber das gehört zum Geschäft eines Medizinmannes. Lasst uns ihm sagen, dass wir den als unseren Gott anerkennen, der uns am besten behandelt.«
Diese Antwort gefiel den Narragansett und sie boten dem Gott Sasaquits ihre Dienste an, wenn er sie besser als Hobbamock bezahle. »Es ist nicht eurer Verehrung wegen«, erwiderte Sasaquit, »dass der Große Geist eurem Wunsch entsprechen wird, sondern nur, weil er den Teufel gern ärgert. Kommt morgen früh, wenn die Sonne aus dem Meer taucht, auf den Großen Berg und ihr sollt sehen, wessen Gott der freigebigste ist, der meine oder der eure.«
Am folgenden Tag versammelte sich der ganze Stamm an dem angegebenen Ort. Auch Pokasset, der Priester des Teufels, kam und hatte sich eine mit allerlei magischen Figuren bemalte Bärenhaut umgehängt und das Fell eines Hundekopfes als Mütze aufgesetzt. Auf den Wunsch Sasaquits musste der Häuptling das Versprechen, dem Gott dienen zu wollen, der ihnen das meiste und beste böte, wiederholen, und alle Indianer erklärten sich damit vollkommen einverstanden. Darauf hielt Pokasset eine lange Rede, von der ich jedoch nur weiß, dass er darin behauptete, sein Meister trüge zuletzt doch den Sieg davon.
Sasaquit war während dieser Zeit auf einen hohen Baum geklettert, hatte seine heiligen Lieder gesungen und sich mit dem Großen Geist unterhalten. Als er damit fertig war, sahen die Narragansett aus dem fernen Norden einen riesigen Mann kommen, der größer und dicker als der Nachmittagsschatten eines belaubten Baumes war. Trotzdem bewegte er sich zehnmal so schnell durch die Luft als der geschwindeste Adler; seine Beine und Arme gebrauchte er dabei als Flügel. In einem Augenblick stand er bei dem Baum und legte ein schönes Schiffchen, das aus einem durch Feuer ausgehöhlten Baumstamm bestand, zu den Füßen Sasaquits.
»Was ist das? Was ist das?«, fragten sie alle, denn keiner von ihnen hatte die entfernteste Idee von seinem Nutzen. Der große Mann erklärte ihnen darauf den Gebrauch desselben und setzte es auf das Wasser, wonach er Sasaquit ein Ruder gab und ihm zeigte, wie man es lenken müsse. Das Schiffchen gefiel allen Anwesenden über die Maßen und jeder versuchte, ob er auch darin fahren könne.
»Der Große Geist ist sehr gut«, meinten sie, »denn er zeigt sich gleich von vornherein liebevoller gegen uns, als Hobbamock jemals getan hat. Für all unsere Opfer und unsere Verehrung hat er uns nur mit Lügen und leeren Versprechungen belohnt.«
Am nächsten Tag versammelten sich die Narragansett wieder an demselben Platz und warteten auf das, was ihnen der Teufel schicken würde. Pokasset hatte bereits sein Gebet verrichtet, aber kein Zeichen wurde sichtbar, noch war irgendwo ein Laut zu hören. Die Leute wurden allmählich ungeduldig und machten den Vorschlag, den Großen Geist von nun an als ihren Gott anzuerkennen und als erstes Opfer Pokasset bei lebendigem Leibe zu braten.
»Der Priester des Teufels«, sagten sie, »taugt nichts. Als Sasaquit seinen Meister anrief, schickte er ihm gleich ein Geschenk für uns. Pokassets Meister aber scheint taub zu sein, obwohl er ihm ein Lied so laut vorgesungen hat, dass es uns allen noch in den Ohren gellt.« Darauf ergriffen sie ihn; doch als sie ihn in Stücke zerreißen wollten, fing es plötzlich an zu donnern und ein merkwürdig aussehendes Geschöpf kam aus dem Boden hervor. Es war nicht größer als ein Kind, dass die Blumen zweimal blühen sah, aber an Hässlichkeit hatte es nicht seinesgleichen. Es schien sehr alt zu sein; sein Gesicht sah aus wie das Moos an der Sonnenseite einer Eiche und seine Zähne waren beinahe ganz verfault. Seine Knie waren gebogen; sein Gesicht war mit grauem Haar bedeckt und die Haut seines übrigen Körpers war schwärzer als der schwärzeste Rabe.
Die Narragansett fürchteten sich so sehr, dass sie weglaufen wollten. »Kennt ihr denn euren Meister nicht?«, fragte Pokasset. »Er wird euch nichts zu Leide tun.«
»Der kleine Mann liebt euch und hat euch etwas mitgebracht«, sagte der hässliche und zeigte ihnen Pfeil und Bogen. Da aber die Narragansett nicht wussten, was sie damit machen sollten, so baten sie ihn, ihnen den Gebrauch dieser Instrumente zu erklären.
»Recht gern«, erwiderte er, »sagt mir doch, was das für ein Vogel ist, der dort auf dem dürren Ast der alten Tanne an dem kleinen Fluss sitzt?«
Einer antwortete, dass es der Vogel sei, der morgens die Langschläfer wecke und dem Verliebten, der nachts um den Wigwam seines Schatzes schleicht, anzeige, dass ihn die Sonne bald verraten werde.«
»Der Vogel, der am Morgen sang, wird am Abend stumm sein«, sagte jener darauf lächelnd, nahm den Bogen zur Hand and legte einen Pfeil darauf. Dann zielte er und schoss, und der Vogel lag tot auf der Erde. Da jauchzten und schrien die Indianer so laut, dass sie das Toben des Meeres übertönten, und baten Hobbamock, noch einen Vogel zu schießen. Dieser tat es denn auch und fragte sie, welche Gabe ihnen am besten gefiele, die seine oder die des Großen Geistes.
»Die deine!«, antworteten alle wie aus einem Munde, »denn sie gibt uns die Macht, unsere Feinde, die Mohegan, leicht töten zu können.«
»Wollt ihr auch fortfahren, mir zu dienen?«, fragte er darauf.
Doch als sie eben mit »Ja« antworten wollten, sprach Sasaquit: »Morgen werde ich dem Großen Geist ein Dankopfer bringen und dann erfahren, ob er dem Teufel die Herrschaft über die Narragansett lassen wird oder nicht!«
Als sie dies hörten, beschlossen sie, mit ihrer Entscheidung bis zum nächsten Tag zu warten, worauf Hobbamock flammensprühend in den Boden sank.
Am nächsten Morgen stand Sasaquit in aller Frühe auf, trug einen großen Haufen dürren Holzes zusammen und legte das edelste Opfer, einen fetten Fisch aus dem benachbarten Fluss, darauf. Dann fing er zu singen an und schilderte die mannigfachen Bedürfnisse der Indianer, und welche Mühe sich der Teufel gebe, sie für immer in seine Gewalt zu bekommen. Die Narragansett kamen nach und nach alle herbei und warteten auf ein wertvolles Geschenk. Es dauerte auch nicht lange, als sie einen großen, schwarzen Adler auffliegen sahen. Auf seinem Rücken trug er einen Mann, den er in ihrer Nähe niedersetzte.
»O«, sagte derselbe, »hätte ich nur meinen Büffelmantel mitgenommen! Auf der Rückreise wird es mich noch mehr frieren!«
»Was hast du uns mitgebracht?«, fragten die Indianer und drängten sich neugierig an ihn heran.
»Ein oder zwei Dinge«, antwortete er und zog einen mit stark riechenden Blättern gefüllten Beutel und ein ausgehöhltes steinernes Instrument mit einem langen Stiel aus der Tasche und verlangte etwas Feuer. Dasselbe wurde ihm augenblicklich gebracht, und er füllte sein steinernes Instrument mit dem Kraut, legte das Feuer darauf und ließ dann den Rauch durch Mund und Nase ziehen.
»Wie nennt man die schwarzen Blätter?«
»Tabak!«
»Wozu ist er gut?«
»Er ist gut für – für – allerlei. Er kuriert Zahnschmerzen und verscheucht die blauen Teufel.«
Obwohl die Narragansett viel Umgang mit Teufeln gehabt hatten, so wussten sie doch nicht, was blaue Teufel feien, und sie wissen es bis auf den heutigen Tag noch nicht.
Darauf rauchte einer nach dem anderen, und sie fanden großen Gefallen daran; aber sie glaubten, dies Geschenk sei doch nicht so viel wert wie das des Teufels.
»O, ich habe noch etwas anderes«, sagte der Fremde und ließ sich einen Stock bringen, mit welchem er den Adler jämmerlich schlug. Er schrie schrecklich und öffnete den Schnabel, als ob er seinen Quäler beißen wollte; aber dieser schlug ihn so lange, bis er tat, was er haben wollte — nämlich, dass er einige Samenkörner von der Größe des Nagels am kleinen Finger fallen ließ. Darauf streichelte er ihn freundlich und bat ihn wegen seiner grausamen Behandlung um Verzeihung.
»Jetzt«, sagte er zu den Indianern, »tragt das Korn an den Fluss, wascht es rein und macht dann ein neues Feuer an.«
Sie folgten und er legte das Korn ins Feuer, röstete es und gab dann allen davon zu kosten. Es schmeckte ihnen so gut, dass sie baten, er solle den Adler noch einmal schlagen; aber das wollte er nicht. Er sagte ihnen, dass man diese Frucht Mais nenne, und zeigte ihnen, wie man es mit zwei Steinen male und dann ein köstliches Brot daraus backe. Dies gefiel ihnen sehr gut; doch als sie sich zu Gunsten des guten Geistes erklären wollten, trat ein altes hässliches Weib unter sie und sagte, sie sollten dem Teufel auch noch eine Gelegenheit geben, sich auszuzeichnen; denn je länger der Kampf zwischen den beiden Geistern währe, desto besser sei es für sie.
Dies leuchtete den Indianern ein, und der Fremde setzte sich auf sein Flügelross und verließ sie. Den Samen, den er ihnen geschenkt hatte, sollten sie im Frühjahr in die Erde stecken, waren seine letzten Worte.
Am nächsten Morgen sahen die Narragansett den Teufel auf einem Baum in ihrer Nähe sitzen. Sie fragten ihn, was er ihnen gebracht habe, aber er gab keine Antwort und sah beständig auf das große Meer. Dessen wurden sie endlich müde, und einige machten den Vorschlag, ihn mit Steinen herunterzuwerfen.
»Seht dort!«. rief er plötzlich. In der angedeuteten Richtung erschien etwas Weißes, das sich schnell dem Ufer näherte. Einige hielten es für eine Ente, andere für eine Wolke und noch andere glaubten, es sei der Große Geist, der die Narragansett besuchen wolle. Sie fragten den Teufel, was es sei; aber er zeigte als Antwort grinsend die Zähne.
Es sah aus wie ein Kanu, aber es war fast so groß wie ein Landsee und hatte Flügel so weiß wie die der Seemöwen. Als es am Ufer war, faltete es die Flügel zusammen und man sah an ihrer Stelle nur noch drei dicke Stangen, auf deren eine der Teufel von seinem Baum hüpfte.
Die Indianer waren beinahe außer sich vor Verwunderung. Es schien kein Leben zu haben; aber wie war es so allein hierhergekommen? Zuletzt fürchteten sie sich davor und liefen ins Gebüsch, um sich zu beraten, was hier zu tun sei. Da ihnen nichts, was aus der Ferne zu ihnen gekommen war, Schaden zugefügt hatte, so fassten sie allmählich wieder Mut und gingen zurück.
Einige Männer mit weißer Gesichtsfarbe standen am Ufer und redeten in einer Sprache, von welcher die Indianer kein Wort verstanden. Einer davon hielt beständig ein merkwürdiges, dem Hals eines großen Vogels ähnliches Ding am Mund und schien zu trinken. Endlich stet er nieder und fing zu singen an und gebärdete sich dabei so närrisch, dass ihm der Teufel das Gefäß mit dem geheimnisvollen Trank wegnahm. Die Indianer fragten ihn, was es sei.
»Eine Flasche«, erwiderte der Teufel.
»Was ist darin?«
»Rum! Sehr guter Rum! Kostet einmal davon!«
Die Narragansett tranken die ganze Flasche aus und fragten ihn, ob er noch mehr habe.
»Gewiss!«, antwortete er, »die Bleichgesichter verkaufen es mir spottbillig, die meisten meiner Verehrer verdanke ich diesem Getränke — ich will es euch ganz umsonst liefern.«
»Wenn du das tust, so sollst du unser Herr sein!«, riefen freudig die Indianer. »Es ist viel besser als das Korn des Großen Geistes.«
Also schlossen der Teufel und die Narragansett ein Bündnis ab. Die Bleichgesichter brachten ihnen große Fässer voll Rum, der sie zu Hunden, Bären und wilden Katzen machte.
Aber weder der gute noch der böse Geist hat sein Versprechen getreu gehalten. Der Große Geist verdirbt manchmal das Korn dadurch, dass er entweder zu viel oder gar keinen Regen schickt, und der Teufel lässt häufig die Bleichgesichter allen Rum austrinken, ehe sie ans Ufer kommen.
Schreibe einen Kommentar
Schreibe einen Kommentar