Der Spion Band 1 – Die Schlacht bei Jena – Einleitung
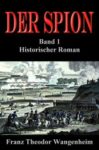 Franz Theodor Wangenheim
Franz Theodor Wangenheim
Der Spion
Band 1 – Die Schlacht bei Jena
Historischer Roman
Verlag von C. P. Melzer, Leipzig 1840
Es wäre ebenso leicht als verzeihlich, wenn ich im Voraus den Leser um Nachsicht bäte. Sogar vorteilhaft würde es für meinen Herrn Verleger sein, indem Der Spion selbst in denjenigen Ständen gar viele Leser fände, welche es sich zur Ehre anrechneten, dass man sie irgendwann einmal um Nachsicht gebeten hat; etwa wie die Paradiesbewohner im Theater, deren donnernder Applaus den hervorgerufenen Akteur alsbald nach den Worten »um gütige Nachsicht« zu betäuben droht. Doch ich will das Publikum, dem ich hiermit meinen Spion zu übergeben die Ehre habe, nicht mit glatten Worten bestechen und getrost erwarten, ob dasselbe an diesem historischen Roman Behagen finde oder über den Autor den Stab breche. Nur an den berufenen und sachkundigen Rezensenten wende ich einige Worte, um ihn zu der dankbarsten Neubeurteilung zu vermögen, nämlich das Gute in meinem Werk aufzusuchen. Doch an die Taglöhner der Literatur, an die Rezensentler, welche die ihnen zur Beurteilung anvertrauten Bücher nicht lesen, weil sie dieselben sofort nach dem Empfang zu einem Leihbibliothekar tragen müssen, sie um ein Spottgeld verkaufen, um ein Mittagsbrot zu bezahlen, an diese unwürdigen, unberufenen und unkundigen Handhaber des Gänsekiels wende ich meine Worte nicht. Zwar sagt mir ein aufrichtiger Freund, man müsse auch gegen diese Art von Literaten tolerant sein, es mindestens scheinen, doch ich mag von solcher Toleranz, welche mit jedem Tag die Verunglimpfung der Literatur sanktioniert, nichts hören und mit allen Waffen, mit aller Kraft, gegen diese Eindringlinge ankämpfen, damit sie endlich selbst die Verachtung erkennen, der sie schon so lange anheimgegeben sind.
Also mit unbedingtem Vertrauen wende ich mich an Sie, meine Herren, denen die Interessen der deutschen Literatur am Herzen liegen, an diejenigen Männer wende ich mich, welche in würdevoller Ruhe prüfen, was ein Deutscher geschaffen hat, und dann ein Unheil gründlich abgeben. Ich gestehe hiermit offen und frei, dass ich Ihnen und Ihren Zurechtweisungen die Stellung verdanke, welche meine Werke in der Romanliteratur unseres deutschen Vaterlandes nicht allein, sondern auch in den Übersetzungsfabriken des Auslandes einnehmen. Ich erkenne recht gut, dass mein Spion, da er sich in einer so gehaltreichen Zeit, in den Jahren von 1806 bis 1815 bewegt, schon durch die in ihm enthaltene Nomenklatur das Interesse des Lesers auf sich lenken, ja fesseln wird. Aber vor Ihren Augen möchte ich nicht so erscheinen, als hätte ich mit Knalleffekten das Publikum überraschen wollen; noch mehr, ich gestehe Ihnen, dass all die berühmten Männer und Frauen, welche sich in meinem Spion bewegen werden, stets nur den Hintergrund in dem Bild ausmachen dürfen, damit der Held der Geschichte in seinen kleinsten Nuancen markiert genug hervortrete, um ihn als Hauptfigur zu erkennen. Sie werden mich verstehen, doch mancher andere wird mir den Vorwurf machen, als habe ich auf den Kaiser Napoleon zu wenig Fleiß verwendet, auf den Fürsten Blücher, auf die Beschreibung der Brücke von Arcole oder wohl gar auf die Pantoffeln, welche Bonaparte auf St. Helena getragen hatte.
Meine Herren, ich verspreche mir von Ihnen, dass Sie mich gegen diese Vorwürfe in Schutz nehmen und den Leuten sagen, ich hätte einen historischen Roman, Der Spion, aus den Kriegszeiten von 1806 bis 1815 schreiben wollen; nicht aber den Krieg selbst. Sie werden den Leuten sagen, das Heil der deutschen Literatur hänge nicht eben von der Beschreibung der Pantoffeln ab, welche der Kaiser im Exil getragen hat, aber Sie werden die Leute auch überzeugen, wie undankbare Mühe es wäre, eine Geschichte zu erzählen, welche jedermann genau kennt, zum hundertsten Mal etwas zu sagen, was neunundneunzig Mal gesagt worden ist.
Der Spion – auch dieses werden Sie den Leuten sagen – wird dem Preußen zeigen, wie sein König im Unglück ein Mann geblieben und das Missgeschick ihn zu der Größe vorbereiten musste, in welcher er nun vor der Mitwelt prangt, welche der Nachwelt Bewunderung abdringen wird. Der Spion wird dem Österreicher dartun, dass er in dem verewigten Kaiser Franz den treuesten und sorglichsten Vater hatte, und, obwohl die Verehrung für den Dahingeschiedenen an das Romanhafte grenzte, den Manen des Kaisers nicht genug Altäre stammen. Der Spion wird allen Deutschen Zungen lehren, dass es keine Politik gebe, welche sie anders als im treuen Festhalten an Deutschland beglücke. Aus diesem Grund lege ich mein Werk auf dem Altar meines deutschen Vaterlandes nieder! Ich bin kein Bonapartist, will als solcher nicht erscheinen, wenngleich ich dem großen Mann meine Bewunderung zolle. Ich bin frei geblieben von der Manie, welche den Deutschen zum Vaterlandsverräter macht. Aber muss man denn just ein Altgrieche sein, um einen Achilles zu bewundern? Wer sind denn auch diejenigen, welche den großen Korsen noch immer zum Halbgott machen möchten? Grünohrige Buben zumal, die nur froh sind, wenn sie ihre Namen gedruckt lesen, und, ohne es selbst zu wissen, Herostraten werden. Sie haben kein Gefühl für den Schmerz eines guten Monarchen, der sein Land, sein Volk unter dem Druck der Geißel fremder Tyrannen bluten sieht, kein Gefühl für den Schmerz des Gatten, des Vaters, der kaum seine Lieben dem Verderben entreißen konnte. Aber sie empfinden auch die Wollust nicht, wenn nach langer, harter Prüfung die Stunde des Wiedersehens schlägt, wenn nach langer Knechtschaft die Freiheit leuchtend emporsteigt und ein Jubel alle Herzen durchwirbelt: »Wir sind frei!«
O, meine Herren, erzählen Sie doch jenen Kanonisierungslustigen eine Szene aus meinen Knabenjahren!
Mein Vater wurde bezichtigt, mit England in Korrespondenz zu stehen. General Bongarce holte ihn nach Kassel. Von Haus und Hof gerissen, von seiner Frau, seinen Kindern – ich, der Älteste war kaum acht Jahr alt – sperrte man ihn in das berüchtigte Kastell. Mit Schwefelholz und Schuhwichse schrieb er einen Zettel an meine Mutter, den ein deutscher Restaurateur mit Lebensgefahr besorgte. Meine Mutter nahm mich mit nach Kassel. Tränen und Geld verschafften ihm Zutritt bei Jerome. Sie warf sich ihm zu Füßen, zupfte mich am Röckchen, dass ich niederknien sollte, doch der komödiantenhaft geputzte Herr fesselte meinen Knabensinn: Ich kniete nicht.
Auf meiner Mutter Flehen, dass ihr der König den unschuldigen Mann frei gäbe, versetzte Jerome: »Madame, vous êtes tres brave, mais votre mari, i lest un coquin; il faut le pendre.«1
War das königlich und edel? Diese Worte habe ich nie vergessen können. Freilich trafen sie nur eine Familie, aber kann Braunschweig vergessen, dass sein Herzog, der edle, kühne Welfe, auf einem Strohbündel, auf dem Wall vor seiner Residenz liegen musste? Kann Hamburg die Wunden vergessen, welche seinem Wohlstand geschlagen wurden und die kaum nach zwei décennies2 verharschten? Kann Preußen die Tränen vergessen, welche seiner geliebten Herrscherfamilie das Geleit gaben und kann ihm ein Gott jemals den Verlust einer so guten Königin ersetzen, die den Todeskeim in so furchtbarem Zeitendrang in sich aufnahm? Kann der Österreicher …? Nun, der beleidigte Vater, dem man die edle Tochter abgetrotzt hat, er schläft dem Tag der Vergeltung entgegen und der habsburgische Graf hat ihm ein freundliches »Willkommen!« zu gerufen haben. Aber wer zählt die blutigen Opfer für Deutschlands Freiheit? Und welches Geschlecht wird sagen können: »Mein Lorbeer, meine Palme, sie leuchten herrlich und keine Totenblume mahnt mich an schmerzlichen Verlust!«
Drum hinweg mit Euch, in denen deutsches Blut geschändet wird! Bringt Eurem Götzen fortan nur Opfer und saugt Euch fest und immer fester an das Verbrechen des Vaterlandsverrats! Aber dir Deutschland, übergebe ich dieses Buch. Du wirst es verstehen, denn du hast geduldet, geseufzt, aber du hast auch mit altgewohnter Kraft an dem Joch gerüttelt, es zerbrochen und stehst wieder frei, ein deutsches Volk!
Hamburg im Mai 1839.
F. Th. Wangenheim.
Schreibe einen Kommentar