Addy der Rifleman – Der Held vom Mohawk
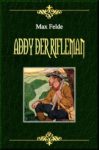 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Der Held vom Mohawk
Es war wenige Tage nach dem blutigen Gefechte bei Oriskany, als vor einem umfangreichen Farmhaus in Little Falls, das damals nur aus wenigen nebeneinander liegenden Gebäuden bestand, mehrere Männer um einen runden Tisch in eifrigem Gespräch beim Becher saßen.
Das Wohngebäude der Farm, hinter dem sich noch eine Anzahl Kornschober und ein umfangreicher Scheibenstand mit Kugelfang erhoben, war zwar nur einstöckig und nur aus schwerem Balkenwerk erbaut, trug aber trotzdem den Stempel traulicher Wohnlichkeit, die durch die etwas kriegerisch aussehende Palisadenumzäunung allerdings einigermaßen beeinträchtigt wurde.
Über dem Hauseingang prangte weithin sichtbar ein weiß überstrichenes, viereckiges Holzschild, auf dem in großen schwarzen Buchstaben die Worte Gasthaus zur fröhlich’ Pfalz aufgemalt standen.
Eine junge hübsche Maid mit lustigen Blauaugen und hängenden Blondzöpfen, des Wirts Töchterlein, trippelte unter den Gästen umher. Sie hatte soeben frischen Stoff gebracht.
Die Männer nickten dem Mädchen freundlich zu, erhoben die zinnernen Becher und ließen sie zum Umtrunk kräftig zusammenklingen.
»Ja, es war eine haarige Geschichte da oben bei Oriskany«, rief ein stämmiger Mann, mit dem Arm in der Schlinge, seiner Umgebung zu, als er den Becher wieder klirrend auf den Tisch gesetzt hatte. »Wahrlich, ich hätte es zu Beginn des Kampfes, als die roten Teufel immer wieder wie aus der Erde wuchsen und wie die wilden Bestien auf uns losfuhren, nie geglaubt, dass wir das Gesindel noch in die Pfanne hauen würden.«
»Ihr habt recht«, bestätigte ein anderer, der den Kopf mit einem blutbefleckten Linnen umwunden trug. »Zumal ganz zu Anfang, in der Schlucht, hat es windig genug ausgesehen. Wo man nur hinsah, überall blitzten die Beile der Rothäute in der Luft und – heillos! Kein Mann von uns wusste, woran wir eigentlich waren. Ein Glück, dass Addy zur rechten Zeit dazwischenfuhr und uns zur Besinnung brachte.«
»Ein prächtiger Mensch, dieser Adam Hartmann« (Addy, englische Verniedlichung, Kosename für Adam)«, erwiderte ein weißhaariger, zitteriger Alter, der natürlich zu Hause geblieben war, aber nun die Schilderungen der Bauern, die das Gefecht mitgemacht hatten, mit dem größten Interesse verfolgte. »Man möchte fast glauben, dass er mit dem Leibhaftigen im Bunde steht und unverletzbar ist. Überall, wenn es gilt, sieht man ihn voran. Aber weder Pulver und Blei noch die Schneide eines Messers können ihm etwas anhaben.«
»Und wie er das machte, wie er mit dem Beil, das er einem baumlangen Huronen abgenommen hatte, immer in das dichteste Gewühl fuhr, das muss man gesehen haben«, betonte der vorige Sprecher. »Und nichts als Umsicht ist es, sage ich. Sein scharfes Auge macht es, seine Geschmeidigkeit, seine Kraft und Gewandtheit.«
»Natürlich ist es das«, bestätigte der Alte. »Ihr werdet doch nicht glauben, dass ich noch in meinen alten Tagen dem Aberglauben zugeschworen habe? Doch sagt«, fügte er hinzu und rieb sich mit dem Daumen an der Stirn, »wie lange mag es her sein, dass der Adam jetzt im Tal ist?«
»Im nächsten Frühjahr wird gerade das fünfte Jahr um sein, rechne ich.«
»Das dürfte stimmen – stimmt«, bestätigten mehrere der Männer.
»Und wer er eigentlich ist und was er für ein Handwerk getrieben hat, ehe er als junger Bursche von drüben herüber kam übers große Wasser, das hat man noch immer nicht erfahren?,« fragte wieder der Alte.
»Dös kunnt’ i enk woll sag’n«, hub Franzl, der Grünrock an, als alle anderen Männer schwiegen.
»Na dann los! Kennt Ihr seine Geburtsstätte?«
»Er is aus der Nähe des Rheins her. wenn ich recht weiß, aus Edenkob’n.«
»Und wisst Ihr, was er für ein Handwerk getrieben hat?«
»So viel i erfahr’n hab’, hat er dort die Rotgerberei derlernt.«
Dröhnendes Lachen der ganzen Tafelrunde.
»Woll, woll – wahr is!«, versicherte Franzl.
»Der Adam ein Rotgerber?«, schrien mehrere der Bauern und sahen Franzl in einer Weise an, als seien sie der Meinung, er hätte einen schlechten Witz zu machen sich erlaubt.
Doch der blieb ernst. »G’wiss is«, versicherte er. »Der Addy hat mir’s bei’n Jag’n doch selber vazählt!«
»Nun dann ist es kein Wunder«, riefen lachend mehrere der Männer, »dass er den Roten das Fell so gründlich zu gerben versteht!«
»Und«, fragte der Alte wieder, indem er sich mit seinen schwieligen, zitternden Fingern eine Lachträne aus den Augen wischte, »wisst Ihr auch zu sagen, warum ihm sein Handwerk nicht gefallen, warum er es nicht drüben zünftig weiter getrieben hat?«
»Dös kann i enk aa sag’n«, versetzte Franzl, indem er das Mundstück seiner Tabakspfeife von dem einen Mundwinkel in den anderen schob. »Der Adam hätt’ die Rotgerberei so leicht nit aufgeb’n, denn er hat damit a schön’s Stückl Geld verdient. Oba er hat daneb’n no’ a andere Passion trieb’n. Eines schönen Tags is ihm nemli das Malör passiert, dass er just da ‘n Hirsch zur Streck’n bringt, wo’s agrad verbot’n war.«
»Aha«, riefen die Männer und nickten verständnisinnig mit den Köpfen.
»Der Hirsch«, berichtete Franzl weiter, »hat ihn sakrisch g’freut. Drauf oba is der Förster daherkumm’n und dös hat a damisch schieche G’schicht geb’n.«
»Der Förster hatte ihn abgefasst und er hätte ins Loch spazieren müssen?«
»Natürli’«, bestätigte Franzl, »und weil dem Adam der grüne Wald und der freie Himmel drüber besser g’fall’n hat als das finstre Löchl, hat er sich bedacht, ob’s nit g’scheiter wär, sich beizeit’n nach einer Gegend z’mach’n, wo’s aa ka’ schlechte Jagd, oba no’ ka’ Verbot net gibt.«
»Da hat ihm also der Jäger von jung auf im Leibe gesteckt«, bemerkte lächelnd ein großer Schnauzbart.
»Hab mir’s doch gleich gedacht«, meinte der Alte, »dass so etwas dahinter steckt, weil er von der Landwirtschaft absolut nichts wissen will. Doch sei dem wie es sei, wir wollen alle froh sein, dass wir nächst unserem Herckheimer einen solchen Mann im Tal haben. Ich kann nur jedem raten, den Addy nach besten Kräften warm zu halten. Aber ihr alle, ihr Mannen, ihr habt euch da oben bei Oriskany wahrlich mannhaft gehalten. Gott vergelt es euch, euren Kindern und Kindeskindern! Wenn der Rote wieder hereingekommen wäre ins Tal, böse würde es ausschauen um das, was wir mit unserer Hände Arbeit der Erde abgerungen haben. Also Achtung vor so wackeren Männern, die uns mit Leib und Blut vor dem Schlimmsten bewahrt haben. Hellauf müsste jetzt dem ganzen Mohawk entlang der Jubel klingen, wenn, ja wenn«, fügte der alte Mann stockend und mit unsicher gewordener Stimme hinzu, »der Sieg nicht gar so teuer erkauft wäre. Ihr wisst es, Mannen, kaum eine Farm wird sein, in der man nicht um einen Toten oder Verwundeten trauert. Wer weiß«, seufzte er und eine Träne rollte über seine gefurchte, runzelige Wange, »ob mein Tochtermann, der Rudolf, mit dem Leben davonkommt.«
»Wer wird denn glei’ flennen, Gerlachbauer«, ließ Franzl gutmütig-derb sich vernehmen. »Es wird si’ scho’ wieda mach’n. Der Rudl is g’sund und kräfti’ – wart’s etliche Woch’n und er is wieda völli’ munta.«
»Will’s Gott«, sprach der Alte, sah eine Weile sinnend in den zum Trunk erhobenen Becher und fragte dann: »Und wie geht es heute dem Herckheimer? Ihr, Franzl, Ihr müsst es ja wissen.«
»Guat geht’s«, antwortete dieser und drückte mit dem Daumen in seiner Pfeife die Asche nieder, »guat! Sein größter Schmerz is, dass der Addy bald wiedakehrt.«
»Er brennt wie wir alle darauf, zu wissen, was zuletzt oben bei Stanwix noch vorgegangen ist?«
»Versteht sich! Und mi’ wird’s mei Lebtag net weni’ reu’n«, knurrte Franzl, »dass i net dabei war.«
»Stand Euch ja frei – konnte sich doch jeder melden!«
»Hat sich was!«, entgegnete Franzl, schob den Hut von einem aufs andere Ohr und begegnete dem Sprecher mit Blicken des Unwillens. »Der Addy wollt’ partout, dass ich dem Herckheimer nit von der Seit’n geh’.«
»Na ja, das war wohl auch nötig.«
»Natürlich. Addy wollte einen verlässlichen Mann an der Seite des Verwundeten wissen, der ihn in dem allgemeinen Trubel sicher und gut nach Hause brachte – doch, sehe ich recht, ihr Männer«, unterbrach sich jäh der Redner, »sieht man nicht dort oben einen ganzen Haufen Mannsleute aus dem Wald hervorkommen?«
Wie elektrisiert sprangen die Männer von den Plätzen und richteten ihre Blicke talauf.
In der Tat kamen auf einem schmalen Waldweg wohl ein halbes Hundert Männer daher gewandert, die, als sie sich bemerkt sahen, mit lauten Jubelrufen ihre Büchsen über den Köpfen schwangen.
»Guat is gang’n«, jauchzte Franzl und stieß einen Juchzer aus, so hoch und heftig, dass sich seine Stimme überschlug. »Schad’ nix«, beschied er sich und lief, von der Mehrzahl der Farmer gefolgt, den Männern entgegen.
An ihrer Spitze marschierte Addy, der Jäger, und an einer Seite hielt sich, leichtfüßig und stumm einherschreitend, der Flinke Biber.
»Sieg – Sieg auf allen Linien!«, schrie schon von Weitem Addy den Herantrabenden jubelnd entgegen, die diese Nachricht mit erneuten, jauchzenden Freudenrufen beantworteten.
Man begrüßte und schüttelte sich gegenseitig die Hände, dann ging es an ein stürmisches Fragen.
Die Angekommenen aber waren, das sah man ihnen an, von Strapazen hart mitgenommen; ihre Zungen klebten am Gaumen.
Sie strebten denn auch vor allem dem Wirtshaus zu, und erst als sie dort einige Erfrischung zu sich genommen hatten, da erst wurde der eine und andere gesprächig.
Nun erfuhren die Frager, was die Angekommenen zuvor nur in abgerissenen Worten andeutungsweise hingeworfen hatten, dass nämlich die Engländer auch vor Stanwix nochmals aufs Haupt geschlagen worden waren. Nun kannte der Freudenausbruch der Männer keine Grenzen mehr.
Laut aufjubelnd umarmten sie sich und Addy musste es sich gefallen lassen, dass er fast erdrückt wurde.
Nur der Oneida stand stumm an einen Baum gelehnt, die Büchse im Arm, und ließ die dunklen Glutaugen gleichmütig über die bewegte Szene gleiten.
Als der erste Freudentaumel vorbei war, ging es wieder an ein lebhaftes Fragen nach den Einzelheiten, aber die wenigsten ließen sich halten, denn sie strebten nach Hause zu kommen, warteten doch dort seit vielen Tagen bangend Frau und Kind.
Die einen zogen denn auch sogleich die Straße weiter, andere verschafften sich Pferde, wieder andere setzten über den Fluss, denn weit verstreut lagen die einzelnen Farmen.
Auch Addy schlug sich seitwärts, drängte es ihn doch, dem General so schnell wie möglich Bericht zu erstatten, und hatte er ihm doch von dem Kommandanten in Stanwix, Oberst Gansevoort, eine wichtige Botschaft zu überbringen.
Als man den Jäger trotzdem fast gewaltsam zurückhalten wollte, verwies er auf den Oneida, der, wie er sagte, besser noch wie er die Ereignisse zu beobachten Gelegenheit gehabt habe.
Nun zog man den Flinken Biber an den Tisch und bot ihm zunächst einige Erfrischungen an. Doch der rote Mann nahm nur von dem dargereichten Tabak und entschied sich für ein Glas Feuerwasser.
»Na, wie war es?«, fragte Franzl, als der Oneida seine Pfeife in Brand gesetzt hatte. »Auch mitg’holfn?«
Der Grünrock hob zugleich die Faust, um seiner Frage durch eine unverkennbare Geste etlichen Nachdruck zu verleihen.
»Nein – nicht kämpfen«, entgegnete der Oneida, die Büchse zwischen den Beinen zurechtschiebend, »aber sehen, wie weiße Männer vom Mohawk schon am ersten Tage kämpfen. Nicht gut, dass zwischen Bergen marschieren.«
»Das war freilich eine große Dummheit. Also hast du schon den Kampf in der Schlucht mit angesehen?«
»Flinker Biber Kampf sehr gut sehen; Männer vom Mohawk und Huronen Flinken Biber nicht sehen. Sehr gut sehen, wie mit Inschen, dann mit Englishmen kämpfen; sehr gut sehen, wie das Singende Maul sehr brav kämpfen.«
Die Farmer brachen in eine Lachsalve aus, denn der eben verliehene Ehrentitel gebührte keinem anderen als Franzl, der, wie sie alle wussten, seine Mußestunden nicht selten dazu benutzte, die Maultrommel zu spielen.
Franzl machte im ersten Augenblick ein etwas verdutztes Gesicht. Er verschluckte aber rasch die kleine Wallung, die ihm die unverhoffte Ehrung verursacht hatte, und lachte schließlich selber mit.
Der Rote ließ sich durch das kleine Intermezzo in seiner Ruhe nicht im Geringsten stören. Er nahm einen Schluck von dem inzwischen herbeigebrachten Feuerwasser und fuhr dann fort zu erzählen: »Flinker Biber sehen, wie Kampf zu Ende gehen, sehen, wie Männer vom Mohawk verwundete Krieger auflesen und forttragen; sehen, wie Addy mit hundert Kriegern den Englishmen und Inschen folgen.«
»Er war fest hinter ihnen drein und hat ihnen noch übel mitgespielt?«
»Nein, Addy nicht fest hinter ihnen her, er nicht kämpfen; er klug, er ganz im Stillen folgen; Inschen und Englishmen nicht merken, dass ihnen folgen.«
»Ah – er hatte sein Plänchen. Die Royal Greens zogen sich aber doch durch die Wälder auf ihre vorherige Stellung zurück?«
»Ja, gehen nach Stanwix; gehen sehr schnell, laufen was ihm können; dort finden dann eine sehr böse Überraschung.«
»Wieso das?«
»Der Häuptling der weißen Krieger schicken schon zwei Tage, ehe er in der Schlucht kämpfen, Boten an Oberst Gansevoort nach Stanwix, dass werden kommen; er Zeichen verabreden, dann mit ihm zusammen kämpfen. Gansevoort merken, dass Huronen und Englishmen den Mohawkkriegern entgegengehen; er schicken zweihundertfünfzig Mann; er wollen den weißen Kriegern vom Mohawk helfen; er wollen St. Leger im Rücken fassen. Aber Stanwixkrieger nicht finden St. Leger; dann zurückmarschieren und nehmen sein ganzes Lager.«
»Das Lager von St. Leger?«
»Ja, nehmen Lager von St. Leger und Stanwixkrieger dabei sehr brav kämpfen; nehmen alles was ihm finden; nehmen Donnerbüchsen und Fahnen; nehmen Pulver und Blei und nehmen Geschenke für Huronen.«
»Die St. Leger als Belohnung für die Indianer bestimmt hatte?«
»St. Leger führen mit sich sehr viele Geschenke für Inschen; Stanwixkrieger aber nehmen alle; Stanwixkrieger nehmen auch Decken von Inschen; Inschen nackt kämpfen; Inschen zurückkommen, nichts mehr finden, Inschen nichts mehr besitzen.«
»Bravo!«, riefen die Männer. »Das ist dem Gezücht zu gönnen; das ist der gerechte Lohn für ihre hündischen Dienste, die sie den Engländern in gewinnsüchtiger Absicht leisteten.«
»Huronen schlecht«, fuhr der Oneida fort, »Huronen sehr schlecht, Huronen geschehen ganz recht. Dann Nacht kommen, werden sehr kalt; Inschen keine Decken; Verwundete sehr frieren; viele sterben.«
»Und Addy mit unseren Leuten, wo blieben die?«
»Addy warten, bis ganz dunkel, dann schleichen ganz nahe an Inschen und Englishmen; dort bleiben versteckt im Wald.«
»Er wollte den Englishmen erst am anderen Morgen den Denkzettel geben?«
»Addy großer Krieger, kluger Krieger. Er zählen nur hundert Büchsen, aber er nehmen Stellung, dass St. Leger glauben, er haben vor sich alle Mohawkkrieger. Am anderen Morgen Englishmen noch schlafen. Addy aber wecken Englishmen. Er schießen fürchterlich auf St. Leger. Gansevoort das hören, er schießen aus dem Fort mit Donnerbüchsen. St. Leger schnell verlieren allen Mut; Englishmen alle verlieren den Mut; dann alle davonlaufen.«
»Brav gemacht!«
»Das lässt sich hören!«
»Da werden wir jetzt wohl für einige Zeit Ruhe haben!«
»Mohawkkrieger bekommen sehr viel Ruhe, Huronen jetzt nicht mehr Freunde von Englishmen.«
»Warum das?«
»Huronen sich fürchterlich ärgern, dass nichts mehr besitzen; dass Englishmen lassen Stanwixkrieger das Lager nehmen. Huronen sich schnell rächen; nehmen noch in der Nacht alles Gepäck von englischen Offizieren; nehmen heimlich alle Boote von Wood Creek und fahren fort auf dem Wasser.«
»O«, riefen die Männer, »das ist noch das Beste an der Sache, dass sich die beiden Freunde zu guter Letzt selber in die Haare gerieten.«
»Auch englische Offiziere jetzt sehr schlecht sprechen von Huronenkrieger. Früher große Freundschaft, jetzt viele Feindschaft.«
»Das könnte uns nur recht sein, aber – Pack schlägt sich, Pack verträgt sich; morgen vielleicht schon schließt Thayendanegeas, wenn ihm die Engländer irgendwelche Vorteile bieten, einen neuen Vertrag. Was meinst du, Roter?«
»Thayendanegeas zu allem fähig; Huronen sehr viele Krieger verlieren, das den Mohawkkriegern nicht vergessen.«
»Damit willst du sagen, dass wir ihnen bei Oriskany harte Verluste zugefügt und einigen Respekt eingeflößt haben?«
»Huronen jetzt sehr großen Respekt vor Mohawkkrieger; mit Mohawkkrieger nicht mehr offen kämpfen.«
»Das soll doch nicht etwa heißen, dass uns die Huronen in Zukunft mit Besuchen auf Schleichwegen beehren werden? Das wäre noch viel schlimmer«, bemerkte einer der Männer.
Der Flinke Biber zuckte die Achseln und sagte: »Huronen sehr rachgierig; jetzt aber nicht Schleichweg, nicht Kriegspfad betreten; jetzt Tote beweinen.«
»Ja, sie müssen schauderhaft gelitten haben – zuletzt, das weiß ja jeder von euch – sah man ja fast nur noch lauter Grünröcke.«
»Ja, Inschen große Verluste«, erklärte der Rote, »fast alle Häuptlinge tot; sehr viele Krieger tot; viele später sterben. Squaws sehr heulen, wenn heimkommen in ihre Dörfer.«
Der Oneida fuhr von seinem Sitz auf und richtete den Blick forschend in die Ferne.
Ein Reiter im einfachen Bauernkittel, mit einem zweiten reiterlosen Pferd am Zügel, sprengte die Landstraße herauf.
Dieser Reiter hatte es sehr eilig, denn als er an dem Gasthaus vorübergaloppierte und die Männer ihm die Frage zuriefen, was es gäbe, da schenkte er ihnen kaum Gehör. »Zum Wundarzt!«, rief er im Vorbeireiten nur schnell über die Achsel zurück und sprengte im schärfsten Tempo weiter.
Die Männer wussten, dass es einer der Großknechte des Herckheimerschen Gutes war, und nicht geringe Aufregung bemächtigte sich jetzt ihrer.
»Es wird doch nicht eine Wendung zum Schlimmen eingetreten sein?«, fragte bestürzt der eine und andere, und ihre Befürchtung war leider nicht unbegründet.
General Herckheimer hatte nämlich während und nach dem Treffen bei Oriskany die Schwere seiner Verwundung mit dem größten Heroismus verleugnet, und groß war daher die schmerzliche Überraschung zunächst seiner engeren Umgebung, als sich nach seiner Heimkehr herausstellte, dass das Bein unterhalb des Knies total zerschmettert sei.
Allgemein aber wurde die Bestürzung, als schon am andern Tag die Kunde wie ein Lauffeuer durch das ganze Tal ging, dass die Amputation des Beins unumgänglich sei, und es gab wohl keinen Talbewohner, der nicht aufs Schmerzlichste von dem herben Geschick ergriffen wurde, das den tapferen Mann betroffen.
Man musste es unter diesen Umständen dann noch als ein Glück preisen, als der Wundarzt später erklärte, dass die schwere Operation gut von statten gegangen sei – freilich würde der General leider zum Stelzfuß –, dass aber nach menschlicher Voraussicht die Heilung eine durchaus normale werden würde.
Und nun sollte auch diese plötzlich infrage gestellt sein? Das wäre des Unglücks doch zu viel gewesen.
»I kann’s nit glaub’n«, fuhr Franzl jäh auf. »Heunt morg’n noch war er ja völli’ frisch und munta.«
»Er hat sogar noch, wie Ihr selber erzähltet, Briefe geschrieben?«
»Hab’ ihm Feder und Tint’n bring’n müss’n und das Schreiberzeug im Bett eigenhändi’ z’recht g’richt. Und ös wißt’s, der Herckheimer muaß scho’ recht guat aufg’legt sein, wenn er nach der Federn greift.«
»Die Schreiberei war nie seine Sache, das ist kein Geheimnis.«
»Hab’ ihn dann g’fragt, wie’s mit der Wund’n steht. G’lacht hat er und g’sagt, dass es mit ‘m Marschier’n wohl für alle Zeit’n vorbei sei; er würd’ von jetzt an nur noch wie die groß’n Herrn hoch zu Roß auf seinen Farmen herumreit’n. Aber«, stockte Franzl, »i hab von Anfang an zu dem Pflasterschmierer ‘s rechte Vertrauen net g’habt.«
»Zum Wundarzt?«
»Z’ wem sonst? Man hat’s dem Mensch’n förmli’ ang’sehn, dass er seiner Sach’ net sicher war – i versteh nix vom Doktern und nix vom Amputier’n, aber nach mei’m Dafürhalt’n hat er an dem Knoch’n herumg’sab’lt, dass’s a wahre Schand is.«
»Das hat auch«, bestätigte der Schnauzbart, »seine Haushälterin jedem, der es wissen wollte, erzählt. Sie behauptete, es wäre mehr Blut geflossen, als ein Mensch überhaupt besitzen könne; gewiß hätte der Wundarzt vor dem Schneiden die Blutgefäße nicht stark genug unterbunden.«
»So viel is g’wiß, ganz richti’ war’s nit«, schimpfte Franzl und warf ein Geldstück so heftig auf den Tisch, dass es hoch aufsprang und zu Boden rollte. Er langte dann nach seiner Büchse, grüßte kurz und schlug mit weiten Schritten den Weg zum Herckheimerschen Gut ein.
Dieses lag, wie dem Leser bereits bekannt, etwa eine Stunde weit von Little Falls entfernt. Schon von Weitem leuchteten dem Besucher die weißen Mauern und die grünen Fensterläden des Wohnhauses freundlich entgegen. Es lag inmitten eines herrlich bestandenen Baumgutes und zeichnete sich vor den Wohnhäusern der Nachbarfarmen durch das Gepräge der Wohlhabenheit des Besitzers besonders aus. Zu beiden Seiten des Hauseinganges hatte es sogar den Luxus zweier von zierlichem Holzwerk umsäumter Veranden, an denen das Auge nur eines, den Schmuck der sonst üblichen Geißblatt- oder Weinlaubranken vermisste.
Dieser Mangel aber hatte seinen guten Grund. Man konnte und durfte auch hier mit Rücksicht auf eine etwa notwendig werdende Verteidigung dem Erdgeschoss die freie Aussicht nicht nehmen.
Aus dem gleichen Grund waren auch die vier kleinen Ecktürmchen und das Erdgeschoss auf allen vier Seiten des Hauses zahlreich mit Schießscharten versehen.
Als Franzl daselbst anlangte, traf eben auch der Großknecht mit dem Wundarzt ein.
Der Letztere betrat sofort das Haus, während der Knecht den beiden stark erhitzten Pferden Decken überwarf und sie dann zum Stall führte.
Unter dem Hauseingang traf Franzl auf Binche, die Haushälterin, die, heftig schluchzend, mit dem Schürzenzipfel die Augen wischte. Neben ihr an die Wand gelehnt stand derselbe junge Mann, dem Franzl im Gefecht bei Oriskany den Fußtritt versetzte.
Dieser junge Mensch war eine nichts weniger als sympathische Erscheinung. Die grünlichen Augen unter der niedrigen Stirn lagen auffallend nahe beieinander. Das Gesicht war bartlos und geistlos flach. Es entbehrte aber gleichwohl nicht eines gewissen Ausdruckes listiger Verschlagenheit.
Der Blick, der den Eintretenden streifte, verhieß diesem wenig Gutes.
»Wie steht’s, Binche (Philippine)?«, fragte, ohne dem jungen Manne Beachtung zu schenken, Franzl die Weinende.
»O, schlecht«, schluchzte diese. »Ich fürchte, er macht es nicht mehr lange.«
»Was is g’scheh’n? Er war ja heunt morg’n noch ganz munta!«
»Nichts ist geschehen. Die Wunde hat ganz von selber zu bluten angefangen. Schon vor einer halben Stunde glaubte ich, es ginge aus.«
Ohne lange zu fragen, ob es gestattet sei, ging Franzl zum Krankenzimmer.
Hier traf er auf mehrere männliche und weibliche Verwandte des Generals, die alle, tiefe Trauer in den Mienen, schmerzlich bewegt das Krankenlager umstanden.
Herckheimer lag bleich und mit eingefallenen Wangen von einer Ohnmacht umfangen, die der Wundarzt durch blutstillende und belebende Mittel zu bekämpfen suchte, wobei ihm Addy mit Handreichungen eifrig zur Seite stand.
Fast schien es, als ob alle diese Bemühungen erfolglos sein sollten, als Herckheimer plötzlich die Augen aufschlug, den matten Blick eine Weile auf der Zimmerdecke umherirren, dann auf seinen Verwandten ruhen ließ. Ein leichtes Lächeln glitt dabei um seine blutleeren Lippen.
»Es ist gut, dass ihr da seid«, sagte er über eine Weile mit matter Stimme, »es ist … denke ich … gerade die rechte Zeit … zum Abschiednehmen.«
»Lass das, Nikolaus«, entgegnete ein stattlicher, silberhaariger Alter, der dicht an das Bett herantrat und seine Hand auf diejenige des Generals legte. »Lass das. Im Himmel wohnt ein Gott; er ist gnädig, wir wollen die Hoffnung, dass uns dein Leben erhalten bleibt, noch lange nicht aufgeben.«
Wieder lächelte Herckheimer. »Es wird umsonst sein«, sagte er. »Der liebe Gott im Himmel, er wird mich nicht auf der Erde lassen wollen, er wird mich zu sich nehmen – ich fühle es.«
Stumm standen die Männer; die Frauen begannen zu schluchzen.
»Es ist wohl schon spät am Tage?«, fragte der Kranke nach einer längeren Pause.
Addy, auf den der fragende Blick des Verwundeten gefallen war, nickte bejahend.
»Ja, es will Abend werden«, sagte der General still für sich hin und ein Seufzer entrang sich seiner Brust.
Er versuchte den Kopf ein wenig zu heben und sagte, als ihm Addy das Kopfkissen etwas höher gebettet hatte, mit fester Stimme: »Lasst uns die wenige Zeit noch nützen – Adam berichte, was gibt es Neues?«
»Herr, Ihr sollt Euch ruhig verhalten«, mahnte der Wundarzt, »jede Erregung wird Euch schaden.«
»Lasst das«, wehrte Herckheimer. »Gönnt mir doch die wenigen Minuten. Ich werde mich nicht mehr erregen, das kann ich Euch sicher versprechen. Ihr seht ja, ebenso wie ich dem Feind fest ins Auge gesehen habe, so sehe ich auch dem Tod ruhig entgegen. Also, Adam …«
»Ein Bote mit einem Brief ist angekommen.«
»Von wem?«
»Vom General Schuyler.«
»Vom Schuyler? Dann brich den Brief auf – lies ihn.«
Addy tat, wie ihm geheißen, entfaltete das Schreiben und las mit bewegter Stimme:
Soeben habe ich Ihren gestrigen Brief erhalten. Ihre und Ihrer wenigen Mitkämpfer Tapferkeit, welche eine so überlegene Anzahl Wilder zurückschlug, macht Ihnen große Ehre. Ich habe Ihnen vor drei Tagen einige Kontinentaltruppen zugesandt, eine andere Abteilung marschiert heute ab, und da die Miliz auch herbeieilt, so hoffe ich, Ihnen bald fernere Verstärkungen zuschicken zu können. Ich wünsche Ihnen eine glückliche und schnelle Heilung Ihrer Wunden.
Philipp Schuyler
»Demnach scheint es im Norden und unten am Hudson nicht allzu schlecht zu stehen – hoffentlich gelingt es Schuyler, das Fort Eduard zu halten. Und das Lob, das er uns spendet, daran gebührt dir ein redlicher Teil, Adam.«
»Wir wollen davon nicht reden«, meinte Addy und faltete das Papierblatt wieder zusammen. »Wir haben ein jeglicher unsere Schuldigkeit getan. Wir wollen nur wünschen, dass der Wunsch am Schluss des Briefes recht bald zur Wahrheit wird.«
»Ja, der Wunsch am Schluss, er ist gut gemeint von dem Schuyler«, versetzte Herckheimer, »aber, ich fürchte, er wird wohl ein frommer Wunsch bleiben.«
Wieder versank der Kranke in Nachsinnen und was seinen Geist beschäftigte, musste friedsam freundlicher Natur sein, denn der Ausdruck seines bleichen Antlitzes war fast heiter.
Niemand wagte das Schweigen zu unterbrechen. Alle Anwesenden blieben still und stumm. Nur vom offenstehenden Nebenzimmer her tickte leise der Schlag einer Standuhr.
Plötzlich sagte der Kranke: »Die Zeit eilt … Adam … höre auf mich … ich habe mit dir noch ein ernstes Wort zu reden. Du bist als einer der wackersten Männer im ganzen Tal wohlgelitten … aber«, fuhr Herckheimer, nachdem er eine kleine Pause gemacht hatte, weiter, »du bist ein unsteter Geselle. Ich fürchte, wie dich der Wind eines Tages von ungefähr in das Tal hereingeweht hat, so möchte es sein, dass du plötzlich wieder gingest. Das … Adam … möchte ich verhüten. Du wirst noch mehr von mir hören … dann, wenn ich nicht mehr bin … der Gedanke, dich an uns zu fesseln, hat mich von jeher beschäftigt, er ist nicht von heute. Versprich mir jetzt … dem sterbenden Herckheimer …, dass du der Unsere bleiben willst, dass du den Unseren, die, wie ich wohl weiß, nachgerade auch dir ans Herz gewachsen sind, stets mit Rat und Tat an die Hand gehen wirst. Sie brauchen einen starken Mann mit deiner Erfahrung um sich, von deiner Umsicht, deinem Mut und deiner Entschlossenheit, denn wer weiß, was die Zeiten bringen. Du bist doch auch schon ein reiferer Mann, bist beliebt, könntest es zu Besitz und Ansehen bringen, und – glaube mir – eine feste Scholle unter den Füßen könnte dir wahrlich nicht schaden.«
Addy war sichtlich zu sehr bewegt, um mit Worten antworten zu können. Der wetterharte Mann wischte mit dem Handrücken über die Augen, erfasste dann sachte, als fürchte er etwas zu zerbrechen, des Verwundeten Hand und umschloss sie mit sanftem Druck.
Die lange Rede hatte Herckheimer sichtlich geschwächt. Ermattet ließ er den Kopf tiefer in das Kissen sinken.
Plötzlich aber erhob er das Haupt wieder etwas und mit einem unbeschreiblichen Ausdruck im Antlitz sagte er: »Seid still … ganz still … es kommt … ich fühle es, es kommt … gebt mir noch ein weiteres Kissen unter den Kopf … und … die Bibel.«
Man entsprach schnell seinem Wunsch.
Herckheimer erfasste das schwere Buch mit zitternden Händen und blätterte darin nicht lange.
Die Anwesenden sanken auf die Knie nieder, dann las er:
»Herr strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm … denn deine Pfeile stecken in mir, und deine Hand drücket mich … Mein Herz bebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist nicht bei mir … Und muss sein wie einer, der nicht höret, und der keine Widerrede in seinem Munde hat … Aber ich harre, Herr, auf dich; du, Herr, mein Gott, wirst erhören … Verlass mich nicht, sei nicht fern von mir … Eile mir beizustehen, Herr, meine Hilfe …«
Mit den letzten Worten des Psalms sank Herckheimers Stimme fast zur Tonlosigkeit herab, das Buch entfiel den fast durchsichtig gewordenen Händen. Mit einem friedsamen Lächeln im Antlitz war der Held vom Mohawktal sanft entschlummert.
*
Während ein graubärtiger Alter etwa fünfundzwanzig Ruten südöstlich vom Herckheimerschen Wohnhaus das Grab schaufelte, hatte die Kunde von dem Tod des geliebten Führers wie ein Lauffeuer durch das ganze Tal ihren Weg genommen und überall die tiefste Trauer erweckt.
Von allen Richtungen kamen die Farmer, Jung und Alt, zu Fuß und zu Pferde, um dem allverehrten Mann und tapferen Kommandanten der Milizen das letzte Geleit zu geben.
Es war eine imposante Versammlung von wetterfesten Männern, sonst fröhlich in der Arbeit, fröhlich im Genuss, wacker im Streit mit dem grimmigen Feind, nun aber stumm und still, voll tiefer Trauer an dem Rand der feuchten Grube stehend, in die sie ihren Besten versenkten.
Wussten sie doch, was sie an ihm verloren hatten, was sie ihm seit Jahren an Dank schuldeten, zuletzt noch durch seinen frischen Wagemut, den mordgierigen Feind nicht erst zu erwarten, sondern aufzusuchen, ihm keck die Stirn zu bieten. Kannten sie doch alle sein edles Beispiel, wodurch er die Männer zur höchsten Hartnäckigkeit entflammte und ein ohne sein Verschulden unglücklich eingeleitetes Treffen, das fast schon eine Niederlage war, in einen Triumph wandelte.
Mancher unter ihnen beweinte seit jenem Gefecht den Sohn, den Bruder oder Vater. Ihr Herz krampfte sich zusammen und die Zornesader schwoll ihnen, wenn sie daran dachten, dass es dem Feind früher oder später wieder einmal gefallen könnte, mit rauer Hand in ihre friedvolle Arbeit einzugreifen. Wehe ihm, wenn er es wagen sollte!
Addy stand gesenkten Hauptes, krampfhaft den Lauf seiner Büchse mit beiden Händen umklammernd, jäh zusammenschauernd, als die erste Erdscholle dumpf auf den Deckel des versenkten Sarges niederfiel.
Als einer der Letzten trat er an den Rand der Grube vor, entblößte sein Haupt und stand lange im stillen Gebet.
Als er sich dann mit einem letzten Abschiedsgruß abwendete, fiel sein Blick in die Ferne. Er umdüsterte sich und blieb unwillkürlich an den Bergen im Westen haften, wo wenige Tage zuvor Ströme von Blut geflossen waren.
Aber nicht allein im ganzen Mohawktal war die tiefste Trauer eingekehrt, sie nahm ihren Weg weit hinein ins Land. Überall erkannte man die Bedeutung des Treffens bei Oriskany und pries die Wendung, welche dadurch die bisher unglücklich geführte nördliche Kampagne genommen hatte. Ja, sogar der Kongress der Vereinigten Staaten trat alsbald zusammen und sprach dem treuen heimgegangenen Patrioten in einem offiziellen Schreiben den Dank der Staatenregierung aus und dekretierte zugleich fünfhundert Dollar, ihm ein Denkmal zu setzen, das indessen heute, nach mehr als hundert Jahren, dem tapferen Sohn des Pfälzer Bauern noch nicht errichtet ist.
Wohl aber traten die Farmer in und um Little Falls zusammen und setzten einen einfachen weißen Gedenkstein auf das Grab, auf dem die Inschrift zu lesen steht:
General Nikolaus Herckheimer,
gestorben am 14. August, zehn Tage nach der Schlacht von Oriskany,
in welcher er die Wunde erhielt, die seinen Tod herbeigeführt hat.
Schreibe einen Kommentar