Der Spion Band 1 – Die Schlacht bei Jena – 4. Kapitel
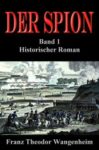 Franz Theodor Wangenheim
Franz Theodor Wangenheim
Der Spion
Band 1 – Die Schlacht bei Jena
Historischer Roman
Verlag von C. P. Melzer, Leipzig 1840
4. Kapitel
Mitternacht war vorüber. Nur am Portal des Gasthofes Zum braunen Hirsch und in zwei Zimmern der Beletage war noch Licht. Auf den Straßen waren ruhig, doch war es nicht die Ruhe des Friedens, nicht die erquickende Ruhe nach dem Geschäft des Tages. Es war vielmehr ein unheimliches Schweigen, ein unglückliches, wie etwa, wenn der Sturm plötzlich aufgehört, als wollte er sich zu neuem Verderben stärken. Die exaltierten Bewohner der Hauptstadt waren erschlafft dem Schlummer in die Arme gesunken, die Gemäßigteren mit Ergebung, die Einsichtsvollsten und Bangenden waren zu ihm geflüchtet. Denn das war kein Kampf der Kraft gegen die Kraft, die Waffen waren ungleich, zumal da man Sachsens nicht versichert war. Hier hieß es nicht mehr und nicht weniger, als mit Ehren kämpfen und fallen oder mit Schmach dulden und doch fallen. Es blieb keine andere Wahl, als gegen die absoluteste Tyrannei das Schwert zu ziehen. Wann hätte wohl die sich gegen den ungerechten Unterdrücker stemmende Schwäche ihren Feind nach Zahl und Vermögen geschätzt?
In so später Stunde hielt ein leichter Wagen, von zwei raschen Pferden dahergebracht, unter dem Portal des Gasthofes. Ein Diener sprang vom hohen Sitz, zog heftig an der Hausglocke. Nachdem geöffnet worden, fragte er, ob der Herr von Zweien einige Zimmer haben könnte. Nachdem bejaht worden war, verließ ein hochgewachsener Mann, in einem weiten Mantel, den Wagen, trat in das Haus und die Extrapost rasselte davon.
Er verlangte nichts als eine Flasche Wein und erlaubte dann seinem Bedienten, zu Bett zugehen. In dieser Erlaubnis lag auch diejenige für den Kellner.
Das Licht in der Beletage brannte nicht durch Zufall so tief in die Nacht hinein. Diese beiden Zimmer, Nummer 3 und 4, hatte die Dame, welche in dem schweren, eleganten Reisewagen angekommen war, inne. Die Zimmer waren geschmackvoll und reich dekoriert. Was zur Bequemlichkeit der Reisenden beitragen konnte, war hier zu finden, in dem Palast eines Fürsten fanden sich nicht schönere Möbel. Gardinen von roter Seite fielen bis auf den bunten, weichen Teppich des Bodens hernieder. Große Spiegel bis zur Decke hinauf reichend, vervielfältigten den Lichterglanz. Das Prachtvollste jedoch war ein Diwan, über welchen vier Engel aus Bronze eine Decke hielten, dass es schier wie ein Thronhimmel aussah.
Auf diesem Diwan von Rot und Gold saß eine Frau von unaussprechlicher Schönheit; voll, üppig, eine Liebesgöttin und zugleich die Repräsentantin höchsten Entzückens. Wie scharf kontrastierten die glänzenden, schwarzen Löckchen des Tituskopfes gegen den durchsichtigen Schnee der hohen Stirn, des vollen, wie aus Alabaster geformten Halses, Die kühnen dunklen Bogen über dem blitzenden Augenpaar; nicht anders, als ob das Geschoss des Liebesgottes hier in höchster Spannung lauerte; denn der Blitz aus diesem Auge war wie die scharfe Spitze des auf der Sehne gehaltenen Pfeils. Die Frau war schön, und was mehr ist als das: Jeder einzelne Teil des Gesichtes war an und für sich vollkommen schön; dennoch aber harmonierten sie alle zu einem vollkommenen Ganzen. Diese Frau entkräftete den Satz des weisen Salomo. Der Beruf sprach sich in den schwellenden Lippen aus, der Beruf im halb verhüllten, wogenden Busen und das durchsichtige, faltenreiche Negligé, welches an Weiße mit dem frischgefallenen Schnee um den Vorzug buhlte, zeigte oder ließ die Wellenlinien einer Gestalt ahnen, die dem vorzüglichsten bildenden Künstler als Modell der verlangenden und alles versprechenden Frau gelten konnte. Diese überaus schöne Frau verriet in der Wahl der Draperie um sich her, dass es seine Schönheit im besten Licht zu zeigen verstand; denn kaum raschelte etwas an der Tür, so beugte sie sich in eine nachlässige Stellung zurück und die Decke über dem Diwan erhielt die Bedeutung des Faltenwurfes auf dem berühmten Semele-Bild. Milde Wärme und Parfüm durchzogen den Aufenthalt der herrlichen Frau; alles vereinigte sich, um einen Himmel um dieselbe zu schaffen.
Nun wurde die Tür des ersten Zimmers leise geöffnet, es huschte herzu und im Eingang zu dem Gemach, wo die Dame saß, stand derselbe Mann, welcher vor ganz kurzer Zeit abgestiegen war, der Herr von Zweien. Das Licht der Kerzen beleuchtete ihn so grell, dass die Dame sogar die zwei kleinen, aber tiefen Falten, welche von der Nase in die Stirn brachen, erkannte. Sie erhob sich rasch, als ob es ihr die Pflicht des Dienstes geböte. Die junonische Gestalt schritt auf den Harrenden zu. Sie flüsterte süß und lockend: »Willkommen, Freund, willkommen in Berlin.«
Aber der Fremde erwiderte nichts weiter, als dass er die dargereichte samtweiche Hand leise berührte. Währenddessen ließ er die scharfen Blicke die Umgebung mustern, wie ein Dieb etwa, der mit der stillen Nacht und dem verschwiegenen Wolkenschleier in das Haus gedrungen war. Nach einer tiefen minutenlangen Stille öffnete er den Mund endlich: »Ich bin mit dir zufrieden.« Er schlürfte über den Teppich an den Wänden umher und überzeugte sich mit Hand und Auge. »Dieses Zimmer ist das letzte im ersten Stock. Von jener Seite kann uns niemand belauschen. Schließen wir die Tür des Vorzimmers, so sind wir auch da sicher.«
Er ging wieder zurück und tat seine Erfahrung im heimlichen Werk bei dem lautlosen Schließen kund. Wie ganz verändert stand er dann vor der schönen Frau! Sein Anstand, sein Blick, seine Miene, sie sprachen von unbedingter Herrschaft, ja von einer strengen, denn sein glimmendes Augen paar haftete durchdringend und prüfend auf der Dame, welche, den Blick missdeutend, das Negligé über den Busen zog. Er lächelte wie mit Bedauern oder wegwerfendem Stolz, nahm den schwarzen Bart vom Gesicht und – der Magister aus der Weinstube warf sich auf den schwellenden Diwan.
»Setz dich her zu mir, Manon«, sprach er mit frostigem Ton, »ich habe vieles mit dir abzumachen.«
Die Dame gehorchte. Ihn erregte der warme Atem der schönen Frau nicht. Seine Miene blieb tot, wie der Assessor sie aufgefangen hatte.
»Du kommst von Paris?«
»Auf geradem Wege.«
»Auf welchen Namen lautet dein Pass.«
»Frau von Zweien.«
»Gut. Weiß der Kaiser, dass ich ihn in Mainz aufsuchen werde?«
»Er rechnet mit Bestimmtheit auf dich.«
»Ehe wir vergessen. Hier nimm diese Anweisung auf zwanzigtausend Franc. Du wirst sie mir auszahlen, der Prinz von Pontecorvo kann sie dir wiedergeben.« Sie ging zu ihrer Schatulle, nahm das Geld heraus und legte dafür eine Anweisung hinein.
»Hast du Nachricht von Brancas?«
»Ich sprach ihn kurz vor meiner Abreise.«
»Lass hören.«
»Was?«
»Sonderbare Frage!« Er warf einen misstrauischen Blick auf die nun wieder neben ihm Sitzende. »Manon, Manon, dass ich dich niemals wieder auf solch einer Frage ertappe. Was! Was! Alles, was du weißt, sollst du mir sagen, damit ich es zu einer Latwerge zusammenrühre und dem Kriegsministerium eingebe.«
»Wohin soll das endlich führen?«, seufzte sie.
»Sagtest du das, als ich dich in dem Gartenhäuschen der Vorstadt St. Antoine besuchte? Wohin meine Besuche geführt haben, das ist dir klar: Das dürftige Blumenmädchen, welches mir auf den Boulevards für einen Sous das Bouquet Veilchen bot, reist jetzt fürstlich, ein Prinz küsst dir die Hände wund und schmachtet nach dem Kissen, welches man einen Busen nennt; Geld im Überfluss, Ketten, Ringe, Juwelen und dabei noch das Bewusstsein, in der großen Welt eine bedeutungsvolle Marke zu sein. Manon, dahin haben meine Besuche geführt. Wer weiß, wohin ich noch das Ziel recke? Entweder ungeheuren Reichtum will ich erlangen und hohe Ehren oder …« Er machte eine Bewegung, welche das schmähliche Ende bezeichnete.
Sie wandte sich mit Grauen von ihm ab.
»Törin«, sprach er, »was verschlägt es dir, wenn …?«
Da umarmte sie ihn stürmisch und erstickte die nächsten Worte mit ihren Küssen.
»Wäre es möglich?«, fragte er, indem er sie groß anstaunte, »wär es möglich, dass Manon mich noch liebte?«
»Wenn du einen Augenblick gezweifelt hast, so begingst du eine Sünde, für die meine verdoppelte Zärtlichkeit dich strafen wird.«
»Strafen? Ich verstehe dich nicht ganz.«
»Wie mochtest du an Manons Herzen zweifeln, wenn du nicht selbst dich schuldig fühltest?«
»Ah, ich merke! Die Geschichte mit der Marquise? Du weißt ja, dass ich an den Tölpel von Mann musste und es gelang. Aber Manon wird doch so viel Vertrauen in sich setzen, dass ihr eine Marquise nicht gefährlich sei!«
»Schmeichler! Nun ja, ich will egoistisch denken, das lehrtest du mich. Küsse mich, Freund.«
»Und Brancas? Was sagte er dir?«
»Er sprach nur von denjenigen, welche die Heere führen würden.«
Der Magister hatte schon wieder das schwarze Buch und den Crayon in der Hand: »Also?«
»Die Marschalle Soult und Ney, der Großherzog von Berg, der Prinz …«
»Welcher Prinz?«
»Ah, ich vergaß, der Prinz von Pontecorvo.«
»Es scheint, als ob ihr gut miteinander standet«, gab der Zweideutige lachend von sich, »der Prinz, der Prinz! Manon, denkst du etwa, dass alle Menschen gleich dir nur einen Prinzen kennen? Also weiter.«
»Grausamer Quälgeist!«
»Weiter, nur weiter! Wenn wir damit zu Ende sind, dann bleibt uns wohl ein Weilchen zum verliebten Zank. Der Prinz von Pontecorvo.«
»Marschall Davoust, Lannes und Augereau.«
»Von einer Disposition sagte er nichts.«
»Gar nichts.«
»Gut; es wird sich finden. Wo ist Capuccio?«
»In Padua. Die Zeit wird ihm lang.«
»Er muss in Italien bleiben, wie Stepianeff in Petersburg und Godolsky in Warschau. Er wird in Padua bald genug zu tun bekommen. Doch er gefällt mir nicht recht. Er muss die höheren Kreise mehr frequentieren, damit sich das Eckige von seinem Benehmen verliert. Wenn er nicht zuverlässig wäre, so würde ich mich durchaus nicht mit ihm eingelassen haben; jedoch er könnte, und eben durch sein Benehmen, verstoßen und …«
»Fürchte nichts, denn der Italiener steht dem Franzosen, selbst dem Deutschen nach in verfeinerter Sitte; zumal die höheren Kreise – wer nicht ungeheuren Adelsstolz affektieren kann, dem bleiben sie unzugänglich, und was verrät den Adelsstolz mehr als ein eckiges und lächerliches Benehmen? Capuccio ist ganz an seinem Platz.«
»Warum schweigst du schon? Ich höre dich gern so sprechen, wenn auch deine Ansicht die meine nicht ganz ist. Aber du machst mir Freude, hohe Freude, denn muss ich mir nicht gestehen, diese Manon ist dein Werk? Ja, bei Gott, ich
wäre versucht, in die Stelle eines egoistischen Vaters zu rücken, der, indem er seinen blonden Buben an die Brust drückt, sich selbst das schmeichelhafteste Kompliment macht. Weißt du noch, als ich dich fragte: ›Wo wohnst du, kleine Schöne?‹ Da errötetest du über und über und stammeltest so reizend St. Antoine, dass ich mich wie mit Zauberbanden an dich gekettet fühlte. Damals, freilich Manon, damals ahnte ich nicht, dass diese schmächtigen Formen eines vierzehnjährigen Blumenmädchens sich so herrlich entwickeln könnten, dass dieses jungfräuliche Kind zur strahlenden Frau sich entfalten und der schlummernde Genius der feinsten Intrige fähig würde. Aber Geduld, Manon, Geduld! Wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann umgebe uns nie versiegender Reichtum, unser Palast wimmele von sklavischen, mir gehorchenden Menschen, Fürsten sollen mich suchen und um dich beneiden. Du und ich, wir beiden wollen dann des Lebens Hochgenüsse bis auf die letzte Neige trinken, Götter sollen an unserem Lager stehen und den Himmel mit seinen Freuden bettelhaft erkennen. Doch eines … eines, Manon«, er erhob er furchtbar ernst, »du bleibst mir treu. Liebkose, tändle, lache, scherze und küsse Prinz oder nicht, wenn es meinen Zwecken nur heilsam ist; aber, Manon!«
»Dein! Dein auf ewig! Keines anderen will ich sein!«
War es doch, als ob Manons Entzücken ihn mit sich fortrisse! Wie beredt war sein Mund, wie ausdrucksvoll sein Gesicht, wie glänzte sein Auge und selbst ein feuchter Schleier war nicht zu verkennen in dem wonneirren Auge. Er schlang den Arm um Manons Leib, sie tändelte in den Locken des girrenden Schäfers.
Da fragte er: »Und die Bürgschaft für deine Treue?«
»Fordere.«
»Einen Schwur?«
»So heilig, als ihn Menschen erdenken dürfen.«
»Schwöre mir bei der Grabesruhe Deiner Mutter.«
»Du mahnst mich an Sie?« Leichenblass und zitternd stand Manon einige Augenblicke, dann bedeckte sie mit beiden Händen das plötzlich von einem Blutstrom gerötete Gesicht, ihr Busen wogte wie vom Sturm erzeugter Wellenschlag. Über die verschiedenen Angelegenheiten waren die Kerzen vergessen worden. Sie brannten düster und ließen jeden Gegenstand im Halbdunkel, in schwankender Bewegung erscheinen. Als Manon langsam die Hände sinken ließ und des Zweideutigen stechender Blick selbst das Dunkel durchzuckte, war es ihr, als ob ein Dämon sie umstrickt hielte. Sie wandte sich vor dem Blick ab und winkte abwehrend mit den Händen.
»Manon!«, rief es leise vom Diwan her.
»Manon, soll die Erinnerung an Schwärmerei der ersten Liebe dich von dem Schwur zurückhalten? Du selbst batest damals …«
»Um Gotteswillen schweig! Hab Erbarmen und schweig!«
»Du, Manon, die Stärkste an Geist, welche dein Geschlecht aufweisen kann, und entsetzest dich vor dem Gebilde der aufgeregten Fantasie? Der reine Verstand zergliedert jegliches Begegnis nach den Gründen der Philosophie, das sagte ich dir schon vor langer Zeit, und schiebt die Verantwortung für Taten auf den Drang der Notwendigkeit. Deine Mutter trat grausam zwischen unsere Herzen. Wie blutete meines, wie war das deine zerrissen!«
»Du mordest mich!«, schrie Manon mit Entsetzen.
Ein plötzlicher Zug der Hausglocke tönte wie schreckender Donnerschlag in dieses Zwiegespräch.
Schnell wie der Blitz eilte der Zweideutige zum Fenster. Ein Blick durch dasselbe und ein Leichenantlitz starrte in Manons Züge. Diese Verwandlung gab ihr die Fassung wieder.
»Was gibt es?«, fragte sie, indem sie zum Fenster wollte.
Er aber drückte sie unsanft zurück und raunte: »Ruhig, nur ruhig! Es sind Wachen an der Tür, ich sah die Gewehre blitzen und die Bajonette.«
Schnell ergriff er nun den Bart, befestigte ihn mithilfe der feinen Federn, warf den Oberrock von sich und forderte Karten. Manon holte diese aus dem Koffer. Die beiden saßen im nächsten Augenblick am Tisch und spielten Ecarté. Eben wurde die Haustür geöffnet, die Gewehrkolben dröhnten auf dem Pflaster und eine ziemlich raue Männerstimme verlangte nach dem Wirt. Es kam über die Treppe an die Zimmer, wo die beiden spielten. Da hielt es an und folgende Unterhaltung wurde so laut geführt, dass die beiden jedes Wort verstehen konnten.
»Sie verzeihen, Herr Dose, dass ich meiner Order nachkomme: Sie werden mich stehenden Fußes begleiten.«
»Ich, Herr Polizeikommissarius? Was will man denn von mir? Und in so später Stunde! Es ist nachtschlafende Zeit!«
»Tut nichts; ich habe Order, Sie zu arretieren.«
»Order? Gedruckte Order? Dann will ich mit Ihnen gehen, aber ohne gedruckte Order – das soll mir keiner sagen.«
»Um Ihretwillen, Herr Dose, bitte ich Sie, alle Weltläuftigkeiten zu vermeiden. Militärische Hilfe ist mir zur Hand.«
»Ich meinte, dass ich es nur geträumt hätte«, bemerkte Herr Dose kleinlaut. »Nun, ich will mich nur umkleiden, bin sogleich wieder bei Ihnen.«
»Ich begleite Sie.«
»Was? In das Schlafgemach meiner Frau?«
»Noch weiter, Herr Dose; Sie werden mich zu der Dame führen, welche bei Ihnen angekommen ist. In ihrem Zimmer, glaube ich, ist noch Licht.«
»Was?«, rief Herr Dose recht laut, wegen der Reputation seines Hauses laut, »Sie wollen die Fremden inkommodieren? Wenn Sie etwas mit den Fremden haben, so warten Sie bis es Tag und Stunde erlauben, mit Damen von Stande zu sprechen; nicht aber – zucken Sie nur die Achseln; das soll mir keiner sagen.«
Die Weisung des Polizeikommissars war von der Art, dass Herr Dose keines weiteren Einwurfs sich unterfangen durfte. Im nächsten Augenblick klopfte es schon an der Tür des Vorzimmers. Herr von Zweien öffnete.
»Zu wem wollen Sie, mein Herr?«
»Wenn Sie erlauben, zu einer Dame, welche diese Zimmer innehat.«
»Zu meiner Frau? Was haben Sie mit meiner Frau zu schaffen? Das ist ein sonderbarer Fall!«
»Darf ich um Ihren werten Namen bitten, mein Herr?«
»Von Zweien, Rittergutsbesitzer in Preußisch-Polen.«
»Sie kommen?«
»Von Paris, wie mein Pass ausweist.«
»Von Paris! Das ist verdächtig.«
»Mein Herr, ich vergebe Ihnen, ob der Stellung, in welcher Sie sich befinden, das Wort, aber nehmen Sie Lehre an: Preußen war bis jetzt Frankreichs Verbündeter und da es mir in Paris besser gefiel, als in Polen, da ich ebenfalls mein Geld verzehren konnte, wo ich wollte, so blieb ich so lange in Paris, bis einige Misshelligkeiten zwischen dem Knobelsdorff und Talleirand eingetreten waren. Übrigens, wenn auch diese Erklärung nicht zu Ihrer Beruhigung beitragen sollte, so …« Er führte ihn einen Schritt zur Seite und flüsterte ihm einige Worte ins Ohr. Herr Dose war höchst erstaunt, als er den Polizeikommissar sich höflichst entschuldigen hörte und noch dem Rücken des Herrn von Zweien, als derselbe sich wieder zum Ecarté setzen wollte, Reverenz machen sah.
Es gab nur noch ein kleines Lamento, welches Madame Dose und deren Tochter Minna vollführten; dann aber entfernte sich der Polizeikommissar mit seinem Arrestanten und alles war wieder still.
»Der neugierige Bursche«, sprach der hämische Herr von Zweien, »war mir ein gefährlicher Stein des Anstoßes. Ich ließ seinen Wein durch die rheinischen Agenten mit französischen Proklamationen ausstaffieren – nun bin ich seiner los.«
Manon konnte die Frau nicht. Sie fragte besorgt, ob man ihm auch nicht an das Leben kommen würde.
»Sei ohne Sorge«, war der verächtliche Bescheid, »Berlin ist nicht Paris, und ehe der Prozess dieses Mannes durch alle Instanzen entschieden ist, steht es wohl ganz anders in der Welt. Doch ich habe nicht viele Zeit übrig. Gib mir Schreibzeug, damit ich meinen Bericht an den Kaiser fertig mache.«
Er schrieb, doch waren es weder Buchstaben noch Zeichen, die irgendein Uneingeweihter entziffern konnte. Auch für Manon blieben diese Briefe unlösbare Rätsel. Sie bewiesen, wie wenige Personen in die tiefsten Geheimnisse des Herrn von Zweien zu dringen vermochten. Der Inhalt seines Briefes an Napoleon war Folgender:
Ew. Majestät!
In unterwürfigster Verehrung erlaube ich mir die pflichtschuldige Anzeige, dass es mir gelungen ist, mich in Berlin zu orientieren. Ich lebe hier unter Namen und Charakter eines Magisters Roth, wo man ein Stück vom Theologen vorschiebt, da hat man die Leute am Köder der Pietät. Es ist kaum nötig, in Berlin zu spionieren, denn die geheimsten Beschlüsse der höchsten Büros werden in öffentlichen Lokalen ausposaunt. Unter vielen anderen ist hier ein Hotel Zum braunen Hirsch genannt. In der Weinstube dieses Hauses versammelt sich täglich ein wahres pële-mèle aus allen Ständen. Da wurde denn die Generaldisposition zur Verteilung der Armeen durch einen betrunkenen Stallknecht veröffentlicht! Die Beilage enthält sie ausführlich.
Etwas Zuverlässiges über die ersten Bewegungen der preußischen Heerhaufen zu sagen, ist rein unmöglich, denn das Conseil des Königs ist selbst noch nicht einig, und wenn mich nicht alles trügt, so wird es von partikularen Leidenschaften zerrissen. Dieses schließe ich aus mehreren Äußerungen des Ministers Haugwitz. Es ist auch nicht möglich, dass definitive Beschlüsse gefasst werden. Der Norddeutsche ist zu ängstlich für den Schein besorgt und Ew. Majestät haben noch nicht für gut befunden, auf die dreifache Ultimatsforderung des Herrn von Knobelsdorff entschieden zu antworten, d.h. in einer geschriebenen Note. Ich bewundere Ew. Majestät.
Eine Neuigkeit jedoch: Sie steht mit der Besorgnis um den Schein im lächerlichsten Einklang, kann ich Ihnen mitteilen. Man bildet sich ein, Sie würden nicht in dem nachteiligen Licht eines Aggressors erscheinen wollen! Sire, ich bin fest überzeugt, dass Ihnen dieser Wink lieber ist als eine Anweisung von 20.000 Franc, welche bereitzuhalten in tiefster Verehrung bittet
Ew. Majestät
dienstwilliger
Lempret.
Noch schrieb er die Notizen aus dem kleinen, schwarzen Buch ab, bemerkte noch mehreres dabei und schloss dann diesen Bericht an den Kaiser mit der Vermutung, dass wohl der 72-jährige Herzog von Braunschweig den Oberbefehl über die Armee, der tapfere, jedoch unbesonnene Prinz Louis den über die Avantgarde erhalten werde.
Manon hatte während des Schreibens ihre müden Augen, ihre fieberhaft glühende Stirn in die Kissen der Diwans gedrückt. Nachdem der Brief aufmerksam versiegelt worden, rief der Herr von Zweien seine vorgebliche Frau Gemahlin auf, übergab ihr den Brief mit einigem Zeremoniell und deutete ihr an, dass sie mit Tagesanbruch Berlin verlassen müsste. Manon gab mit einer kaum merklichen Neigung des Kopfes ihren Gehorsam zu erkennen und schien nicht sehr erfreut, da Herr von Zweien wieder neben ihr Platz zu nehmen Miene machte. Es schien ihm sehr viel an der Versicherung von Manons Treue zu liegen. Mindestens schien es, als ob er mehr Gewicht darauf legte, als ob es die schwärmerische Grille eines Eifersüchtigen heischte.
»Wir wurden unterbrochen«, begann er wieder, doch wollte ihm der zutrauliche Ton nicht recht gelingen. »Manon, ehe wir wieder scheiden, erfüllst du dein Versprechen.«
»Lass mich! Willst du Geld, nimm alles, was ich habe, nur verschone mich mit einem Ansinnen, dass mir die Sinne zu verwirren droht. Fühle, wie es kalt und klebrig auf meiner Stirn haftet. Ich bin nur eine Frau.«
»Aber eine starke Frau! Manon, nicht um sonst erfüllt Männerkühnheit deine Seele! Warum schützt du Schwäche vor? Ich will nicht denken, dass du mich nur kirren wolltest mit Schmeichelworten.«
Sie schrak auf, sie kannte den Mann, der zu ihr sprach und darum eilte sie, ihm den Verdacht zu nehmen: »So vernimm denn: Lache mich aus oder bedauere mich, als wäre ich eine Wahnwitzige, das gilt mir gleich. Doch hören musst du mich, und ich zweifle nicht, dass du mir einen Eid erlassen wirst, der, wenn ich ihn nur denke, schon das Blut in meinem Herzen erstarren macht. Lache nicht, ich sage dir, lache nicht. Wie leicht könntest du selbst es erfahren! Es sind nun acht Wochen, als der Prinz im Lurenburg einen glänzenden Ball gab, mir zur Freude einen glänzenden Ball gab und dem Kaiser zur Ehre. Es war nur ein Urteil über das ganze Arrangement, nämlich, dass es das herrlichste wäre, welches Paris jemals gesehen hatte. Wie könnte ich es dir auch nur in kaum zu erkennenden Zügen beschreiben? Es war ein Götterfest. Niemand vermutete in der Rochefort, mit welcher der Prinz ausschließlich tanzte, der er seine ganze Aufmerksamkeit schenkte, das ehemalige Blumenmädchen von St. Antoine. Der Kaiser selbst trat auf mich zu, da ich mir eben nach raschem Tanz Kühlung zufächelte. Es war, als wollte er mich mit den großen, dunkelglühenden Augen durchbohren. Ich glaubte, in seinem Blick das Zersetzende an Weiberschönheit zu finden und eben das reizte mich, dem großen Mann gegenüber mich zusammenzuraffen, damit er mich ob meines Geistes nicht gering achtete. ›Madame‹, sagte er, indem er ein ganzes Heer von Sarkasmen in das Lächeln um seinen Mund berief, ›wenn ich irgendeinen Menschen beneiden könnte, so wäre es der Prinz, und wenn ich einen Menschen, um etwas zu beneiden nicht zu stolz wäre, so würde ich den Prinzen um Sie beneiden.‹ Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagte, denn Ironie war nicht zu verkennen. Aber, dachte ich, fühlt etwa dieses Herz von Stein und er ist zu stolz, menschliches Empfinden einzugestehen? Eben wollte ich, von diesem Gesichtspunkt aus, ihm noch etwas sagen, da vertrieb ihn der Prinz, der mir von dem Augenblick an nicht mehr von der Seite wich. Seine Eifersucht war wach geworden.
Der Ball war nicht mehr so rauschend. Es hatten sich schon viele Gäste entfernt, als ich an des Prinzen Arm eines von den Nebenzimmern betrat. Das Halbdunkel hier war mir wohltuend, die Musik, der Tanz, Genuss aller Art hatten meine Lebensgeister in einer so großen Spannung erhalten, dass ich gern an des Prinzen Seite auf dem Sofa Ruhe suchte. Die Lakaien brachten feinen Likör, feurige Weine und Biskuit. Nur den dringenden Mahnungen des Prinzen, welcher heute zärtlicher als jemals war, gab ich nach und genoss von allem. Es war ein Tête-à-Tête, wie es nur unter Verliebten stattfinden kann. Bald lag mir der Prinz zu Füßen …«
»Dass ihn Gott verdamme!«
»Still, Freund«, fuhr sie fort. Sie warf die Blicke nach allen Winkeln, als ob Furcht sich ihrer bemeistert hätte. »Ich küsste ihn auf die Stirn, da tauchte es hinter ihm auf, als ob die Abendnebel sich zu abenteuerlichen Bildern gestalten. Ich konnte den Blick nicht mehr von der unheimlichen Stelle wenden und, ob es in mir war oder außer mir … aus dem Nebel drohte mir … meiner Mutter Totenantlitz!«
Mit den letzten Worten hatte sie, von Schauern geschüttelt, das Gesicht bedeckt. Der Spion aber grinste vor sich hin.:
»Nun bedarf es des Schwures nicht mehr.«
»Wohin? Wohin?«, rief sie, als das Geräusch des sich Entfernenden sie aufschreckte. Er aber bedeutete sie nur, dass er sie noch sehen würde und zog die Tür hinter sich zu.
Schreibe einen Kommentar