Felsenherz der Trapper – Teil 10.3
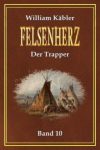 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 10
Das Geheimnis des Gambusinos
Drittes Kapitel
Das Geheimnis Sanchos
Felsenherz und Sancho lagerten eine Stunde später in einem Tal der Guadalupe-Berge, das sich nach Osten zu in die nahe Prärie öffnete.
Der Schwarze Panther war, nachdem man dieses Tal vorhin erreicht hatte, sofort zu Fuß wieder nach Westen aufgebrochen, um sich nach dem Flachboot umzusehen. Der tote Flussarm, in dem es lag, konnte nach Felsenherz’ Schätzung von hier keine halbe Meile entfernt sein.
Der blonde Trapper war soeben mit seiner Mahlzeit fertig geworden, wischte sein Jagdmesser ab und packte die Reste der Hirschkeule, von welcher der Gambusino nur wenig verzehrt hatte, wieder in frische Blätter ein und sagte dabei zu dem Gambusino: »Ihr seid so schweigsam, Sancho! Weshalb?«
Sie hatten kein Lagerfeuer angezündet. Das Regengewölk war verschwunden. Der Mond schien hell. Bald musste es auch Tag werden.
Der Gambusino, der seine kurze Pfeife rauchte, erwiderte zögernd: »Stimmt, Felsenherz! Mir geht jetzt so vieles durch den Kopf. Wathama, der Nachtfalke, hat mich an jenes Ereignis vor fünf Jahren erinnert, von dem ich Euch und dem Häuptling, um jetzt die Wahrheit zu sagen, nur die Hälfte erzählt habe. Ich tat es, weil Chokariga ein Roter ist und weil ich nicht allzu sehr auf die roten Schufte und ihre Hinterlist fluchen wollte, denn mir läuft ja stets die Galle über, sobald ich nur … Doch … die Gelegenheit ist günstig. Ich will Euch, Felsenherz, jetzt also alles mitteilen. Dann werdet Ihr noch besser begreifen, weshalb ich damals schwor, dass fünfzig Apachen mir für das geraubte Stück Kopfhaut, Skalp genannt, büßen sollten, weshalb ich schnell zu dem Namen Indsmenfresser kam. Ihr wisst, die Apachen hatten mich vor etwa fünf Jahren gefangen genommen und in ihre Dörfer geschleppt. Ich entfloh ihnen. Was Ihr aber noch nicht wisst, ist das eine, dass Wathamas Schwester Moutawa sich in mich verliebt hatte, mir die Flucht ermöglichte und mich begleitete.
Wir hatten die beiden besten Pferde mitgenommen. Es begann nun eine tolle Hetzjagd. Die Apachen, geführt von dem Oberhäuptling und Wathama, kamen uns erst nahe, als wir nach fünf Tagen hier die Guadalupe-Berge vor uns hatten, deren nordwestliche Teile am wildesten und schroffsten sind und an die Gila-Berge erinnern.
Moutawa, wohl die hübscheste Apachin, die es je gegeben hat, war guten Mutes, denn sie kannte in der Guadalupe-Felsenwildnis, wie sie betonte, ein Versteck, in dem niemand uns aufstöbern würde. Wo dieses Versteck lag und wie es beschaffen war, das sollte ich erst mit eigenen Augen sehen.
Am sechsten Abend unserer Flucht bogen wir in die Vorberge ein. Die Apachen waren uns schon verdammt nahe gerückt. Doch die Dunkelheit und der harte Felsboden, der keine Spuren annahm, gaben uns wieder einen mehrstündigen Vorsprung. Um Mitternacht aber erklärte mir Moutawa dann, dass sie sich verirrt hätte und jenes Tal nicht finden könne, wo wir vor den Verfolgern sicher gewesen wären.
Ihre Zuversicht und Hoffnungsfreudigkeit, uns bald geborgen zu sehen, verließen sie gänzlich. Sie wusste, dass ihr Bruder Wathama und die anderen Apachen sie töten würden, wenn sie sie einfingen. Sie fürchtete den Tod nicht, war nur deshalb so niedergeschlagen, weil sie mich in Gedanken bereits am Marterpfahl sah.
So irrten wir, unsere Pferde am Zügel führend durch Täler und Schluchten. Gegen Mitternacht bemerkten wir in der Ferne ein Lagerfeuer, schlichen näher und fanden so einen anderen Gambusino, der allein ein paar Fische briet, die er im nahen Pecos gefangen hatte.
Der Mann war mir kein Fremder. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht.
Die Trapper und Goldsucher haben ihn Einauge getauft, denn ihm ist mal das linke Auge von einem Apachen ausgeschossen worden. Dieser Einauge lagerte also hier, begrüßte mich als alten Bekannten und ließ sich meine Erlebnisse kurz erzählen.
Moutawa drängte dann, wir sollten weiter nach jenem Tal suchen, erklärte nun, ein Wasserfall stürze dort von der Südwand wohl zwanzig Meter tief hinab, sodass die Wassermassen unten vollständig zerstäubten und die Südecke des Tales wie mit einem feinen Sprühregen anfüllten.
Kaum hatte sie den Ort dergestalt näher beschrieben, als Einauge rief: ›Oh, das Tal kenne ich! Ich habe dort in dem Bach, der durch die Wasser des Falles gebildet wird, Goldkörner gefunden. Es liegt keine halbe Meile weiter stromaufwärts und vom Westufer eine knappe Viertelmeile entfernt.‹
Moutawa benahm sich jetzt recht seltsam, blickte Einauge forschend an und fragte hastig: ›Hat das Bleichgesicht dort wirklich Goldkörner gefunden?‹
Wir beiden Gambusinos wurden stutzig. Die Frage der Apachin hatte gerade so gelungen, als wusste sie, dass dort noch anderes Gold zu finden sei.
Doch Moutawa beantwortete unsere Fragen nicht, die diesen Punkt aufklären sollten, sondern verlangte, dass wir sogleich zum Regental aufbrächen.
Einauge ritt voran. Als wir uns dem Tal dann näherten und Moutawa die Gegend wiedererkannte, flüsterte sie mir plötzlich zu: ›Das andere Bleichgesicht darf uns nicht begleiten. Der Wasserfall verbirgt …‹
Weiter kam sie nicht, da Einauge im Galopp zurückjagte und uns zurief. ›Die Apachen sind da!‹
Er verschwand schnell in einer Schlucht. Wir konnten mit unseren abgetriebenen Mustangs ihm so schnell nicht folgen und erreichten nur noch einen einzelnen Bergkegel, ließen die Pferde im Stich und erkletterten ihn, um hier unser Lebens so teuer wie möglich zu verkaufen.
Ich will mich kürzer fassen, Felsenherz. Die Apachen umzingelten den Berg. Wathama näherte sich uns am Morgen als Unterhändler und versicherte, man würde unser Leben schonen, wenn ich ein Apache würde und Moutawa zur Frau nähme. Er rauchte mit mir dann feierlich die Friedenspfeife, und ahnungslos und vertrauensselig stiegen wir ins Tal hinab, wo die Apachen lagerten.
Kaum hatten die Apachen uns jedoch umringt, als Wathama seiner Schwester auch schon vor meinen Augen den Schädel spaltete. Dann packte man mich, und der Große Bär skalpierte mich bei lebendigem Leibe, ließ mir nachher aber Wundkräuter auflegen und mich für den Marterpfahl gesundpflegen. Wieder entkam ich den schurkischen Rothäuten, habe dann in drei Monaten nicht weniger als vierundvierzig von dem Gesindel einen nach dem anderen aus dem Hinterhalt weggeputzt, bis sie mich wieder beinahe erwischt hätten. Sie erschossen mir mein Pferd, dessen Schnelligkeit und Ausdauer mich bisher stets gerettet hatte. Da gab ich das abenteuerliche Leben auf und wurde Vaquero. Alles Weitere wisst Ihr, Felsenherz. Ich habe über Moutawas Tod bisher zu niemandem gesprochen. Das Andenken an sie ist mir heilig. Wenn ich Euch beiden also damals erzählte, ich hätte in dem Regental an dem Wasserfall eine Indianerin bemerkt, die mir eine Hand voll Goldkiesel zuwarf, so ist das lediglich eine Andeutung über die wahren Tatsachen gewesen. Dass der Wasserfall irgendein Geheimnis verbirgt, steht ja nach Moutawas unvollendet gebliebenem Satz außer Zweifel.«
Sancho brannte seine inzwischen ausgegangene Pfeife von Neuem an.
Felsenherz reichte ihm dann die Hand. »Euer Hass gegen die Apachen ist verständlich«, meinte er. »Die Rothäute haben Euch …«
Doch auch dieser Satz des Trappers sollte nicht beendet werden.
Hinter zwei nahen Felsen hervor schwirrten zwei Lassos durch die Luft, deren Schlingen den beiden Weißen gerade über den Kopf fielen und dann mit einem Ruck zugezogen wurden.
Fast gleichzeitig glitten etwa fünfzehn Navajo herbei, warfen sich auf die halb Wehrlosen und schlugen sie mit flachen Tomahawkhieben nieder.
Als der Schwarze Panther kaum zehn Minuten darauf sich dem Lagerplatz näherte, sah er in dem Halbdunkel der Mondnacht Felsenherz und Sancho scheinbar wie vordem an der Stelle sitzen, trat hinzu und wurde dann plötzlich von hinten durch einen Kolbenhieb niedergestreckt.
Die drei Gefährten erwachten sehr bald aus ihrer Betäubung, fanden sich auf ihre Pferde gefesselt wieder und wurden von fünfzehn berittenen Navajo bewacht, die ihre Gefangenen in die Prärie im Osten der Guadalupe-Berge brachten.
Der Morgen nahte bereits. Der Anführer der Navajo – ein bereits grauhaariger Roter mit einer doppelten Kette von Bärenzähnen um den Hals, hatte die Hufe der Pferde mit Decken umwickeln lassen und sorgte dafür, dass der Trupp eine recht schwache Fährte in dem taufrischen Präriegras zurückließ.
Erst mittags machten die Navajo am Rand der Llano Estacado in einer Schlucht halt.
Die Gefangenen wurden hier von ihren Pferden gehoben und an die nördliche Felswand, in deren Spalten die Rothäute Holzpfähle hineingetrieben hatten, aufrecht stehend mit ausgebreiteten Armen aufs Brutalste angebunden.


