Der Schwur – Zweiter Teil – Kapitel 4
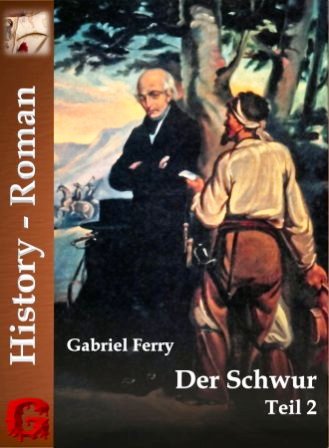 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Zweiter Teil
Ein moderner Odysseus
Kapitel 4
Die Goélette
Der Unglückliche, der dem Spiel der Winde und Wellen auf einem Balken oder den wenigen Trümmern seines zerschellten Schiffs anheimgegeben ist, befindet sich kaum in einer verzweifelteren Lage wie der Indianer und der Hauptmann Don Cornelio, die rittlings auf dem Kiel eines Kanus saßen, das jeder Windstoß von Neuem umwerfen konnte. Wenn der Wind noch stärker wurde oder die Wellen wuchsen, so war der Untergang der beiden Abenteurer unvermeidlich.
Eine schwache Hoffnung, dass der Indianer ihn auch aus dieser Gefahr retten würde, wie aus den vielen anderen, aus denen ihn die Unerschrockenheit Costals gezogen hatte, erhielt den ehemaligen Studenten der Gottesgelehrtheit noch aufrecht. Er prüfte mit gespannter Aufmerksamkeit die geringen Symptome, die ihm vielleicht das, was in der Seele Costals vorging, verraten hätten können.
Bis dahin ließ sich sein unzerstörbarer Gleichmut nicht verleugnen. Je mehr Zeit verging, ohne dass sie die übrigen Fahrzeuge erblickten, desto mehr verdüsterten sich die Züge Costals und Don Cornelio zitterte unwillkürlich.
»Nun, Costal?«, fragte er, um den Indianer dazu zu bringen, sein Schweigen zu brechen.
»Nun! Ich bin erstaunt, dass die Boote durch den Kanonenschuss nicht aufmerksam geworden sind. Don Galeana hat doch sonst nicht nötig, erst zwei hören zu müssen, um …«
Ein Windstoß entführte pfeifend das letzte Wort des Indianers.
Costal verfiel wieder in sein voriges Schweigen. In seiner Haltung drückte sich eine tiefe Unruhe aus. Fast schien es, als ob seine sonst so unbewegliche Maske Furcht verriete.
Lantejas wusste zu genau, dass die Gefahr eine schreckliche sein musste, wenn Costal nur die kleinste Bewegung sehen ließ. Aber noch immer rechnete er darauf, dass der Indianer irgendeine unvorhergesehene Hilfsquelle finden werde.
Er glaubte sich schon halb gerettet, als er den Indianer zu sich sagen hörte: »Señor Don Cornelio, was würdet Ihr geben, wenn Ihr Euch noch in Eurer Hängematte gebettet fändet, mit einem Geflecht von Klapperschlangen und den Tigern als Himmel Eures Bettes?«
Costal scherzte, das war ein gutes Zeichen.
Bald verfiel er aber in einen unruhigen Ton: »Sollten unsere Gefährten zufällig wieder zurückgerudert sein?«
In so einer entsetzlichen Lage, wie die der beiden Schiffbrüchigen, wird der geringste Argwohn zur Gewissheit, und der Hauptmann bildete sich nun steif und fest ein, dass seine Gefährten zu der Stelle der Küste zurückgekehrt wären, von wo sie vor zwei Stunden ausliefen.
Eine solche Furcht war ganz unsinnig. Es war viel natürlicher anzunehmen, dass die Fahrzeuge, den Bericht des Kanus erwartend, an derselben Stelle liegen geblieben waren, und zwar um so mehr jetzt, da in der Mannschaft ohne Zweifel bei dem Schuss, der ihr nicht entgangen sein konnte, ein gewisser Argwohn entstanden sein musste. Diese letzte Wahrscheinlichkeit drängte sich auch Costal mit Gewissheit auf.
»Hört, Señor Don Cornelio Lantejas.«
Es ist hierbei zu erwähnen, dass Don Cornelio, seit dem er unter dem Namen Lantejas in die Armeeliste eingetragen war, diesen Namen immer verhängnisvoll für sich fand. Dieses Mal schien er ihm aber doppelt unheilverkündend.
»Hört! Ich weiß, dass der Tod Euch nicht erschreckt. Ich kann es Euch jetzt nicht mehr verheimlichen, dass uns die Wellen in einer Stunde heruntergerissen haben werden, wenn wir abwarten, falls sie noch höher gehen.«
»Was sollen wir tun?«, schrie der Hauptmann verzweifelt.
»Wir haben unter zwei Dingen die Wahl«, entgegnete Costal. »Unsere Gefährten erwarten uns entweder oder sie steuern zur Insel. Anzunehmen, sie seien zurückgekehrt, ist abgeschmackt, denn wenn man von seinem General den Auftrag erhalten hat, irgendeinen Punkt anzugreifen, kehrt man nicht zurück, ohne es versucht zu haben. Da es mir nun eine Kleinigkeit ist, bis zu den Fahrzeugen zu schwimmen …«
»Bis zu den Fahrzeugen zu schwimmen! Ihr denkt daran?«
»Und warum nicht?«
»Und unsere, vor unseren Augen verschlungenen Gefährten?«
Ein Blitz, der in demselben Augenblick die Dunkelheit erhellte, zeigte den Ausdruck stolzer Verachtung, der auf dem Gesicht Costals lag.
»Habe ich Euch schon gesagt, dass ich allein vielleicht ohne Furcht unter den Haien herumschwimmen kann? Ich habe es hundertmal aus Prahlerei getan. Ich werde es auch heute tun, um unser Leben zu retten.«
Der Gedanke, allein zu bleiben, erschreckte den Hauptmann. Der eines nahen und unvermeidlichen Todes zu zweien schien ihm weniger furchtbar. Er zögerte einen Augenblick, zu antworten, und Costal nahm dieses Schweigen als Einwilligung an.
»Sobald ich an Bord eines der Fahrzeuge gekommen sein werde«, fuhr er fort, »werde ich eine der Raketen, die wir zum Signal mitgenommen haben, aufsteigen lassen. Dann wisst Ihr, dass Ihr zu hoffen habt, und ruft sofort aus Leibeskräften.«
Don Cornelio konnte ihm kein Wort darauf erwidern, denn der unerschrockene Taucher sprang plötzlich kopfüber in das Wasser.
Es war, als ob die wilden Bewohner der salzigen Fluten eine höher stehende Macht erkannt hätten, denn der Hauptmann sah sie vor dem fliehen, der ihnen trotzte. Eine ziemliche Strecke vom Kanu entfernt tauchte Costal wieder auf, dann aber verschwand er sogleich wieder hinter dem dunklen Kamm einer Woge. Manchmal schien es dem Hauptmann, als ob der Wind ihm entfernte Worte der Ermutigung zutrüge. Bald aber hörte er nichts weiter als das ferne Gebrause der Windstöße und das dumpfe Anprallen der Wogen an die zitternden Planken des Kanus.
Obgleich wohl die Haie in etwa gesättigt waren, so ist es doch sehr selten, dass ihre angeborene Gefräßigkeit sich gänzlich legt. Zwei dieser Tiger des Ozeans, die noch tausendmal schlimmer sind als diejenigen, welche die Savanne nährt, schwammen in derselben Richtung wie der Indianer, der eine zur Rechten, der andere zur Linken ungefähr zwanzig Fuß entfernt. So schrecklich nun auch eine solche Nachbarschaft sein mag, so schenkte doch der Indianer, abgestumpft durch die Gewohnheit, die er sich bei den Perlenbänken angeeignet hatte, getragen durch seinen unerschütterlichen Glauben an den Fatalismus, und von der Besorgnis, die in ihm notwendigerweise auftauchen musste, die Fahrzeuge auf dem unendlichen Meer und in der tiefen Finsternis nicht wiederzufinden, zu sehr in Anspruch genommen, seinen gefährlichen Reisegefährten sehr geringe Aufmerksamkeit.
Costal, der für jeden Fall sein Messer zwischen den Zähnen hielt, wandte sich doch von Zeit zu Zeit, zwar mehr aus Vorsicht als aus Furcht, nach seinen Verfolgern um. Aber jedes Mal schienen ihm seine Feinde näher gekommen zu sein, sodass sie zuletzt nur noch zehn Fuß von ihm entfernt waren.
Noch verursachte ihm die Nähe der Haifische keine Furcht, aber die ungeheure Einsamkeit des Ozeans fing an, ihn zu erschrecken.
So kühn und unternehmend auch ein Mann sein mag, so kann es doch Momente geben, in denen sein Mut auf Augenblicke sinkt, wenn man der Gnade der Wogen eines endlosen Meeres anheimgegeben ist, von gefräßigen Haien mitten in einer dunklen Nacht begleitet wird und einen so unbedeutenden Punkt wie die Nussschalen seiner Gefährten aufsucht.
Mag ein Schwimmer noch so kräftig sein, so wird sein Atem endlich einmal von der langen und anstrengenden Arbeit erschöpft werden, namentlich, wenn ein zwischen den Zähnen gehaltenes Messer den Schwimmer behindert, den Mund zu öffnen, damit er mit langen Zügen, wie es seine Lungen erfordern, atmen kann. Und doch hätte Costal um keinen Preis der Welt seine Waffe, seinen einzigen Schutz gegen die Haifische im Falle eines Angriffs den Wellen überlassen.
Seit einigen Augenblicken fühlte Costal sein Herz viel schneller pochen. Er schrieb diesen Umstand den Anstrengungen zu, die er machte, und nahm sein Messer in die eine Hand.
Das Schlagen seines Herzens verminderte sich um nichts und Costal musste sich gestehen, dass er sich fürchtete. Da er nun nur mit einer Hand schwimmen konnte, musste er mit dieser doppelte Anstrengungen machen.
Übrigens schien auch die Vorsicht, das Messer für jeden Fall bereitzuhaben, nicht ganz unnütz. Die beiden Haifische fingen an, sich in schrägen Linien der Art zu bewegen, dass alle drei, die Haie und Costal endlich an einem Punkt zusammentreffen mussten.
Bei dieser neuen Wendung, welche die schweigende und beharrliche Jagd nahm, wandte sich der Indianer plötzlich nach rechts.
Die Haifische änderten ihre Richtung ebenfalls und folgten ihm als Bedeckung.
Lange und schreckliche Augenblicke verrannen auf seinem einsamen Kurs. Er hatte sein Leben und seine Rettung gerade seinen furchtbaren und gierigen Feinden zu verdanken, denn die Richtung, die er gezwungenerweise nach rechts hatte einschlagen müssen, führte zu den Fahrzeugen seiner Gefährten.
Ein Schrei der Freude entfuhr seiner keuchenden Brust beim Anblick der drei Barken, die plötzlich auf den Wellen herumtanzend vor ihm erschienen.
Der Indianer stieß einen zweiten Schrei aus und ein Schrei antwortete ihm. Nun raffte er seine sinkenden Kräfte zusammen, um die Barken zu erreichen, denn es war kein Zweifel mehr, dass man ihn gehört hatte. Nur sah man ihn noch nicht.
Unglücklicherweise bewachten die beiden Haifische, der eine zur Rechten, der andere zur Linken, den schmalen Weg, den er nehmen musste, um das nächste der drei Fahrzeuge zu erreichen, und seine Kräfte waren schon zu erschöpft, um ihm noch zu erlauben, einen Umweg machen zu können. Er schwamm daher den geraden Weg zu den Schiffen.
Mit seinem Messer in der Faust, bereit es dem ersten Ungeheuer, das seinen Weg versperrte, in den Rachen zu stoßen, schwamm Costal klopfenden Herzens, bald seine gefräßigen Feinde durch Spritzen, bald durch seine Stimme erschreckend, wie ein Schiff, das den scharfen Klippen zu entrinnen sucht, an ihnen hin. Glanzlose, meergrüne Augen starrten ihn mit verglasten Blicken an, dann entfernten sich die beiden schwarzen Kolosse.
Costal hatte nicht mehr die Kraft, sich an das Fahrzeug zu klammern. Als man ihn hineinzog, war er ohnmächtig.
Seine Gegenwart verkündete die traurige Geschichte des Kanus.
»Verschwenden wir keine Zeit damit, das Kanu zu suchen«, sagte Galeana. »Steuern wir geraden Wegs zur Insel.«
Dann fügte er, seinen Hut abnehmend, hinzu: »Lasst uns für die Seelen unserer unglücklichen Kameraden, besonders für den Hauptmann Lantejas ein kurzes Gebet sprechen. Wir verlieren an ihm einen tapferen Offizier.«
Nach dieser kurzen Leichenrede für Don Cornelio, der ihrer immer noch harrte, setzten die Fahrzeuge sich ruhig in Bewegung.
Der unglückliche Offizier starrte in der Zeit, in welcher Costal zu ihren Kameraden schwamm, mitten unter den Gefahren, die ihn umgaben, den Ozean an, der so oft ihn kein Blitz beleuchtete, schwarz wie der Tod und flammend wie ein Glühofen war, wenn die Wolken sich in Feuerfurchen spalteten. Er hörte den Wind, der pfeifend die Wogen peitschte, er vernahm das Tosen des Meeres, das ihm wie das Schnauben eines gigantischen wilden Rosses vorkam, welches sich seines Reiters zu entledigen sucht.
Glücklicherweise war der Sturm noch in seinem ersten Stadium, und Lantejas konnte sich noch auf seinem gebrechlichen Fahrzeug halten. Er rief zum wiederholten Mal, der Wind trieb ihm seine ohnmächtigen Hilferufe mit dem Schaum der Wellen zurück in das Gesicht.
Keine Hilfe kam. Costal war ohne Zweifel entweder ertrunken oder von den Haien verschlungen. Der unglückliche Hauptmann dachte ernstlich daran, dass ihm weiter nichts übrig bleiben würde, als sich mit dem Tod vertraut zu machen.
Plötzlich schien es ihm beim Schein eines Blitzes, als hätte er auf dem Gipfel einer Welle die lange Form einer Barke und menschliche Gestalten erblickt. Er zitterte vor Erwartung. Als aber der Blitz erloschen war, sah er weiter nichts, als schwarze Wogen da tanzen, wo seine Fantasie ihm die Vision hingezaubert hatte.
Dennoch rief er. Der raue Ton, der sich seiner Brust entwand, verlor sich im Sturm. Er glaubte keiner Täuschung zu unterliegen und nahm an, dass nur die Wogen, die der Sturm aufjagte, es ihm unmöglich machte, seine Gefährten zu sehen und ihn gleicherweise ihren Blicken entzogen.
Bald jedoch löste sich seine Überzeugung in Zweifel auf, der Hoffnungsstrahl, der ihn auf Augenblicke belebt hatte, erlosch und er erkannte von Neuem die Trostlosigkeit seiner Lage.
Plötzlich bemerkte er in dem Augenblick, als er auf dem Gipfel einer Welle trieb und sein Gesichtskreis sich für einen Moment erweitert hatte, bei dem Schein eines zweiten Blitzes dieselbe Barke, dieselben Gestalten noch deutlicher als das erste Mal, aber in entgegengesetzter Richtung. Man war an ihm vorübergefahren, ohne ihn zu sehen. Die Woge senkte sich wieder mit ihm, er verlor seine Retter aus dem Gesicht, die ihn da suchten, wo er nicht war. Es fehlte wenig und er hätte sich in einem Anfall wahnsinniger Verzweiflung, die sich seiner bemächtigte, von einer der Wogen, deren trauriger Spielball er war, wegreißen lassen.
Der Unglückliche fühlte sich ohne Rettung verloren. Fast hätte er, vom Schwindel vor dem Abgrund, in den er gestürzt wurde, erfasst, bis zum Wahnsinn durch das dumpfe Gebrüll des Sturms aufgeregt, den Kampf gegen die furchtbaren Elemente aufgegeben, als er plötzlich in ganz geringer Entfernung eine lebhafte Gloriole und die Bogenlinie eines funkelnden Feuerkörpers am dunklen Himmel aufsteigen sah. Dies war die so ersehnte Rakete. Jetzt sammelte Don Cornelio den Rest seiner Kräfte. Er stieß einen Schrei aus, in dem sich Hoffnung und Verzweiflung mischten und der, mit übermenschlicher Kraft in das Tosen der Elemente geschleudert, dieses noch durchdrang. Nach Verlauf des Augenblicks, in dem er den letzten Lebensfunken konzentrierte, um eine Antwort auf seinen Hilferuf zu vernehmen, hörte er eine andere Stimme gegen das Geheul des Windes ankämpfen. Es war die des Indianers.
Cornelio schrie von Neuem ohne Unterlass, ohne Aufhören, bis seine Kehle keinen Ton mehr hervorbringen konnte. Auf jeden Ruf vernahm er wie ein schwaches Echo entfernten schrillen Krach und doch zeigte ihm das Licht der Blitze nichts, als einen ungeheuren Raum, öde, schwarz und leer.
Endlich gelangte eine Barke, auf den Wellen hüpfend, zu ihm. Die Hände Costals und Galeanas streckten sich aus und ergriffen die seinen. Er fühlte sich von dem Kanu in die Höhe gehoben. Es war die höchste Zeit – wie Costal, fiel auch er ohnmächtig auf den Boden der Barke nieder.
Wie seine Rettung erfolgte, errät der Leser leicht. In dem Augenblick, als die Barke an Don Cornelio vorübergesegelt war, ohne ihn zu sehen, ohne seine Hilferufe zu vernehmen, war Costal wieder zu sich gekommen und hatte mit wenigen Worten die Katastrophe erzählt, der die Bemannung des Kanus zum Opfer gefallen war. Nun beeilte man sich, das verabredete Signal zu geben, indem man sich beim Schein der Blitze nach der Lage der Insel, der Goélette und des Schlosses zu orientieren versuchte. Costal, mit dem doppelten Scharfsinn eines Seemannes und Indianers begabt, hatte den Ort ungefähr wiedererkannt, wo er seinen unglücklichen Gefährten verlassen hatte. Einen Augenblick später erreichte der erste Hilferuf Lantejas sein aufmerksam lauschendes Ohr und bestätigte seine Vermutung. Der Hauptmann war gerettet.
Ungeachtet des von der Goélette gegebenen Zeichens zur Wachsamkeit konnten doch die drei Fahrzeuge leicht an der der Goélette entgegengesetzten Seite der Insel landen, da die stürmische Nacht jede Wache unnötig zu machen schien.
Lantejas lag noch immer in Ohnmacht und befand sich, als er zu sich kam, schon auf der Insel la Roqueta, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen war. Das Geräusch der Bäume, die mit ihren Gipfeln, durch die Wut des Orkans, der jetzt die höchste Stufe erreicht hatte, gebeugt, zusammenschlugen, das Rollen des Donners, der die Insel in ihren Grundfesten zu erschüttern schien, alles dies schien Don Cornelio bei seinem Erwachen die schönste Melodie, die er jemals gehört hatte. Bevor er Costal, der neben ihm schlief, weckte, prüfte er die ihn umgebenden Dinge. In kleine Gruppen zerstreut standen die Leute der Expedition, die Waffen im Arm, schweigend, wie in einem Hinterhalt.
»Wo sind wir?«, fragte er Costal, indem er ihn munter rüttelte.
»Auf der Insel la Roqueta«, erwiderte der Indianer.
»Wie haben wir hierher kommen können?«
»Auf die einfachste Weise. Wer würde wohl glauben, dass sechzig Menschen bei einem solchen Wetter sich auf das Meer wagen werden? Gewiss niemand! Deshalb hat auch keiner der Spanier an uns gedacht und wir sind ohne Hindernis gelandet.«
»Worauf wartet Galeana noch, um anzugreifen?«
»Dass wir wissen, wo wir uns befinden, und wo der Feind ist. Die Nacht ist so finster, wie das Rohr einer Kanone. Meer und Himmel sind in Aufruhr.«
Das Unwetter bildete übrigens die einzige Sicherheit der Mexikaner bis zum Anbruch des Tages. Ein von den Spaniern gegen sie ausgeführter Angriff hätte bei ihrer Unkenntnis des Terrains und der Stärke der Garnison nur für sie verderbenbringend sein können. Dem Unwetter hatten sie es zu danken, dass man ihre Gegenwart nicht einmal ahnte.
Es war ungefähr vier Uhr morgens, als Costal dem Hauptmann diese Nachrichten gab. Der Sturm fuhr fort zu wüten und das Meer, das sich zischend gegen das Ufer brach, drohte die Ankertaue der Fahrzeuge zu zerreißen, welche die einzige Hoffnung im Fall einer Niederlage waren. Don Cornelio warf erstaunte Blicke auf diesen Ozean, der ihn einige Stunden vorher fast verschlungen hätte. Er sah einen Mann zum Ufer hinabsteigen und glaubte, er ginge in der Absicht hinunter, um die Knoten fester zu schürzen. Und in der Tat, der Mann bückte sich auch, aber Lantejas glaubte nach Verlauf einer Minute das Knirschen einer Messerklinge auf einem Gegenstand, den man durchzuschneiden versuchte, zu vernehmen.
»Was macht der da?«, fragte der Hauptmann Costal, indem er ihm den Mann zeigte, der mit seiner geheimnisvollen Arbeit beschäftigt war.
»Alle Teufel! Er schneidet die Ankertaue ab!«, erwiderte der Indianer.
Sogleich stürzte er sich, vom Lantejas gefolgt, auf ihn und erkannte beim bleichen Schein der weißen Wogen den Anführer der Expedition selbst, Don Hermenegildo Galeana.
»Ah, Ihr seid es, Hauptmann!«, sagte Galeana. »Kommt und helft mir die Taue abschneiden, die fest wie Eisenketten sind.«
»Die Taue abschneiden? Wenn wir nun aber genötigt sind, uns vor überlegenen Streitkräften zurückzuziehen?«
»Das ist es ja gerade, was ich vermeiden will«, erwiderte Galeana lächelnd. »Man schlägt sich schlecht, wenn man eine Aussicht auf Rettung hat, und ich will, dass meine Leute sich gut schlagen.«
Gegen diesen Befehl des ritterlichen Galeana ließ sich nichts einwenden und alle drei hatten bald die Knoten der Taue entweder gelöst oder durchschnitten.
»So, das wäre gemacht«, fuhr Galeana fort. »Jetzt brauchen wir nur noch die Raketen aus den Fahrzeugen zu nehmen.«
Die beiden Männer gehorchten und ließen dann die Taue los. Bald hatten die Wogen im Abprallen von der Küste die drei Fahrzeuge ins Meer getragen.
»Jetzt legt Euch schlafen, bis ich Euch wecken lassen werde«, sagte Galeana. »Ihr werdet des Schlummers benötigt sein, Hauptmann. Costal wird unterdessen das Innere der Insel auskundschaften, um zu sehen, wo der Feind ist. Bei den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne muss Insel und Goélette unser sein.«
Mit diesen Worten entfernte sich Galeana, sich fester in seinen Mantel hüllend. Costal und der Hauptmann nahmen ihren vorigen Platz wieder ein, ohne sich einander ihre Gedanken mitzuteilen. Nachdem der Indianer die wenigen geretteten Kleidungsstücke abgelegt hatte, entfernte er sich auch seinerseits und schlich durch das Gestrüpp am Ufer hin, wie der Jaguar im Schilf, wenn er den Alligator am Rand der Lagune überraschen will.
Was Cornelio betraf, so konnte er kein Auge schließen. Obwohl er schon in etwa gegen die Gefahren der Schlachten durch die Gewohnheit länger als einem Jahr abgestumpft war, so hielt ihn dennoch der Gedanke an die Notwendigkeit, worin Galeana die Soldaten versetzt hatte, zu siegen oder zu sterben, wach.
Die Zeit verging mit Betrachtungen über die Sonderbarkeit des Schicksals, die ihn wider seinen Willen in die gefährliche Soldatenlaufbahn geschleudert hatte. Ihn beschäftigte nur ein Wunsch, die Festung Acapulco so bald wie möglich genommen zu sehen und seinen von Morelos versprochenen Urlaub zu unterzeichnen. Nach Verlauf von etwa einer Stunde war der Indianer zurück und teilte ihm das Wesentliche seiner Kundschaft mit, die er Galeana ausführlich dargelegt hatte.
Nach den Mitteilungen des Indianers befand sich die spanische Garnison, die er auf ungefähr zweihundert Mann schätzte, in einer Art Erdschanze auf der Südseite der Insel, einen Kanonenschuss weit von dem mexikanischen Lager.
Zwei Feldstücke waren aufgepflanzt und in einer kleinen Bucht lag die Goélette, deren Feuer den Bug des Kanus zerschmettert hatte, in nicht allzu großer Entfernung von der Schanze vor Anker.
Nun wusste Galeana, wo der Feind war. Er kannte seine Stärke und seine Verteidigungsmittel. Die Dämmerung brach an. Don Hermenegildo stellte schweigend seine Mannschaft gliederweise auf eine kleine Anhöhe, die sich dicht vor ihnen befand. Er ließ sich die Raketen bringen. Dann fügte er mit leiser Stimme hinzu: »Ein Punkt, den wir angreifen, ist schon erobert. Wir sind im Begriff, den Feind anzugreifen, wir haben auf der Insel festen Fuß gefasst. Jetzt können wir dem General ohne Furcht, ihn zu täuschen, anzeigen, dass die Insel genommen und der Feind zerstreut ist.
Ohne eine Antwort abzuwarten, näherte Galeana seine brennende Zigarre dem ersten Raketenstock. Die Rakete erhob sich pfeifend und beschrieb am Himmel eine Ellipse in grellem Rot, eine zweite folgte ihr, einen weißlichen Streifen ziehend, und eine dritte stieg in blendendem Grün auf.
»Rot, weiß und grün sind die mexikanischen Farben«, sagte Galeana. »Es ist dies das mit unserem geliebten General verabredete Signal, um ihm die Eroberung der Insel anzuzeigen. Jetzt ist man im Lager unterrichtet und wir können uns nicht zu Lügnern machen. Vorwärts!«
Mit einem Satz war er an der Spitze seiner Leute, die, von Costal geführt, im Sturmschritt vorwärts eilten. Als sie sich dem kleinen Fort näherten, in dem die spanische Besatzung der Insel einquartiert war, drang ein Angstruf zu ihnen. Sie blieben nicht lange über die Ursache desselben in Ungewissheit. Durch eine Baumallee hindurch erblickten sie die Goélette in geringer Entfernung von den Felsen rollend auf und nieder schwankend. Die Matrosen waren vergeblich bemüht, sie vor einem unentrinnbaren Untergang zu bewahren. Die Ankertaue waren zerrissen und der Sturm trieb das Schiff unaufhaltsam auf eine Reihe scharfer Klippen zu.
»Beim Blut Christi!«, rief Galeana. »Ich rechnete auf die Goélette und jetzt werden wir nur Trümmer bekommen.«
Dieser Unfall wurde schnell im spanischen Lager bekannt und verbreitete eine Verwirrung, die noch durch Galeanas schreckliches Kriegsgeschrei vermehrt wurde, dem das rasende Heulen seiner Soldaten folgte, deren geringe Anzahl die Dunkelheit den Spaniern verbarg. Ihr stürmischer Angriff, ihr Kriegsgeschrei, vereinigt mit den Donnerschlägen und den Hilferufen der Matrosen der Goélette, trieb die Verwirrung der Spanier auf die Spitze.
Die Angreifer schlugen die Tore der Festung mit Äxten ein. Fast ohne einen Widerstand zu versuchen, ergab sich ein Teil der Garnison nach einem kurzen Gefecht Mann gegen Mann auf Gnade und Ungnade und ein anderer ergriff die Flucht.
Kaum war der letzte Flintenschuss verhallt, als auch die Goélette mit voller Wucht auf einen Felsen stieß und sich auf die Seite legte.
Die Sieger hatten weiter nichts zu tun, als sich der Mannschaft der Guadeloupe, so hieß die Goélette, in dem Maß, wie sie das Ufer erreichte, zu versichern.
Als der letzte Matrose der Goélette das Ufer der Insel betreten hatte, wobei es völlig Tag geworden war, signalisierte man im Fort ein Segel und kurze Zeit nachher konnte man auch vom Strand aus ein Schiff bemerken, das mit der Schnelligkeit des Blitzes fortschoss.
Der Orkan schien es zum Land treiben zu wollen, und es kam auch wirklich so nahe, dass man vom Strand aus die Bemannung und die Offiziere auf dem Verdeck unterscheiden konnte.
Costal, Clara und der Hauptmann Don Cornelio beobachteten, wie die Übrigen, die Manöver der Brigg, als das scharfe Auge des Indianers sich plötzlich mit verdoppelter Aufmerksamkeit zu einem Offizier wandte, der sich mit dem Ausdruck tiefster Melancholie an einen Balken gelehnt hatte.
Sein hoher, schöner Wuchs zeigte seine Kraft an. Sein schwarzes Haar flatterte, dem Spiel der Winde überlassen, um sein entblößtes Haupt, und er schien sich wenig um die Gefahren zu kümmern, denen das Schiff entgegenging.
»Erkennt Ihr diesen Offizier?«, fragte Costal, ihn mit dem Finger Clara und Don Cornelio zeigend.
»Ich kann seine Züge nicht deutlich unterscheiden«, entgegnete Lantejas.
»Wir alle drei haben ihn einst als Hauptmann der Königin-Dragoner gekannt. Heute ist er der Oberst Tres-Villas.«
»Ist das derselbe, der in der Schlacht bei Calderon vor Ort war, den Generalissimus Hidalgo gefangen zu nehmen?«, fragte ein Soldat.
»Derselbe«, erwiderte Costal.
»Ist das der Offizier, der den Kopf des Antonio Valdes an die Tür seiner Hacienda genagelt hat?«, fügte ein Freiwilliger aus der Provinz Oajaca hinzu.
»Derselbe«, erwiderte Costal.
»Hat er nicht auch nach der Eroberung der Stadt Aguas-Calientes vierhundert gefangenen Frauen die Haare abschneiden lassen?«, fragte ein Dritter.
»Man sagt, dass er seine Gründe dazu hatte«, erwiderte Costal.
»Nun, wenn er hier strandet, ist sein Schicksal entschieden.«
In dem Augenblick, als der Soldat endete, wurde am Bugspriet der Brigg ein Segel gerefft und das Schiff, das nun dem Steuer gehorchte, schoss an der gefährlichen Stelle vorüber, in die hohe See hinaus.
Costal hatte sich nicht getäuscht. Der Offizier war wirklich Don Rafael Tres-Villas, der nach seiner Abwesenheit von einem Jahr seine unheilbare Melancholie zu den Küsten des Golfes von Tehuantepec trug.


