Der Schwur – Zweiter Teil – Kapitel 9
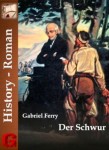 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Zweiter Teil
Ein moderner Odysseus
Kapitel 9
Valerio Trujano
Der ehemalige Maultiertreiber, der sich, wie wir gesehen haben, den Wechselfällen des Krieges erst aussetzen wollte, bevor er gewissenhaft seine Schulden bezahlt hatte, der jetzige Oberst Don Valerio Trujano, war ein Guerillero, wie es deren so viele gab.
Der Ruf, den er aber dessen ungeachtet in den engen Grenzen seiner Sphäre genoss, war ein Gegenstand fortwährender Unruhe für die königlichen Häupter der Stadt Oajaca. Sie glaubten den rechten Moment erfasst zu haben, um den furchtbaren Feind zu vernichten, der sich der Unterstützung zweier seiner Genossen, des Don Miguel und Don Nicolas Bravo, die wie er Guerilleros waren, beraubt sah, da sie Morelos nach Cuautla zurückberufen hatte.
So groß war die Bedeutsamkeit, die man der Kapitulation des religiös schwärmerischen Insurgenten beilegte, dass das Gouvernement gegen ihn fast die ganze militärische Gewalt der Provinz aufbot. Trujano befand sich zu der Zeit gerade in Huajapam, derselben Gemeinde, in dem wir schon seine Bekanntschaft gemacht haben, und in dem ihm Gelegenheit geboten wurde, sich durch die famose Verteidigung dieser kleinen, von allen Seiten offenen Stadt unsterblich zu machen. Zum Glück für ihn war die Stadt in Überfluss mit Lebensmitteln versehen.
Der Widerstand konnte nur dadurch möglich gemacht werden, dass die gewöhnliche Regelmäßigkeit geändert wurde, und dies tat Trujano.
Er begann damit, alle vorhandenen Lebensmittel in ein Lagerhaus bringen zu lassen, deren Aushändigung an jeden Soldaten und an jede Familie er sich jeden Morgen vorbehielt. Dann führte er eine strenge, fast klösterliche Selbstbeherrschung ein, die er vom ersten bis zum letzten Tag, mitten in den blutigen Entfaltungen einer hundert-vierzehntägigen Belagerung durch die Leistung seines Willens, durch seine unwiderstehliche Herrschaft über die Gemüter der Soldaten und Bürger ohne die geringste Beeinträchtigung aufrecht zu erhalten wusste.
Diese Zeit hatte er wie in einem Kloster eingeteilt. Die Gebete nahmen den größten Teil der Stunden ein, welche die militärischen Obliegenheiten und die Angriffe der Feinde ihnen übrig ließen. Diese Gebete wurden gemeinschaftlich abgehalten, und in diesem von aller Verbindung mit der Außenwelt abgeschnittenen Dorf, mitten in einer mit den Freuden des Lebens unbekannten Bevölkerung, die immer dem Tod ins Auge sah, mit einer Inbrunst dargebracht, die man so häufig bei den Matrosen findet, die die Barmherzigkeit des Weltenlenkers als ihre einzige Zuflucht gegen den Zorn der Elemente anrufen.
Nur diesen wohl sonderbaren, weisen Maßregeln war es zuzuschreiben, dass sich noch keine Spur von Entmutigung in die Herzen der unaufhörlich auf diese Weise Beschäftigten eingeschlichen hatte. Als die Lebensmittel spärlicher wurden, konnte kein Späherblick die leeren Räume der Magazine sondieren, keine indiskrete Gosche eine nahe bevorstehende Hungersnot prophezeien. Es war augenscheinlich, dass die spanische Belagerung nur zwei Ausgänge nehmen konnte, entweder die Belagerten bis auf den letzten Mann niederzumachen oder die Belagerung aufzuheben.
Dieser Zustand der Dinge dauerte hundert und mehr Tage an, und während dieses langen Zeitraums war nur ein einziger Versuch, Hilfe zu bringen, vom Colonel Sanchez und dem Patre Tapia unternommen worden. Allein er war misslungen, doch hatte die Standhaftigkeit Trujanos ihr Ende noch nicht erreicht. Die Entmutigung war allein auf Seiten der Spanier entstanden.
Von den Belagerten stand jeder unter dem grenzenlosen Einfluss dieses außerordentlichen Mannes, in dem die tapfersten Züge vereinigt waren, sogar solche, die sich sonst gegenseitig ausschließen. Nie schadete die Begeisterung seines Herzens der Raffinesse seiner Pläne und nie suchte er sie ans Licht zu ziehen, bis die Zeit, sie anzuwenden, gekommen war. Tapfer bis zur Kühnheit war er nichts desto weniger geschickt, alle Optionen des Kampfes zu berechnen. Sein offenes und einnehmendes Antlitz empfahl Anteilnahme und zwang jedermann, ihm sein Geheimnis anzuvertrauen, während niemand das seine erforschen konnte. Seine Leutseligkeit und seine Sanftmut gegen die Soldaten, die weit davon entfernt waren, in Schwäche auszuarten, machten ihn gleich sehr beliebt wie gefürchtet, eine unendliche Magie umgab seine ganze Person und verscheuchte schon die bloßen Erwägungen, ihm ungehorsam zu sein.
Wenn man bedenkt, dass im Jahr 1812 die Spanier noch Machthaber aller Hilfsquellen der Verwaltung, der Posten, Boten und der Verständigungswege waren, dass dagegen die Insurrektion isoliert, von allen Seiten umstellt dastand, so wird es nicht mehr auffällig erscheinen, dass zu derselben Zeit, wo Trujano in Huajapam eingeschlossen war, Morelos, der zwei oder drei Tagesreisen von dort in Cuautla belagert wurde, die Position des früheren Maultiertreibers unbekannt war. Schon seit einem Monat war Morelos, der sich nach der Räumung Cuautlas nach Isucar zurückgezogen hatte, nicht genauer vom Los der Belagerten unterrichtet als zuvor. Zum Glück kannte Trujano den Rückzugsort Morelos’ und er beschloss, ihm einen Boten zu schicken und ihn um Hilfe zu bitten.
Das Unternehmen war durch die Einschließung der Stadt fast unausführbar. Um das Gelingen zu sichern, ordnete Trujano eine neuntägige Messe an, den Schutz des Himmels zu erflehen.
Zwei Tage zuvor, ehe das Kriegskomitee abgehalten wurde, dessen wir am Ende des vorigen Kapitels gedachten, war diese neuntägige Andacht abgelaufen. Es war bereits tiefe Nacht. Die Bevölkerung Huajapams fand sich zur Stunde des Gebets auf dem von Fackeln erleuchteten Marktplatz zusammen. Eine Kirche, deren Gewölbe die Bomben zerstört hatten, und einige in Schutt liegende Häuser umgaben den Bereich.
Der Tempel der Belagerten war der Markt selbst, das Sternengewölbe des Himmels bildete das Dach. Überall erkannte man bei dem rötlichen Schein der Fackeln die stummen und andächtigen Anwesenden. Frauen, Kinder und Greise blieben auf der Schwelle ihrer Häuser, Soldaten mit ihren zerfetzten Uniformen und ihren Waffen standen in der Mitte. Etwas weiter entfernt waren die Verwundeten, die sich in ihren blutigen Leinwandverbänden mühsam herbeischleppten, um auch am gemeinsamen Gebet teilnehmen zu können.
Alle Häupter entblößten oder verneigten sich beim Anblick eines Mannes, der mit besonnener Stirn und begeistertem Antlitz, wie ehemals die Richter Israels, mitten auf den Platz schritt.
Dieser Mann war der Oberst Trujano. Er machte ein Zeichen, dass er sprechen wolle, und alles schwieg andächtig.
»Kinder«, begann er mit klangvoller Stimme, »die Heilige Schrift sagt: ›die, welche eine Stadt bewachen, hüten sie vergeblich, wenn der Herr nicht mit ihnen wacht,‹ bitten wir daher den Herrn der Heerscharen mit uns zu wachen.«
Alle knieten nieder und Trujano in deren Zentrum auch.
»Mit heute«, begann er, »läuft der neunte Tag unserer Messfeier ab, die wir für die glückliche Rückkehr unseres Boten angesetzt haben. Lasst uns auch für ihn beten und das Lob Gottes singen, der bis hierher seine Kinder behütet hat, die ihr Vertrauen auf ihn bauen.«
Dann stimmte er den Vers des Psalms an, der also lautet:
Seine Wahrheit wird Euch zum Schild dienen, ihr werdet weder die Schrecken der Nacht noch den Pfeil, der am Tage schwirrt, noch die Ansteckung, die in der Finsternis herumschleicht, noch die Angriffe des Teufels und des Sünders zu fürchten haben.
Nach jedem Psalmvers wiederholten die Anwesenden: »Herr, habe Mitleid mit uns! Herr, sei uns gnädig!«
Die spanischen Schildwachen, die an dem von den Belagerern eröffneten Laufgraben Wache hielten, horchten versunken auf die religiösen Gesänge, die allein das tiefe Schweigen der Nacht unterbrachen.
Im Antlitz des am weitesten zur Stadt geschobenen Postens lagen einige mexikanische sterbliche Überreste, die ihre Brüder liegen lassen mussten.
Die Nacht vermehrte noch das Grauenhafte dieses grässlichen Schauspiels.
Alle waren mehr oder weniger verstümmelt von den Feinden, die sich oft genug an den Toten für ihre Ohnmacht gegen die Lebenden rächten.
Der Soldat ging in einem abgezirkelten Bereich auf und ab, indem er abwechselnd den vor ihm hingestreckten Leichnamen den Rücken zukehrte, dann sie aber wieder wie ein Mensch, der nichts besseres zu tun weiß, zählte, ohne aber zu vergessen, zwischen ihnen und sich eine respektable Lücke zu lassen.
Um sich eine weniger traurige Ablenkung zu verschaffen, versuchte der Soldat die Worte zu verstehen, die man in der Stadt sang.
Eine entfernte Stimme sprach: »Es werden davon tausend zu eurer Rechten und zehntausend zu eurer Linken fallen, aber euch wird sich das Böse nicht nahen.«
»Alle Teufel! Sollte das Latein sein?«, sprach der Soldat zu sich. »Das soll gewiss ein Gebet für die Toten sein.«
Plötzlich schien es ihm, als habe sich während er von Toten sprach, die Zahl derselben um einen vermehrt.
»Ich werde mich wohl getäuscht haben«, fuhr der Spanier in seinem Monolog fort.
Er zählte die Leichen von Neuem. Dieses Mal merkte er sich genau, dass es zehn waren.
Eine Zeitlang horchte er nun wieder auf den Choral. Dann glaubte er zu bemerken, dass trotz seiner genauen, abgemessenen Schritte die passende Entfernung, die er zwischen sich und den sterblichen Überresten zu halten bemühte, bei jedem Gang geringer wurde. Entweder musste der Leichnam ihm näher gekommen sein, oder er hatte sich getäuscht. Das Letztere war auch das Wahrscheinlichere. Dennoch trat die Schildwache zu dem Toten heran und untersuchte ihn. Er lag auf die Seite gestreckt, und nur eine blutige Wunde zeigte allein die Stelle an, die einst sein Ohr eingenommen hatte. Diese Begutachtung beruhigte den Soldaten, der jetzt plötzlich ganz überzeugt war, dass der Tote, es war dies ein Indianer, nicht ihm näher gerückt sei, sondern dass er sich getäuscht habe. Dann kam ihm aber doch noch die Versuchung an, dem Toten das Bajonett durch den Leib zu jagen, aber eine Leiche nimmt in der Dunkelheit der Nacht eine gewisse Ehrfurcht gebietende Feierlichkeit an, die jeden Gedanken an irgendeine Entweihung energisch zurückweist, und so setzte der Soldat seinen gemessenen Spaziergang wie vorher fort, ohne der Versuchung nachgegeben zu haben.
Wenn die Tote gehen könnten, dachte der Spanier, würde ich fast der Meinung sein, dass diese hier einen rätselhaften Gang haben, ich habe ihrer neun gezählt und finde zehn, und man könnte glauben, ach hol’ mich der Teufel! Das der Schlingel da – die Schildwache meinte damit den verdächtigen Toten – Lust hat, mit mir zu plaudern, um sich die Langeweile zu vertreiben. Zum Geier, die Gesänge der Lebenden da drüben sind gar wenig beglückt, dennoch ziehe ich sie aber der Stille dieser Totenschädel vor. Horch!
Der Gesang tönte fort: »Erhebet Eure Hände zum Heiligtum und lobpreist den Herrn. Seine Wahrheit wird Euer Schild sein, Ihr habt keine Schrecknisse der Nacht zu fürchten.«
Obwohl diese Psalmen der Schildwache schöner als die Trinklieder im Vergleich mit der Ruhe der Toten schienen, so machten ihm dennoch die melancholischen Gesänge der Belagerten und die Totenkompanie, nach der er unwillkürlich blicken musste, ziemliche Langeweile. Er wandte sich kurz mit dem Gesicht zum Lager, wo er sein Zelt bedauerte, das jetzt verwaist dastand und setzte dann seine Promenade wieder fort.
Dieses Mal machte der Soldat so genaue Anzahl von Schritten, dass die Entfernung zwischen dem Indianer und ihm beständig dieselbe, bis zu dem Zeitpunkt blieb als er merkte, dass der ihm so suspekt vorgekommene Verdächtige verschwunden war.
Nach dem ersten Moment des Schocks erkannte der Spanier, dass er sich von einer indianischen List hatte täuschen, und um sich nicht der Nachlässigkeit beschuldigen zu lassen, hütete er sich gewieft, das Lager zu alarmieren und ließ den lebenden Indianer in sein Ziel laufen.
Um den Mangel der Ohren an der lebenden Leiche zu erklären, ist es nötig zu erwähnen, dass der Kommandant Regules sich vor der Belagerung von Huajapam die traurige Befriedigung verschafft hatte, einigen und zwanzig armen Teufeln von Indianern, die in seine Hände gefallen waren, bei Yanguitlan die Ohren abschneiden zu lassen. Einige von ihnen starben an Verbluten, andere, mit denen man weniger grausam verfahren war, hatten sich nach Huajapam geflüchtet.
Zu diesen Bezeichneten gehörte der Indianer, der um der Narbe das Aussehen einer frischen Wunde zu geben, sie mit dem Blut eines nahe liegenden Leichnams überfärbt hatte. Auf diese Heldentat des Kommandanten Regules spielte sein Kamerad Caldelas in der Kriegsratssitzung an, die wir im vorigen Kapitel erwähnten.
»Tausend Bomben!«, rief der spanische Soldat in einem Wutanfall, »wenn diese Hunde da alle nicht mehr tot sind, als jener, der seine Beine so gut zu gebrauchen weiß, so will ich ihnen das Laufen leid machen.«
Mit diesen Worten stürzte er sich, nachdem die Wut über den frommen Schrecken den Sieg davon getragen hatte, dem der Indianer sein Leben verdankte, auf die Leichen los und hörte nicht eher auf, bis er jeden zwei- oder dreimal mit dem Seitengewehr durchbohrt hatte.
Keiner dieser gefühllosen Körper machte eine Bewegung und der einzige Laut, der die Stille der Nacht unterbrach, war das Wutschnauben der Schildwache und die ferne Stimme, die den Belagerten die Psalmen vorsang.
»Ja, ja, singt nur jetzt, Ihr Gauner!«, sagte der Spanier, »Ihr habt recht, und geschähe es auch nur, um Euch über die lustig zu machen, die so gute Wache um Euch halten.«
Während dieser Zeit gab sich der Indianer den Schildwachen Trujanos zu erkennen.
In dem Moment, in welchem er auf dem Platz ankam, setzten die Bevölkerung und die Garnison, die bei der Beleuchtung der Fackeln auf den Knien lagen, ihre heißen und inbrünstigen Gebete fort.
Der religiöse Oberst sang, als ob er geglaubt hätte, dass der Allvater, den er anflehte, ihm einen schlagenden Beweis seines Schutzes geben wollte, gerade den Vers Ich will ihn erretten, weil er sein ganzes Vertrauen auf mich gesetzt hat. Ich will ihn beschützen, da er meinen Namen angerufen.
Als das letzte Gebet dieser neuntägigen Besinnung auf so wirksame Weise endete, stattete der Indianer Bericht über seine Botschaft ab. Er hatte Morelos gesehen und überbrachte Trujano die Zusicherung des Generals, sich unverzüglich in Marsch zu setzen, um den Belagerten zu Hilfe zu kommen.
Trujano erhob die Augen gen Himmel und rief: »Lobpreist jetzt den Herrn, Ihr alle, die Ihr seine Diener seid!«
Jetzt überließen sich die Belagerten nach Verteilung der Abendration, die von Trujano selbst besorgt wurde und nachdem Auslöschen der Fackeln, der Nachtruhe, voller Vertrauen auf den, der nie schläft und dessen Schutz ihnen als Schild diente.
Am Abend des folgenden Tages trugen sich zu derselben Zeit, als die Eingeschlossenen auf dem Fläche versammelt waren, um das gemeinschaftliche Gebet, das unabänderlich jeden Tag beschloss, abzuhalten, einige Stunden vom spanischen Lager andere Szenen zu.
Seinem Versprechen getreu hatte sich Morelos nach Huajapam auf den Weg gemacht. Er konnte zwar nur über etwa tausend Mann regulärer Truppen verfügen, um nicht die Stadt Chilaya, die er erst vor Kurzem erobert hatte, ganz zu entblößen, er fügte dann, um eine ansehnlichere Stärke aufzubauen, tausend mit Pfeilen und Schleudern bewaffnete Indianer hinzu.
Einige Schritte hinter dem kommandierenden General ritten Galeana und der Hauptmann Lantejas nebeneinander.
Die Stirn des ehemaligen Studenten war sorgenvoll und sein Blick trübe.
»Der General hat recht, Euch den Urlaub zu verweigern«, sagte Galeana, »ein so unterrichteter und gehorsamer Offizier, wie Ihr seid, ist zu schwer zu ersetzen. In Bezug auf die Unzufriedenheit, die Euch der General, durch Euer hartnäckiges Bestehen auf den Urlaub gereizt, ein wenig barsch zu erkennen gegeben hat, so betrübt Euch darüber nicht zu sehr. Mein lieber Lantejas, zählt auf mich, ich müsste sehr unglücklich sein, wenn es mir nicht gelingen sollte, Euch die Gelegenheit zu einem guten Lanzenstoß zu verschaffen, damit es Euch gelingt, Euch wieder in seine Gunst zu setzen, tötet nur eigenhändig drei oder vier Spanier oder einen einzigen höheren Offizier.«
»Lieber einen höheren Offizier, ich werde es nicht vergessen«, erwiderte zerstreut der Hauptmann Lantejas.
Er dachte sowohl daran, dass diese Verpflichtung, sich mit Vorbedacht auszeichnen zu müssen, ihm, der bis jetzt nur ein Held des Schicksals gewesen war, diese Bewölkung der Besorgnis auf die Stirn gelagert hatte.
Als der Heerhaufen der Insurgenten für diesen Tag stoppte, dachte man über die Maßnahme nach, einen entscheidenden Schlag gegen die Belagerer auszuführen, und man beschloss, um dies ermöglichen zu können, sie zwischen zwei Feuer zu nehmen, das heißt, in demselben Augenblick anzugreifen, in dem die Belagerten einen Ausfall machten. Das Schwierige bei der ganzen Sache war, sie von diesem Vorhaben bei der engen Einschließung, die die spanische Armee ausübte, in Kenntnis zu setzen.
Die Indianer standen unter den Befehlen des Hauptmanns Lantejas. Als es sich nun darum handelte, einen Boten zu Trujano zu senden, versicherte einer derselben, er kenne hinter dem Dorf einen geheimen Weg, auf dem er bis in die Stadt gelangen könnte. Don Cornelio ließ den General Morelos davon benachrichtigen und dieser sandte ihm zur Antwort den Befehl, den Indianer mit einigen Leuten, die er sich nach Ermessen auswählen könnte, zu begleiten. Dieser Auftrag war ebenso gefährlich wie ehrenvoll und Lantejas würde gern die Ehre abgelehnt haben, die ihm daraus erwachsen konnte, wenn er sie von der Hand weisen könne, da er sich aber, die Sache bei Licht besehen, dabei der noch gefährlicheren Anerkennung, drei oder vier Spanier oder wenigstens einen höheren Offizier niederzuhauen, entziehen konnte, und da es ihm endlich nicht freistand, sich gegen einen Befehl des kommandierenden Generals aufzulehnen, so fügte er sich demselben.
Zu Kameraden seines Abenteuers wählte er Clara und Costal, und außerdem noch ein Dutzend Soldaten, auf die er sich verlassen konnte. Mit Anbruch der Nacht brachen sie auf.
Am Ende eines ungefähr zweistündigen Marsches bemerkte das Kommando die Biwakfeuer im spanischen Lager, dann bald darauf auch die schweigsamen Häuser von Huajapam, in welchem die Belagerten schon die Stunden und Minuten zählten, in Erwartung der versprochenen Stärkung.
Von der Stelle, wo der indianische Führer die Leute des Hauptmanns haltmachen ließ, führte ein Kreuzweg bis zu der Stelle, wo die spanische Schildwache mit einer gewissen Unruhe auf- und abging, als ob sie die Gefahr ihres Postens ahnte.
Es war derselbe Hohlweg, den am Tag vorher die Schildwache besetzt hatte, die sich in der Zahl der Leichen geirrt, und durch diesen war auch der Indianer gekommen, der die Menge vermehrte.
Es schienen sich mehrere Dinge zu vereinigen, um der Schildwache diesen unruhigen Gang zu geben, der alles zu verderben drohte. Mit dem unangenehmen Auffrischen des Nachtwindes vereinigte sich der verpestete Leichengeruch, der seine Geruchsnerven beleidigte, dann war der Anblick dieser schweigendem düsteren Gefährten für ihn nicht weniger grausig, als für seinen Vorgänger, der am vorigen Abend diesen Posten einnahm. Auch flößte ihm das Bild des Todes, das er beständig vor Augen hatte, einen gewissen Schauer ein.
Die Schildwache ging mit einer Flinkheit hin und her, die unerlässlich war, um dem zweifachen Grauen, das ihn schüttelte, zu vertreiben. Im Gesamten war auch, sei es nun, dass man Kenntnis erhalten hatte von der Auferstehung des Indianers, sei es aus einer anderen Ursache, die Einschließung eine noch engere geworden. Die Schildwachen waren näher zusammengestellt, um sich gegenseitig beobachten zu können.
Der einzige Moment, den die Schildwache stehen blieb, dauerte nicht länger als nötig war, um den Nachtruf zu wiederholen: »Alerta! Centinela! (Achtung, Schildwacht!)«
»Es tut mir um ihn leid«, sagte Costal, »ich muss ihn fortschicken, um beim ewigen Vater die Wache zu beziehen.«
»Pst! Heide«, mahnte der Hauptmann Don Cornelio ärgerlich.
Die kleine Streitkraft hatte bei einer niedrigen, fast ganz eingestürzten Mauer haltgemacht, die sie, ebenso wie die hier und da verstreuten Aloe und die Wermutbüsche gegen die Neugierde der Schildwache schützte.
»Zuerst müssen wir die Schildwache beseitigen«, sagte Costal. »Ist das geschehen, verstreut ihr e hinter die Büsche und lasst mich machen.«
Der Indianer ergriff eine Schleuder und legte einen ausgewählten Kiesel hinein. Zwei anderen Indianern befahl er, ihre Pfeile in Bereitschaft zu halten, und alle drei machten sich fertig.
»Ihr werdet zweimal nacheinander zwei Steine zusammenschlagen«, sagte Costal zum Hauptmann, »und Ihr da, schießt eure Pfeile beim zweiten Schlag ab.«
Dies war einer der seltenen Fälle, in denen Pfeil, Bogen und Schleuder der Flinte vorzuziehen sind.
Lantejas schlug die zwei Steine geräuschvoll gegeneinander.
Dieses Geräusch vernahm auch die Schildwache. Sie blieb stehen, lauschte aufmerksam und schlug mit der Hand an das Gewehr.
Der Hauptmann schlug zum zweiten Mal. Der Stein und die Pfeile sausten durch die Luft. Ohne auch nur einen Seufzer auszustoßen, stürzte der Spanier, von dem dreifachen Schlag getroffen, leblos zu Boden.
»Jetzt los!«, rief der Indianer lebhaft, »das Übrige lasst mich nur machen.«
Der Hauptmann und die beiden Indianer schlichen so vorsichtig wie möglich hinter die Wermutstauden und die Aloebüsche, dann erbebte Don Cornelio plötzlich vor Schrecken.
Die Schildwache, die er zu Boden hatte stürzen sehen, ging wie vorher auf und ab. Es war derselbe Schritt, und Lantejas merkte keinen Unterschied in der Stimme, die mit mahnendem Ton rief: »Alerta! Centinela!«
»Wo zum Teufel steckt Costal?«, fragte Don Cornelio sich, indem er vergeblich den Indianer zu entdecken suchte.
Während der Zeit gingen die beiden anderen Indianer, die sich anfangs einige Schritte vom Hauptmann entfernt niedergekauert hatten, der Stadt zu, ohne sich eben viel um die Schildwache zu kümmern.
Ein Geistesblitz schoss in den treuherzigen Don Cornelio.
»Die Schildwache ist Costal, so wahr ich lebe!«, sprach er zu sich. In der Tat war der Tote von dem Lebenden ersetzt worden, und die anderen Schildwachen, die immer weiter noch die Wachtrufe ihres Kameraden zu vernehmen glaubten, waren weit davon entfernt, irgendeinen Verdacht zu schöpfen.
Cornelio eilte aufs Schnellste zur belagerten Stadt.
Die beiden Indianer waren schon verschwunden. Als Costal bemerkte, dass auch der Hauptmann nicht mehr zu sehen war, warf er Tschako und Flinte der Schildwache weg und eilte ihm nach.
»Schneller! Schneller!«, rief Costal, »die Schurken werden Alarm schlagen, wenn sie ihren Kameraden nicht mehr sehen.«
Mit diesen Worten erreichte er den Hauptmann, ergriff ihn bei der Hand und zog ihn so schnell mit sich fort, dass Don Cornelio der Atem ausging.
Wie im Flug erreichten beide die Stadt, als die mexikanische Schildwache, die schon im Voraus von den beiden Indianern benachrichtigt worden war, sie ohne Schwierigkeit einließ.
»Hört Ihr?«, fragte Costal, »die Schurken da unten haben das Unglück, das ihrem Kameraden zugestoßen ist, bemerkt und schlagen nun Alarm, nur – jetzt ist es zu spät.«
Geschrei und Flintenschüsse ertönten vom spanischen Lager herüber.
Trujano, mit einem Degen umgürtet, inspizierte noch den schon leeren Marktplatz in Huajapam, ehe er sich zur Ruhe begab, als der Hauptmann und Costal ankamen.
Während ihm nun Don Cornelio Rechenschaft über seine Botschaft ablegte, betrachtete der Oberst ihn und den Indianer aufmerksam.
Eine dunkle Erinnerung rief ihm diese beiden Personen, die er irgendwo schon einmal flüchtig gesehen haben musste, ins Gedächtnis zurück.
Als der Hauptmann seinen Bericht geendet hatte, sagte Trujano: »Ich suche, in welchem Traumbild ich Eure Züge schon einmal gesehen habe. Ach! Seid Ihr der junge Student, der so fest an den Bannstrahl des Erzbischofs von Oajaca glaubte und der in der Hacienda las Palmas die Insurrektion wie eine Todsünde verfluchte.«
»Derselbe«, antwortete Lantejas mit einem lauten Seufzer.
»Und Ihr, seid Ihr der Tigerjäger Don Mariano Silvas?«
»Der Nachkomme der Kaziken von Tehuantepec«, antwortete Costal mit stolzer Würde.
»Gott ist groß und seine Wege sind unerforscht!«, rief der Oberst mit der erleuchteten Miene eines Weissagers von Juda aus.
Er nahm den Hauptmann mit sich.
Nachdem der Hauptmann ferner Bericht abgestattet und mit Bewunderung, obgleich er die Belagerung von Cuautla mit durchgemacht hatte, den Bericht, den er von Huajapam vernommen hatte, blieb ihm nichts mehr übrig, als sich während der wenigen Stunden, die noch bis zur entscheidenden Schlacht übrig waren, zur Ruhe zu begeben. Er warf sich in seinem Mantel gehüllt auf eine Bank, auf der er nicht eher den Schlummer finden konnte, bis er sich fest vorgenommen hatte, keine andere Heldentaten zu verüben, als diejenigen, zu denen er durchaus zur Verteidigung seines Leibs gezwungen werden sollte.
Erst am anderen Tag nach dem Hochamt teilte Trujano den Belagerten mit, dass sie beim Beginn des nächsten Tages einen Ausfall unternehmen wollten, um die Spanier von der einen Seite anzugreifen, während Morelos sie von der anderen Flanke bekämpfen würde.
Dann erlaubte der Oberst nach inbrünstiger Absingen des Tedeum der Mannschaft, sich beim Klang der Trompeten und dem Zischen der Raketen über dieses Merkmal göttlichen Schutzes zu erfreuen. Dieser Aufruhr des Wohlgefallens drang bis ins königlich spanische Lager.


