Der Spion Band 1 – Die Schlacht bei Jena – 2. Kapitel
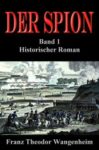 Franz Theodor Wangenheim
Franz Theodor Wangenheim
Der Spion
Band 1 – Die Schlacht bei Jena
Historischer Roman
Verlag von C. P. Melzer, Leipzig 1840
2. Kapitel
Es ist ein ebenso schwieriges wie undankbares Unternehmen, die Tatsachen, welche Preußen im Jahre 1806 zum Krieg gegen die Franzosen bestimmten, aufzuzählen; aber sie sprechen samt und sonders für deutsche Ehre, für die Freiheit der Deutschen. Der Kaiser der Franzosen hatte mittelst einer Politik, deren sich kein Biedermann entblöden wird, Preußen von allen ihm befreundeten Mächten loszulösen gesucht. Da ihm solches gelungen war, streckte er die Faust nach dem zweideutigen Geschenk, nach dem Judaslohn aus, den übertölpelte Minister angenommen. Welches Kabinett konnte gegen das in den Tuilerien standhalten? Dort stand hinter jedem Verlangen das krieggerüstete Frankreich, denn sein Kaiser war nicht Franzose, er fühlte sich keineswegs verantwortlich für jeden Tropfen französischen Blutes. Das Volk selbst, diese Verehrer des Faschings, diese Renommistenmenge, kaum dem Terrorismus im eigenen Vaterland entrissen, strebte nach dem Ansehen, selbst Schrecken zu verbreiten, und folgte dem Weltenstürmer blindlings, wohin er es führte. Napoleon hatte in der Komödie in Frankreich seinen Kulminationspunkt erreicht. Nun galt es eine andere Farce, den wankelmütigen Franzosen zu fesseln und diese Farce galt Ehre und Freiheit der Deutschen. Dass Napoleon Preußen zu würdigen verstand, erhellt aus der schlauen Politik, welche er anwenden musste, um Preußen nicht allein von seinen Freunden zu trennen, sondern es auch mit ihnen zu verfeinden. Mit dieser Machination huldigte der Kaiser der Franzosen dem preußischen Volk und seiner Kraft. Den ersten Grund zu dieser Huldigung wird man leicht erkennen. Nicht Hannibal war es, dem Napoleon seine Kriegswissenschaft verdankte, auch nicht der Makedonier, sondern Friedrichs des Großen Kriege waren seine Schule. Hannibal und Alexander konnten wohl den Jüngling mit Enthusiasmus erfüllen, doch die Taten, die geordneten, siegreichen Kriege Friedrichs des Zweiten, der Weltruhm des letzten Jahrhunderts, regelten die Kriegsweise des Mannes, erfüllten ihn jedoch auch mit verzeihlichem Zagen vor einem Volk, dessen König eben sein Vorbild gewesen war. Gewiss tat sich Napoleons Klugheit bei der Anerkennung preußischer Volkskraft am glänzendsten kund.
Den Absichten des Kaisers, Preußen zu überraschen, kam die Stellung eines deutschen Fürsten zu Hilfe. Friedrich Wilhelm der Dritte, angestammter König von Preußen, musste wohl erwägen, dass ein Fürst für die Nachwelt lebe. Diese urteilt streng nach den Taten und erkennt dem weisen Herrscher den Kranz zu, wie sie im Gegenteil die Verdammung ausspricht. Preußen war sein Volk, er gehörte dem Volk an, welches er regierte, jeder Tropfen Untertanenblut war Bruderblut. Wer konnte ihn um ein Zagen, blutige Zeit herbeizuführen, nicht loben? Franzosen freilich, welche einem Korsen im Rausch des Ruhmes folgten, verstanden nichts davon; aber Napoleon hatte sicherlich auch das berechnet. Wie würde er sonst noch immer hämisch an Frieden gemahnt haben, da schon Blut geflossen war?
Aber es war in Preußen ein Zwischenreich eingetreten.
Ehe Friedrichs des Großen Zepter in Friedrichs III. Hand gelangte, war Preußen nicht mehr das von jenem Krieg, da drei Riesen vor dem rüstigen Kämpen gesunken waren. Jene Unglücklichen, welche so glücklich waren, dem Messer in Frankreich zu entgehen, und die man in Deutschland gastfreundlich aufgenommen hatte, brachten die sogenannte verfeinerte Sitte nach Deutschland, das heißt, sie vergifteten das biedere, gerade deutsche Volk. Affektierte Flatterhaftigkeit trat an die Stelle des gemütlichen Frohsinns. Man wetteiferte sogar mit den Franzosen selbst, die heiligsten Institutionen in das Lächerliche zu ziehen und an den beseligendsten Empfindungen Felonie zu begehen. Welcher junge Mann hätte wohl noch den Tacitus studieren mögen, den Plutarch, oder an dem Homerischen Sang Geschmack gefunden? An Saft und Kraft, an Geist und Herz, an Würde, äußerer und innerer, war Deutschland von Frankreich aus verderbt worden und das war Napoleons zuverlässigster Helfershelfer.
Da bedurfte es denn des höchsten Grades von Übermut, die Tyrannei musste sich nackt, ohne Heuchelei, im schillernden, betrügerischen Farbenglanz zeigen, um ein Volk, welches noch Feldherren aus seines Ruhmes Tagen unter sich zählte, aus seiner Lethargie aufzurütteln. Napoleon zeigte sich, wie er war, und Preußen erwachte!
Da nur das Kurfürstentum Sachsen noch – und auch dieses war zweifelhaft — als Preußens Verbündeter zu betrachten stand, so warf Napoleon die Maske ab und verlangte im diktatorischen Ton Hannover, Bayreuth, die Mark und Ostfriesland zurück. Diese Lande auf direktem Weg mit dem französischen Kaiserreich zu verbinden, zumal Hannover, erheischte nicht allein Napoleons größter Plan, England zu verderben, sondern auch sein korsischer Rachegeist, um die vom Hause Hannover stammenden Fürsten in England tödlich zu kränken. Aber Preußen errötete vor dem schmählichen Ansinnen und sagte ein eisernes Nein. Der erste Impuls zur blutigen Antwort ging von dem besseren Teil des Volkes aus. Dessen Stimme berechtigte den ritterlichen König, das Herzblut seines Volkes an seines Volkes Ehre zu setzen.
Berlin selbst, die Hauptstadt, bot in jener Zeit ein gar eigentümliches Bild. Kaum war die Nachricht von dem preußischen Gesandten in Paris, General von Knobelsdorf, dass er mit Talleyrand ein gewichtiges und entschiedenes Wort gesprochen hatte, angelangt, so war es auch schon ausgemacht, dass es Krieg mit den Franzosen gäbe. Bedenkt man nun, dass selbst in dem kritischen Augenblick, da Napoleon nicht anders auf Preußens Note als durch Kriegsrüstung und beschleunigte Abreise von Paris antwortete, französische Offiziere in allerlei Gestalt bis Dresden schweiften, so ist leicht zu erachten, dass man in Berlin an dem einzigen Verbündeten, an Sachsen zweifeln musste ; aber im entscheidenden Augenblick erwies sich Sachsen treu dem alten deutschen Blut und des Namens würdig.
Im Kabinett zu Berlin war die Umwälzung ebenso groß wie die Tätigkeit im Kriegsministerium. Man spähte nach Leuten aus Friedrichs des Großen Schule, denn die jüngere Generation war für einen Krieg mit Napoleon nicht tüchtig. So hatte man denn auch den alten Hauptmann von Wallen aufgefunden. Er sollte für des Herrn Ministers Excellenz General- und Spezialkarten zeichnen, sollte der Exzellenz einen Operationsplan entwerfen. Der Hauptmann versetzte in seinem sehr verständlichen Ton: Wenn Sr. Excellenz Krieg führen wollten, so wäre die Mühe doch vergebens. Sollte ein Soldat ihn auffordern, so würde er nicht zögern; aber mit dem Kabinett habe er nichts zu schaffen.
Unmittelbar nach dieser allzu höflichen Erklärung machte sich der Hauptmann auf den Rückweg. Seine Laune, in welcher er das Haus wieder betreten hatte, war für des Assessors Anliegen nicht die vorteilhafteste. Er sah den jungen Mann im ersten Augenblick nicht. Erst dann, als er ärgerlich den Hut auf den Tisch gestaucht, als ihm Luise den Stock, ihre Mutter den Degen abgenommen hatte, gewahrte er des Assessors. Ohne ein Wort zu sagen, blieb er mit fest auf ihn gerichtetem Blick starr und streng vor ihm stehen.
Die Frau Hauptmann war schnell gefasst: »Herr Kammergerichtsassessor Doktor Weiß erwartet dich schon seit fünf Minuten.«
»Zu Diensten, Herr Doktor«, war des Hauptmanns lakonischer Bescheid.
Die Frauen entfernten sich, als wäre es unter ihnen verabredet worden.
In militärisch steifer Form holte der Hauptmann einen Stuhl und wies auf das Sofa.
»Setzen wir uns.«
Der Assessor nahm ohne Zögern Platz.
»Was haben Sie an mich? Ehe Sie aber sich erklären, muss ich bemerken, dass ich mit studierten Leuten nicht gern krame. Sind Sie etwa von des Herrn Ministers von Haugwitz Excellenz an mich geschickt, so sparen Sie jedes Wort …«
»Wie mögen Sie denken!«
»Sr. Excellenz meinten, sie hätten schon nach mir geschickt …«
»Es fragte jemand nach Ihnen …«
»So? Ein anderer also? Nun denn. Sie spionieren in meinem Gesicht herum, wundern sich, dass der alte Wallen sogar verdrießliche Miene zieht; aber junger Herr, ich habe Ursach – Sie sind Preuße?«
»Das ist mein stolzes Bewusstsein.«
»Haben Sie noch Eltern?«
»Nein, meine Mutter starb, als sie mir das Leben gab, mein Vater war Ziethener Husar gewesen und folgte ihr vor fünfzehn Monaten.«
»Weiß? Hm, weiß? War er nicht Quartiermeister?«
»Ganz recht. Sie kannten ihn?«
»Ob ich ihn kannte! Dass er Ihr Vater gewesen war, das allein verschafft Ihnen bei mir einen Stein im Brett. Denken Sie nur, na, warum sollte ich verbergen, was man sich an allen Ecken, in allen Gassen erzählt? Es gibt Krieg und den wollen Minister führen, und ich, ich soll ihnen meinen Kopf leihen! Nimmermehr. Habe ich nicht recht? Was denken die Leute? Ich bin kein Lump, der auf seine Pension beschränkt ist. Ich habe noch Vermögen, brauche nicht um einige Gulden mich herzulassen, aber wenn ich auch nur meine Pension hätte, so würde ich es doch nicht tun, denn ich liebe mein Vaterland.«
»Auch ohne diese Versicherung aus Ihrem Munde ist man davon überzeugt.«
»Nicht wahr, das wäre eine artige Kriegsweise! Wenn die Leutchen da in Berlin sitzen und jeden General und jeden Oberst am Leitfaden halten wollen! Ha, ha, ist es nicht zum Lachen! Sie meinen, ein Defilee sei ebenso leicht zu nehmen, oder eine Batterie, als ob man mit vier Hengsten in einer bequemen Kutsche von Berlin nach Potsdam fährt! Der König wird ihnen aber ein anderes Licht aufstecken!«
»Gewiss, ganz gewiss«, gab der Assessor in aller Kürze zu, um endlich auf sein Anliegen zu kommen.
»Was würde ein Minister sagen«, verfolgte sich der Hauptmann, »wenn es wie bei Hochkirch ginge? Donnerw…, vergeben Sie, ehe die Nachricht von so mörderischem Überfall nach Berlin käme, wäre eine ganze Armee …« Er fuhr mit der inneren Fläche der Hände auf und nieder, als ob man mit Stahl und Stein Feuer schlägt. Diese Art, sich auszudrücken, brachte er gewöhnlich in Anwendung, wenn er die Vernichtung eines Infanterie-Regiments durch schwere Kavallerie bezeichnen wollte.
»Freilich, freilich …«
Der Hauptmann schwieg. Er schien noch ärgerlicher, als da er eingetreten war, fuhr mit der hohlen Hand über Stirn, Nase und Bart und, nachdem er die rechte Ecke desselben mit den Lippen gefasst hatte, fragte er ziemlich barsch nach des Assessors Anliegen. Diesem wurde das Anbringen bei dem Hauptmann um ein Großes schwerer als bei der Mutter. Es dauerte ziemlich lange, ehe er in einem sehr gewagten Periodenbau sich verständlich machte.
Der Hauptmann stand auf, ohne den Blick von ihm zu wenden, tat einige Schritte hinter sich und fragte dann: »Der Herr Doktor wollen meine Tochter heiraten?«
Der junge Mann antwortete nur, indem er dem Hauptmann rasch folgte und dessen Hand an seine Brust drückte.
»Das ist ganz gut.« Der Hauptmann versuchte dem jungen, stürmischen Mann die Hand zu entwinden. »Aber die Zeiten eignen sich nicht zu Heiratsgedanken. Im Krieg muss man keinen Klotz am Fuß haben … nein, nein … es wird nichts. Es tut mir leid und … Ihr Vater war ein tüchtiger Soldat … leider war er nicht von Adel …«
»Leider?«, flammte der Assessor. »Herr Hauptmann, ich setze voraus, dass ein Mann, welcher recht gut aus Erfahrung wusste: Bürgerblut spritze ebenso hoch und sei ebenso rot wie adliges, nur den Sohn des wackeren Soldaten in mir suchen, finden würde, nicht aber …«
»Nur nicht so heftig. Hören Sie, junger Mann« Des Hauptmanns Blick sprach von Wohlgefallen. »Dass Sie etwas Rechtes gelernt haben müssen, geht schon daraus hervor, dass Sie, ein Bürgerlicher, schon jetzt – Sie können vierundzwanzig Jahre alt sein – Kammergerichtsassessor sind. Auch zweifle ich nicht, dass Sie es noch viel weiter bringen werden. Doch ich muss Ihnen eine Geschichte aus meinen Kriegsjahren erzählen und ich stelle Ihnen dann anheim, wie Sie über den alten Wallen urteilen wollen. Sitzen Sie, sitzen Sie; hören Sie ruhig und aufmerksam zu. Glauben Sie, dass ich nicht empfinde, wie ein Antrag, den Sie mir gemacht haben, wie mein Beschluss darüber schwer in die Lebenswaage eines Menschen fällt? Ich bin Mensch und wie würde es mich auf der Seele brennen, wenn ich mit einem Wort Ihre Anwartschaft auf Erdenglück zertrümmerte. Nein, das tut der alte Wallen nicht; Gott bewahre mich in Gnaden, dass ich so sündig handelte.
Ich wurde für das Kriegshandwerk erzogen. Auf der Schule schon knüpfte ich ein enges Freundschaftsband mit einem Knaben meines Alters. Er hieß Ernst von Schuman. Sonderbar genug, dass unsere Lebenswege sich niemals voneinander schieden. Wir empfingen zugleich das Porte-Epee, zugleich unsere Patente und es war nicht anders, als wären wir beide ein Leib und eine Seele. Das ging denn so lange, bis Ernst von Schuman sich in die Tochter des Feldpredigers verliebte und trotz aller Vorstellungen von meiner Seite beim König selbst um die Erlaubnis zur Heirat nachsuchte. Welche Mittel er angewendet hatte, den großen Mann zu bestimmen, ist mir unbekannt geblieben; doch dass derselbe mit Widerwillen die Erlaubnis erteilte, geht daraus hervor, dass mein Waffenbruder fortan im Avancement übergangen und ich augenscheinlich begünstigt wurde. Das junge Weib gebar ein Töchterchen, da wurde die Trommel wieder laut und wir mussten in den dritten Krieg. Meinen Schuman kannte ich kaum noch. Der frohe Kriegersinn war erloschen und ein stiller Gram erfüllte sein Herz. Da traf ihn der härteste Schlag.
Die Feldpost brachte ihm die Todesnachricht seiner Frau. Ich will Ihnen nicht erzählen, wie ich ihn zu trösten versuchte, aber zu meinem Schrecken erfuhr ich, dass er nicht den Tod seiner Frau betrauerte, sondern nur das Schicksal seines Kindes. Er liebte die Frau nicht mehr, nachdem der erste Rausch verflogen war.
Das Bataillon, bei welchem ich nunmehr als Hauptmann stand, erhielt Order, in der rechten Flanke des Feindes eine Diversion zu machen. Lustig, als ginge es zum Tanz unter den Maienzweigen, marschierte das Bataillon zur Seite ab und, von einiger leichten Kavallerie gedeckt, ging das Scharmutzieren los. Aber wie ein Sturmwind raste eine berittene Batterie auf eine Höhe zur Linken und ebenso schnell schlugen Kartätschen in das sich sicher wähnende Bataillon. Sie können leicht denken, dass uns nichts übrig blieb, als rechtsum kehrt zu machen. Doch nur fünfhundert Schritte weit etwa salvierten wir uns, und das gelichtete Bataillon stand wieder schlagfertig, um den Schock der Kavallerie auf die Batterie zu unterstützen. Hagel und Wetter, das war ein Schock! Wir im Sturmschritt, im hellen Lauf nach, mit unserer Salve vermischte sich die volle Lage der Batterie. Der zu Tode getroffene Fähnrich hatte nur noch Kraft, den Schaft in den Boden zu stoßen – die Batterie war unser. Ha! Was sagen Sie zu dem Coup? Doch ich wollte Ihnen ja noch etwas anderes erzählen. Was war es doch?«
»Wenn ich nicht irre, von ihrem Waffenbruder …«
»Ganz recht, ja». Der Hauptmann wurde ernster, beinahe traurig. »Nur wenige von den Artilleristen konnten sich durch die Flucht retten, an Gefangene wurde nicht gedacht, denn die ersten Kartätschengrüße waren zu derb gewesen. Auch kann der Soldat beim Sturm auf eine Batterie nicht anders, als seinen Mann erschlagen. Als die Affäre vorüber war, schien es ratsam, in möglichster Eile davonzugehen, da fand ich, am Abhang der Höhe, kaum zwanzig Schritte vor der Mündung eines der Stücke, meinen Waffenbruder. Eine Kugel hatte ihm die rechte Hand im Gelenk genommen, eine andere war ihm durch die rechte Seite der Brust gefahren. Ich fand ihn dem Tode nah.
›Lass nur gut sein, Bruder‹, quälte er mit Mühe hervor, da ich einige von meinen Leuten rief, damit wir ihn fortbrachte. ›Es ist aus mit mir. Leb wohl.‹
Ich fühlte, wie er mir gern die Hand drücken wollte, aber es fehlte ihm die Kraft.
Hast du nichts mehr auf dem Herzen?, fragte ich.
Er knirschte mit den Zähnen, zog die Augapfel bis hoch in die Stirn und keuchte: ›Mein Kind, mein Kind … verlass du es nicht, Bruder.‹
Da weinte ich auf sein verzerrtes Antlitz, drückte ihm die Hand und versprach, dass ich sein Kind niemals verlassen wollte. Ich meinte, er wäre schon hinüber, doch er riss noch einmal die Augen weit auf, die bleichen, schmalen Lippen taten sich voneinander. Wie hohler Geisterton drangen die Worte in mein Ohr: ›Doch nur einen Ebenbürtigen … verstehst du … soll mein Kind … es taugt nicht … es taugt nicht.‹
Er war tot. Junger Herr, ich hielt Wort, ließ das Kind erziehen und es wuchs zur Jungfrau heran. Arm war sie, die Tochter meines Kameraden, aber schön und mancher redliche, vermögende Bürgerssohn näherte sich ihr. Aber die letzten Worte des sterbenden Vaters, welche nur derjenige ganz verstehen kann, der das im Tode verzerrte Gesicht erblickte, ließen mich wachsam sein und jeden wies ich rau zurück. Was tat ich? Ich war lahm geschossen, sah ein, dass man sehr flink auf den Beinen sein müsste, wenn man einem jungen Mädchen folgen wollte, dass man hundert Augen haben müsste, es zu bewachen. Ich fragte, ob Friedrike mich Invaliden zum Mann wollte. Sie sagte ja, und …«
»Ihre Frau?«, rief der Assessor.
»Sie haben sie gesehen; ich habe Wort gehalten, ihr einen Ebenbürtigen zum Mann gegeben. Es taugt nicht. Diese letzten Worte meines Kameraden bestimmen mich wegen meiner Luise …«
»Halten Sie ein, Herr Hauptmann!« Der Assessor fuhr vom Sofa auf, als habe sein Fuß ein giftiges Ungetüm berührt. Eine jähe Röte überflammte sein Gesicht. »Ich bitte, ich beschwöre Sie, sprechen Sie das Wort nicht aus! Würde ich es so sehr fürchten dieses Wort, wenn ich nicht voraussetzte, dass Sie es streng hielten?«
»Die Meinung ist gut, doch Ihnen steht auch noch ein anderes im Wege. Der Krieg hat schon manchen Mann erhoben. Da, wo das Herz sprechen muss und der Geist sich offen bekunden, da zeigt sich der Mann in seinem vollen Wert. Wer für das Vaterland die treue Klinge führt, mutig, ohne Zagen dem Feind auf Tod und Leben entgegentritt, der kann auch den eigenen Herd beschirmen, die teure Frau und die zarten Kinder.«
»Ha, ein Blitz in meine Seele!«
»Hat es gefangen?« Der Hauptmann blickte so freundlich auf den jungen Mann, dass dieser stürmisch seine Hand ergriff und im leuchtenden Blick die Antwort gab. »Verstehe schon, verstehe.« Der Hauptmann drückte des Assessors Hand in seinen beiden Händen, und zwar so fest, dass es keiner anderen Versicherung der Zufriedenheit bedurfte. »So meldet sich Preußenblut und preußisch Herz! Das Vaterland ruft, seine Söhne sollen es gegen fremde Tyrannenwut beschützen. Weg mit dem Gänsekiel, das Schwert in die Hand! Hervor aus Akten- und Bücherstaub, und hinauf auf das Schlachtross! Die Juristerei mag feiern, bis der Glocken helles Geläut die Friedenskunde gibt!«
Der alte Krieger aus Friedrichs des Großen Ruhmestagen stand wie ein mahnender Vater vor dem jungen Mann. Dieser fühlte sich fortgerissen in einen unabsehbaren Schwall von Gefahr und Ruhm. Aber der Gedanke an Schmach und Tod fand nicht Raum in dem glühenden Haupt, die Brust des werdenden Kriegers wogte auf und nieder. Es war, als müsste dieser glutgeschwängerte Raum sich vernichtend entladen.
»Ja, ich will!«, stieß er mit kurzen Atemzug hervor. »Ich will hinaus mit meinen Brüdern, für König und Vaterland und – für meine Liebe!«
Der Hauptmann riss ihn heftig in seine Arme und ebenso ließ er ihn wieder von sich, indem er ihn bei der Hand festhielt.
»Und kommst du zurück, kommst du – sei es mit Narben bedeckt und Ehrenzeichen, sei es auf einer Bahre, wenn dir nur noch ein Lebensfunken in der Brust glimmt. Meine Luise wird ihn mit ihren Küssen zur lodernden Flamme anfachen! Doch halt, halt, wir müssen doch auch meine Luise hören. Ja, ja, auch die hat bei der Affäre ein Wort mitzusprechen. Aber lass mich nur machen, lieber Junge, ich will eine Mäusepatrouille abschicken und das gute Herz beschleichen.«
»Spare die Mühe, Freund, trat ihm die Frau Hauptmann entgegen. »Vor ihrer Mutter hat Luise kein Geheimnis. Ich weiß, dass sie ihn liebt.«
»Alle Hagel!«, sah er den Assessor groß an. »Der Mosje hat also schon parlamentiert?«
»Vergeben Sie meinem Herzen, bester Vater.«
»Höre, Riekchen«, der Hauptmann näherte sich ihr mit einem sonderbaren Schmunzeln, »wir beide sind doch eigentlich noch recht unerfahren, he?«
Die errötende Frau eilte aus seiner Nähe und führte Luise herein. Wer möchte die holde Scham der bräutlichen Jungfrau beschreiben? Aber diesen seelenvollen Blick, wie ihn Luise zu dem Geliebten aufschlug, konnte nur das Auge des reinen deutschen Mädchens dem makellosen, deutschen Mann spenden.
»Hut, Degen und Stock!«, unterbrach der Hauptmann diesen schwärmerischen Moment. »Jetzt gehen wir in den Braunen Hirsch und Mittag speisen wir miteinander. Friederike, du weißt ja – Hammelkeule mit Charlotten und von dem ganz Alten in der Kellerecke!«
Schreibe einen Kommentar