Der Schwur – Zweiter Teil – Kapitel 1
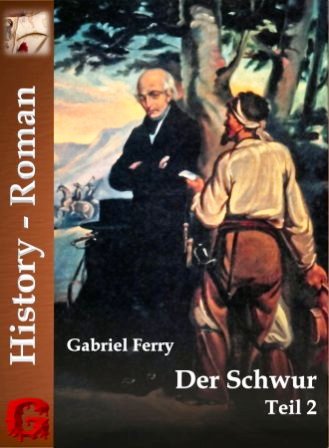 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Zweiter Teil
Ein moderner Odysseus
Kapitel 1
Der Pfarrer von Caracuaro
Nach etwas mehr als einem Jahr nach dem ersten Aufflackern der Revolution, also gegen Ende des Jahres 1811, ging es der mexikanischen Schilderhebung gewissermaßen wie einem Flächenbrand, der plötzlich mitten in den unermesslichen Savannen oder den mächtigen Wäldern Amerikas ausbricht, aber von Menschenhänden auf einen kleinen Raum eingeschlossen wird. Vergebens züngeln dann die Flammen nach allen Seiten und suchen neue Nahrung. Um sie herum ist nur eine weite Einöde, bald hört das Krachen der gewaltigen Bäume und das Knistern der hohen Gräser auf und alles verschwindet unter einer Rauchwolke, die über einem Haufen schwarzer Asche lagert.
Dieser Spezies war die durch den Priester Hidalgo hervorgerufene Insurrektion. Von dem unbedeutenden Flecken Dolores hatte sie sich mit unerhörter Schnelligkeit von einem Ende Neuspaniens bis zum anderen verbreitet. Aber bald darauf wurden die Chefs und Hidalgo an ihrer Spitze gefangen genommen und erschossen. Stufenweise durch die spanischen Waffen und durch die Anstrengungen des Generals Don Felix Calleja zusammengedrängt, war sie zuletzt auf einem einzigen Punkt, dem Ort Zitacuaro, konzentriert, an dem der mexikanische General Ygnacio Rayon kommandierte. Hier hatte sich eine Junta festgesetzt, die ein Scheinbild einer unabhängigen Regierung organisierte und nutzlose Proklamationen in das Land sandte.
Die Sache nahm eine andere Wendung, als ein neuer Streiter für die Unabhängigkeit, der vielleicht noch suspekter war als seine Vorgänger, am Anfang seiner Laufbahn auf der durch sie eröffneten Bühne erschien, mit dem Erfolg, der die Taten jener ersten Vorkämpfer der Unabhängigkeit bald verdunkelte.
Dies war der Pfarrer von Caracuaro, den die heutigen Geschichtsschreiber den berühmten Morelos nennen.
Die mexikanischen Geschichtsschreiber geben das Datum der Geburt des Don José Maria Morelos y Paron nicht genau an. Mutmaßlich fällt es in die Zeit von 1773 bis 1775.
Das einzige Erbteil des zukünftigen Helden der mexikanischen Unabhängigkeit bestand in einigen zum Lasttragen dienenden Maultieren, die ihm sein Vater hinterlassen hatte. Als Mulitreiber hatte er sich lange mit den niedrigen und beschwerlichen Beschäftigungen genügen lassen, doch dann trat er in einen geistlichen Orden ein.
Die Ursache dieses Entschlusses hat uns die Geschichte verschwiegen. Außer Zweifel ist es, dass Morelos mit der Beharrlichkeit, die ihn charakterisierte, ans Werk ging, seinen Gedanken umzusetzen.
Er verkaufte seine Maultiere, gab sich mit großem Eifer in einem Kollegium zu Valladolid den unumgänglich notwendigen Studien hin, um den Zweck seines Ehrgeizes zu erreichen. Er eignete sich eine oberflächliche Kenntnis des Lateinischen und der Theologie an. Als er dies absolviert hatte, erteilte man ihm die Weihen und er zog sich hierauf in sein Geburtsdorf Urnapam zurück, um sein Leben kümmerlich mit einigen Unterrichtsstunden zu fristen, die er im Lateinischen gab.
Um diese Zeit war die Pfarrstelle in Caracuaro unbesetzt.
Dieses war ein armes Dorf. Niemand bewarb sich um diese Stelle und dennoch erhielt Morelos sie nicht ohne Schwierigkeiten.
In diesem Exil lebte er arm und unbekannt bis zu dem Augenblick, wo wir seine flüchtige Bekanntschaft in der Hazienda las Palmas gemacht haben.
Unter dem Vorwand, dem Bischof von Oajaca seine Aufwartung machen zu wollen, in Wahrheit aber, um die Insurrektion zu unterstützen, hatte sich Morelos in diese umfangreiche Provinz begeben und verließ sie, um bei Hidalgo die Stelle eines Feldpredigers nachzusuchen, als wir ihn von Don Mariano Silva Abschied nehmen sahen.
Über seine Aufnahme beim Pfarrer Hidalgo, die über sein ganzes Leben entschied, hat uns ein Augenzeuge Folgendes aufbewahrt:
Es war nach der Einnahme von Guanajuato, in dem Augenblick, als die Armee der Insurgenten, deren Zahl sich auf mehr als 60.000 belief, unter dem Befehl Hidalgos, der damals auf dem Gipfel seiner Macht stand, sich wie ein unaufhaltsamer Strom ergoss. Wir hatten Befehl, bis zur Nacht in Valladolid einzutreffen. Während die Armee auf dem Weg nachfolgte, erfreuten die Chefs und ihr Generalstab, zu dem auch ich damals gehörte, sich an der Gastfreundschaft eines Privatmannes des kleinen Dorfes San Miguel-Charo, ungefähr vier Meilen von Valladolid. Wir speisten gerade fröhlich zu Mittag, wie man dies in einem eroberten Land tut. Hidalgo und Allendo saßen an einer kleinen abgesonderten Tafel und unterhielten sich lebhaft während des Essens.
Unterdessen war eine Person furchtsamen Schrittes und wie erschreckt, eine so ausgewählte und zahlreiche Gesellschaft versammelt zu sehen, in den Saal getreten und näherte sich den beiden Generälen. Der Eintretende war mittelgroß und stark gebaut. Seine Hautfarbe war gelblich-braun. Dichtes verworrenes Kopfhaar bedeckte seine Stirn und ein starker Backenbart umrahmte sein Gesicht. Seine Nase war stumpf, seine Oberlippe ziemlich stark. Das Einzige, was sein Gesicht hob, waren zwei schwarze und sehr lebhafte Augen, die unter dichten, nur eine einzige Linie bildenden Augenbrauen keck hervorsahen.
Dieser Mann nun näherte sich Hidalgo und Allendo mit furchtsamem Schritt und ein wenig linkisch. Hidalgo fragte ihn barsch nach seinem Begehr. Der Ankömmling stotterte und stammelte einige Worte, aus denen hervorging, dass er um die Stelle eines Kaplans in der Armee der Insurgenten nachsuche.
»Ich werde etwas Besseres für Euch tun«, sagte der Generalissimus.
Die unverkennbare Absicht Hidalgos war, den Bittsteller von sich fernzuhalten. Er forderte ein Blatt Papier, das man ihm nur mit Mühe verschaffen konnte, schrieb einige Zeilen darauf und gab es dann dem Mann, indem er zu ihm mit einer Stimme, die durch den ganzen Saal dröhnte, sprach: »Hier ist Euer Patent als Oberst und der Auftrag, die Provinzen des Südens zu insurgieren, indem Ihr mit der Einnahme von Acapulco beginnt.«
Die südlichen Provinzen waren gerade diejenigen, die der Krone Spaniens am treusten anhingen, und Acapulco einer der besonderen Plätze des ganzen Vizekönigreichs.
Bei jenen Worten durchlief ein ironisches Gelächter den Saal, das freilich aus Achtung vor der Gegenwart des hochverehrten Chefs ziemlich gedämpft war. Der neue Oberst erbleichte aber nicht vor Zorn, sondern vor stolzer Freude. Er ging hinaus, ein Schweigen beobachtend, das immer eine Auswirkung großer Bewegungen oder heroischer Entschlüsse ist.
Der unverstandene Priester ging, um seine Mission zu erfüllen. Dieser einfache und bescheidene Mann war der Pfarrer des Dorfes Necupetaro y Caracuaro, der berühmte Morelos.
Nach dieser notwendigen Abschweifung nehmen wir den Faden unserer Erzählung wieder auf.
In den ersten Tagen des Januars 1812, fünfzehn Monate später, als der Offizier der Potentat-Dragoner, der Hauptmann Tres-Villas, die Hazienda las Palmas verlassen hatte, treffen wir zwei unserer alten Bekannten in einer ganz veränderten Situation wieder.
Der eine von ihnen saß vor einem gebrechlichen Tisch, der mit Papieren und geographischen Karten bedeckt war. Der andere stand ehrfurchtsvoll vor ihm den Militärhut in der Hand.
Die beiden Männer befanden sich unter dem am wenigsten schlechten und größten Zelt eines verschanzten Lagers, das sich in einer geringen Entfernung von Acapulco befand.
Die vor dem Tisch sitzende Person, den Kopf mit einem baumwollenen Tuch umwunden, war der General Don José Maria Morelos, den wir hier als den Befehlshaber der Insurgenten und Belagerer der Stadt Acapulco wiederfinden.
Wunderbar wird es erscheinen, wenn wir trotz der bekannten und oft unglaublichen Veränderung, die ein Bürgerkrieg in der Stellung mancher Menschen hervorruft, in der zweiten vor dem General stehenden und ziemlich gut in der Uniform eines Kavallerie-Leutnants sich ausnehmenden Person den furchtsamen Studenten der Theologie, Don Cornelio Lantejas, wiedererkennen.
Er hielt einen Brief in der Hand und schien sich in nicht geringer Verlegenheit zu befinden.
»Nun, Freund Don Cornelio, Ihr gedenkt uns zu verlassen?«, sagte der General mit einem Lächeln voll Güte, das dem gewesenen Studenten das Blut in die Wangen trieb.
»Die unerbittliche Notwendigkeit zwingt mich dazu, mein General, sonst …«
Lantejas vollendete den Satz nicht, denn er log und er schämte sich der Lüge. Nach einer Pause fuhr er fort: »Ich will es Euer Exzellenz gestehen, ich finde keinen Geschmack am Soldatenleben. Ich bin zum Priester geboren, und da nun der Erfolg Eure Waffen krönt, ist es mein Wunsch, meine Studien wieder aufzunehmen und in die Laufbahn zu treten, zu der mich meine Neigungen treiben.«
»Viva christo!«, rief Morelos. »Ihr seid ein zu tapferer Kämpfer der streitenden Kirche, als dass ich Euch entlassen könnte. Ihr würdet Euch vielleicht, wie jener brave Diener des Königs von Frankreich, dessen Namen mir entfallen ist, am Ende gar aufhängen, wenn ich Acapulco ohne Euch eroberte. Das widerspricht Eurem ganzen Naturell, ich sehe es«, fügte der General hinzu, um die enttäuschte Hoffnung des Offiziers wieder aufzurichten. »Ich verweigere es, weil ich Eurer Dienste nicht entbehren kann. Ihr seid der erste Soldat, der mir in den Wurf gekommen ist. Fühlt Ihr das ganze Gewicht der Worte, wenn ich Euch sage, dass die drei tapfersten Soldaten unserer kleinen Armee Don Hermegildo Galeana, Manuel Costal und Don Cornelio Lantejas sind? Und was Euch nun meiner Achtung und Zuneigung noch würdiger macht, ist, dass Ihr gerade den Zeitpunkt gewählt, mich zu verlassen, wo mich das Glück mit Gunstbezeugungen zu überhäufen scheint, ganz entgegengesetzt denen, die nur ihre unglücklichen Freunde verlassen. Der Hauptmann Franziska Gonzales ist in dem Gefecht bei Tehuantepec getötet worden. Ihr werdet jetzt seine Stelle einnehmen, Señor Capitano!«
Der neue Hauptmann verbeugte sich schweigend.
Er war im Begriff, das Zelt zu verlassen, als Morelos sich besann.
»Bleibt, Capitano«, sagte er. »Ich habe noch etwas mit Euch zu besprechen. Ihr erzähltet mir von Familienverbindungen, welche Ihr in Tehuantepec habt. Ich bedarf nun, um eine wichtige Mission dort auszuführen, eines Mannes von Rang und Umsicht, und ich habe daran gedacht, Euch mit derselben zu beauftragen, wenn Acapulco von uns erobert ist, was hoffentlich nicht mehr lange dauern wird.«
In dem Augenblick, als der Hauptmann aus dem Mund des Generals den Endzweck dieser vertraulichen Mission erfahren sollte, trat eine dritte Person unserer Bekanntschaft in das Zelt, der Indianer Manuel Costal. Er war von einem Unbekannten begleitet. Don Cornelio wollte sich von Neuem zurückziehen.
»Ihr geniert hier nicht und könnt alles mit anhören«, sagte Morelos zu ihm.
»Da ist der General!«, sagte Costal zu dem Fremden, der die spanische Uniform trug, und deutete auf Morelos.
Der Spanier betrachtete nicht ohne Erstaunen den so einfach gekleideten Mann, der ihm als der Insurgenten-Chef bezeichnet worden war.
»Wer seid Ihr, mein Freund? Was wollt Ihr von mir?«, fragte ihn der General.
»Darf ich offen reden?«, entgegnete der Spanier. »Dieser Mann«, er deutete auf Costal, »den ich mit sich selbst redend am Ufer traf, hat mir gesagt, dass sein Wort bei Eurer Herrlichkeit als Geleitbrief gelte, und da habe ich mich entschieden, ihm zu folgen.«
»Costal ist der erste Trompeter gewesen, der mit seiner Seemuschel, die Ihr bei ihm seht, den zwanzig Reitern, die ehemals meine Armee ausmachten, zum Auf- und Absitzen geblasen hat. Sprecht! Mein Wort bestätigt das seine.«
»Mit Erlaubnis Eurer Herrlichkeit. Ich nenne mich Pepe Gago und bin ein Galizier. Außerdem, und das ist wichtiger, bin ich der Kommandant einer Batterie in der Zitadelle von Acapulco, die Ihr gern nehmen möchtet, wenn ich mich nicht irre.«
»Das ist ein Vergnügen, welches ich mir in Kürze machen werde.«
»Eure Herrlichkeit sprechen sich da nicht richtig aus«, sagte der Artillerist, »Ihr werdet die Stadt Acapulco nehmen, wenn Ihr wollt.«
»Ich weiß es.«
»Ihr werdet Euch aber darin nicht festsetzen können, solange wir im Besitz der Zitadelle sind.«
»Ich weiß es.«
»Nun sind wir nahe daran, uns zu verstehen.«
»Deshalb will ich auch die Stadt nicht. Ich will mich des Forts bemächtigen. Verstehen wir uns immer noch?«
»Mehr als jemals zuvor, denn da es gerade das Fort ist, das Ihr nicht verschmäht, so bin ich bereit, Euch dasselbe in die Hände zu spielen. Ich will nicht sagen, zu verkaufen, da, um die Wahrheit zu gestehen, meine Forderung so mäßig sein wird, dass es ein reines Mitbringsel ist, und – da fällt mir gerade ein, Eure Herrlichkeit sind doch bei Kasse?«
»Ihr sollt etwas erfahren. Ich will Euch nur erzählen, dass ich, außer siebenhundert Flinten und fünf Kanonen, der achthundert Gefangenen, die ich gemacht habe, gar nicht zu gedenken, dem spanischen Kommandanten Paris die Summe von zehntausend Piastern abgenommen habe, und das ist zehnmal mehr wie der Preis einer Zitadelle, die ich bald umsonst haben werde.«
»Zählt nicht zu gewiss darauf. Wir haben immer Überfluss an Lebensmitteln. Die Insel la Roqueta …«
»Die werde ich zuerst nehmen.«
»Sie dient uns als Hafen zur Ausschiffung unseres Proviants, der uns per Schiff zugeführt wird. Um aber endlich zur Sache zu kommen: Eure Herrlichkeit haben selbst den Preis auf tausend Piaster festgesetzt. Habt Ihr nicht gesagt, dass Ihr zehntausend Piaster erbeutet habt und dass dies zehnmal der Preis der Zitadelle sei? Unglücklicherweise kann ich nicht die Ehre haben, sie Euch mehr als einmal zu verkaufen.«
»Tausend Piaster in bar?«, fragte der General stirnrunzelnd.
»Nein. Welches Pfand hättet Ihr für mein Wort? Ich denke, dass Ihr mir dreihundert Piaster gleich und siebenhundert nach der Übergabe zahlt.«
»Eingewilligt. Und mit welchen Mitteln wollt Ihr den Fall der Zitadelle ermöglichen?«
»Morgen früh zwischen drei und fünf Uhr habe ich die Wache am Tor. Eine Stocklaterne auf der Brücke Hornos, dem Fort gegenüber, um mich zu benachrichtigen, dann ein Losungswort und Eure persönliche Gegenwart. Ich vermute, dass Eure Herrlichkeit niemandem gern die Ehre, sich des Forts zu bemächtigen, wird abtreten wollen.«
»Ich werde in Person dort sein«, entgegnete Morelos. »Was das Losungswort betrifft, hier ist es!«
Der General überreichte dem Spanier ein Papier, auf dem zwei Worte geschrieben standen, die weder Costal noch Cornelio lesen konnten.
Dann wollte sich Pepe Gago nach der langen, mit leiser Stimme geführten Unterredung zurückziehen, doch Costal schritt auf ihn zu und legte ihm seine Hand auf die Schulter, sagte mit lauter nachdrücklicher Stimme: »Hört, Pepe Gago! Ich habe für Euch gebürgt. Ich schwöre bei der Seele der Kaziken von Tehuantepec, von denen abzustammen ich die unbestrittene Ehre habe, dass Ihr, wenn Ihr uns verraten solltet, meinem Karabiner oder meinem Messer nicht entgeht, und flüchtet Ihr Euch auch wie der Hai auf den Grund des Meeres oder wie der Jaguar in das Herz des Waldes. Bewahrt Euch das in Eurem Gedächtnis.«
Der Artillerist beteuerte seine Aufrichtigkeit und entfernte sich.
Als er das Zelt verlassen hatte, fuhr Morelos, zu Don Cornelio gewendet fort: »Ich will zusehen, ob ich Euch von der Festung Acapulco auf einen Urlaub ausstellen kann, aber nur auf einige Tage. Dort werden wir auch wieder von der Mission sprechen, zu deren Ausführung ich auf Euch rechne. Geht jetzt und ruht Euch aus. In der nächsten Nacht, um vier Uhr morgens, werde ich selbst ein Sonderkommando unserer Armee zum Fort führen. Da ich es für gut halte, dass niemand als wir etwas von unserem Übereinkommen mit Gago erfahren, so könnt Ihr und Costal die Stocklaterne, deren Licht das verabredete Zeichen der Ankunft unserer Truppen ist, auf der Brücke aufpflanzen.«
Das Schloss Acapulco liegt am Ufer des Meeres, einige Schritte vor der Stadt. Tiefe Abgründe, an deren Fuß man den Ozean tosen hört, umgeben die Festung. Der eine dieser Abgründe zur Rechten der Zitadelle heißt der Schlund los Hornos. Eine schmale Brücke verbindet die Ränder der beiden Felsen.
Am frühen Morgen, während im Lager noch Verwirrung herrschte, das so unvorhergesehen durch den Befehl des Generals alarmiert worden war und ein starker Sondertrupp zu den Waffen griff, ohne dass die Soldaten, aus denen es bestand, wussten, wohin man sie führt, begaben sich Don Cornelio und der Indianer auf den Weg zum Meer.
Noch waren es zwei Stunden bis zum Sonnenaufgang und dies war mehr Zeit, als man zur Ausführung des schon im Voraus verabredeten Handstreichs zu bedürfen glaubte.
Die Nacht war sehr düster. Stadt und Festung schienen im tiefen Schlaf zu liegen, wie man aus dem Schweigen, welches es sogar ermöglichte, von Weitem das dumpfe Rollen des Meeres zu hören.
Die beiden Männer schlichen mit Vorsicht an den geschwärzten Mauern des Forts entlang. Nach einem Marsch von einer Viertelstunde fingen sie an, die Klippen zu erklimmen und sich von der Küste zu entfernen.
Costal ging voran, Lantejas folgte ihm auf dem Fuß. Nur mit großer Strapaze, des steten Risikos ausgesetzt, von den Wänden der Abhänge in die Tiefe zu stürzen, erreichten beide endlich die Brücke.
Costal schlug Feuer und zündete eine kleine Pechfackel an, die er in der mitgebrachten Stocklaterne verbarg.
Sobald dies geschehen war, betraten die beiden Männer vorsichtig die Brücke und banden die Stocklaterne an einen Pfahl, welcher sich in der Mitte derselben befand. Costal kehrte die Lichtseite der Laterne dem Fort zu und folgte dann seinem Gefährten, der schnellen Schrittes die Brücke verließ.
Wie schon erwähnt, war das Aufleuchten der Laterne auf der Brücke das verabredete Zeichen für den Beginn des Überfalls auf die Festung. Costal und Lantejas hatten ihren Auftrag erfüllt und erwarteten mit sichtlicher Anspannung die Folgen ihres Werkes.
Von der Höhe, wo sie sich befanden, bot sich ihnen eine weite Aussicht über das Fort, die Stadt und den Ozean. Alles war, mit Ausnahme des Meeres, in Schweigen gehüllt. Unwillkürlich ließ Lantejas seinen Blick über das Meer schweifen und Costal tat ein gleiches.
»Es steckt ein Gewitter in der Luft«, sagte der Indianer mit leiser Stimme, denn die Feierlichkeit des Schauspiels schien es ihm nicht zu erlauben, laut zu sprechen. »Seht Ihr die Haifische auf der Oberfläche in einem phosphoreszierenden Prunk schwimmen?«
Tatsächlich schweiften eine Unzahl dieser gefräßigen Tiere, Beute suchend wie Piraten umher, feurige Kreise beschreibend, ähnlich denen der Feuerfliege in den Gräsern der Savanne.
»Welches Schicksal glaubt Ihr wohl«, fragte der Zapoteke, »würde den treffen, der mitten unter diese schweigenden Schwimmer fiele? Wie viel Mal habe ich als Perlenfischer dieser Gefahr getrotzt, indem ich in ihrem Beisein untergetaucht bin!«
Don Cornelio antwortete nicht. Dieser Gedanke ließ ihn vor Schrecken erschaudern.
Der Indianer fuhr fort: »Dies geschah, als ich noch jung war, ohne das die Haifische, so wenig wie die Tiger, die ich später im Einsatz erlegte, etwas über den vermochten, der das Alter des Raben leben soll. Bald habe ich nun ein halbes Jahrhundert gelebt, und ich allein würde vielleicht in dieser Stunde unter diese fleischgierigen Ungeheuer tauchen können, ohne die geringste Gefahr zu laufen.«
»Ist dies das Mysterium Eurer Unerschrockenheit, die sich niemals verleugnet?«
»Ja und nein! Das Risiko hat einen gewissen Reiz für mich, wie Euer Körper diese Haie anziehen würde. Das ist eine Anfälligkeit, der ich nachgehen muss, und keine Prahlerei. Damit ist es aber noch nicht genug, ich suche im Blut der Spanier die Mörder meiner Väter zu vernichten. Was kümmert eigentlich mich die politische Gleichstellung, der Punkt Eurer Wünsche? Aber von alledem will ich zu Euch nicht sprechen, obgleich es sich darauf bezieht – vor allem seht einmal unter Euch.«
Ein fremdartiges Detail stellte sich den Blicken Lantejas dar und entriss ihm eine Regung abergläubischen Schreckens.
Costal sah ihn an und lächelte. Ein schwarzer Körper, dessen Kopf eine Art Haar bedeckte, stieg halb aus dem Wasser und schien auf das flache Ufer zwei Menschenarme zu stützen. Einen Augenblick glaubte Lantejas eine Badende zu erblicken, die wieder aus dem Meer stieg.
»Was ist das für eine seltsame Gattung?«, fragte er Costal mit einem gewissen unheimlichen Gefühl, als er ein schmerzliches Lamentieren dem Maul dieses Wesens entschlüpfen hörte, dessen Physis er sich nicht erklären konnte, denn wenn auch die Form seines Körpers der eines Weibes, glich, so hatte die Stimme nichts Menschliches.
»Das ist eine Seejungfer, die Euch so erschreckt. Ihr würdet wohl nicht imstande sein, den Anblick eines noch seltsameren, vollkommenen Wesens, vollkommener noch als das schönste menschliche, zu ertragen?«
»Was wollt Ihr damit sagen?«
»Señor Capitano Don Cornelio«, erwiderte der Indianer, »Ihr, der Ihr im Angesicht der Feinde so tapfer seid …«
»Hm!«, unterbrach ihn Lantejas, »auch der Tapfersten, seht Ihr …«
Fast wäre ihm das Geständnis seiner Zaghaftigkeit entschlüpft.
Costal ließ ihm dazu keine Zeit.
»Ja, ja, Ihr seid wie Clara, obgleich bedeutend mutiger als er. Ihr habt nur Zeit nötig, um auch mit den Tigern vertraut zu werden. Wenn aber da unten statt dieser Seejungfer auf dem flachen Ufer ein herrliches Geschöpf, ein gelocktes, singendes Weibsbild sich befände, und wenn diese Evastochter, obgleich Eurem Auge sichtbar, nichts als ein ungreifbarer Geist wäre, was würdet Ihr dann tun?«
»Etwas sehr Einfaches, ich würde entsetzlichen Bammel haben«, sagte Cornelio treuherzig.
»Nun habe ich Euch nichts mehr zu sagen. Ich suchte für ein Vorhaben einen mutigeren Gefährten als Clara ist, jetzt werde ich mit dem Farbigen zufrieden sein müssen. Ich hoffte, dass Ihr – sprechen wir nicht mehr davon.«
Der Indianer fügte kein Wort mehr hinzu, und auch der Offizier schwieg unter dem Einfluss des Schreckens, den die halbe Vertraulichkeit Costals hervorgerufen hatte. Beide blickten nun wieder in Erwartung, die Zitadelle bald genommen zu sehen, still in den unermesslichen und sagenumwobenen Ozean hinaus, dessen Monotonie allein durch die Anwesenheit des Meerweibchens belebt wurde.
Schreibe einen Kommentar