Der Schwur – Erster Teil – Kapitel 8
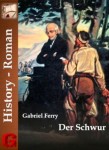 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Erster Teil
Der Dragoner der Königin
Kapitel 8
Die Schreckensbotschaft
Don Mariano, Don Rafael und die beiden Schwestern stürzten, von finsterer Ahnung getrieben, aus dem Saal.
Vom Hof der Hazienda aus, wo sich die Dienerschaft des Hauses bereits zusammengefunden hatte, konnte man ohne Hindernis die Gipfel der Berge erblicken, auf denen sich ein schrecklicher Anblick darbot.
An der höchst gelegenen Stelle des Fußsteigs, der von der Hazienda las Palmas zu der Hazienda del Valle führte, lagen ein Reiter und sein Pferd, beide dem Anschein nach tödlich verwundet beieinander. Der Mann machte noch schwache, wie wohl vergebliche Versuche, sich zu erheben, das Pferd dagegen blieb völlig regungslos.
»Schnell!«, rief Don Mariano. »Holt eine Sänfte herbei. Wir wollen den Unglücklichen hierher schaffen.«
»Wenn mich meine Augen nicht täuschen«, sagte der Offizier, dessen bleiches Gesicht eine tiefe Unruhe verriet, »so scheint mir der arme Verwundete der alte Rodriguez, der älteste Diener meines Vaters, zu sein.«
Tatsächlich war das Haupt des Verwundeten mit grauem Haar bedeckt.
»Der Name Antonio Valdes«, fuhr Don Rafael fort, »ruft mir, ich weiß nicht welche alte Geschichte wieder in das Gedächtnis, dass diesem Mann einst eine Strafe auferlegt wurde. Ein trübes Vorgefühl mischt sich bei mir in diese dunkle Erinnerung. In Bürgerkriegen sind immer so viele grausige Szenen, die jedem Gefühl der Menschlichkeit widerstreben, an der Tagesordnung gewesen. Ach, Señor Don Mariano«, fügte er, diesem die Hand reichend, hinzu, »musste denn so viel Glück …«
Don Rafael wagte nicht zu enden. Von der Ungeduld verzehrt, die immer dem Unglück vorausgeht, wandte er sich kurz von Don Mariano und seinen Töchtern ab und eilte einer Tür zu, die auf den Fußsteig zu den Bergen führte, welchen er in fliegender Hast zurücklegte, den Leuten der Hazienda voran, die mit einer Sänfte folgten.
Don Rafael hatte keinen Augenblick daran gezweifelt, dass der Verwundete der alte Rodriguez sei, und er erhielt die völlige Gewissheit davon, noch ehe er bei demselben angekommen war.
Er fand den Unglücklichen, den der Blutverlust inzwischen vollends erschöpft hatte, besinnungslos auf der Erde liegen.
Gleich darauf kamen auch die Leute Don Marianos mit der Sänfte herbei. Sie wollten den Verwundeten sofort aufheben und in die Sänfte schaffen, aber Don Rafael hinderte sie daran.
»Wartet einen Augenblick«, sagte er. »Der alte Mann würde ohne Verband schwerlich die Anstrengungen des Weges ertragen können. Sein Blut strömt unaufhaltsam aus dieser schweren Wunde.«
Don Rafael hatte sich seine Sporen in den blutigen Kämpfen mit den wilden Indianern des Nordens und Westens verdient. Er hatte den Soldatentod in allen Gestalten und die gefährlichsten Verwundungen gesehen. Seine Erfahrungen machten es ihm möglich, einem Verwundeten die Erste Hilfe zu reichen.
Er stopfte zuerst die Öffnung der Wunde mit seinem Taschentuch zu und das Blut hörte auf zu strömen, als er sie mit seiner Schärpe fest verbunden hatte. Es lag aber klar zutage, dass ungeachtet dieser angewendeten Sorgfalt der Verwundete auf dem Weg zu der Hazienda leicht sein Leben aushauchen konnte. Darum stellte der junge Offizier Versuche an, ihn ins Bewusstsein zurückzuholen.
Ohne Zweifel war der Mann der Überbringer einer Botschaft, und mochte diese nun von einer Art sein, wie sie wollte, so war es jedenfalls für Don Rafael von der allerhöchsten Wichtigkeit, dieselbe kennenzulernen.
Daher setzte er seine Wiederbelebungsversuche eifrig fort, die anfangs keinen Erfolg haben zu schienen. Es verging eine geraume Zeit, ohne dass der Verwundete das geringste Lebenszeichen von sich gab. Endlich rieb ihm einer der Leute der Hazienda, welcher eine mit Branntwein gefüllte Kürbisflasche bei sich trug, leicht die Schläfe ein und begann dann, ihm einige Tropfen davon in den Mund zu flößen.
Dieses Mittel wirkte. Der Verwundete bewegte sich leise und öffnete kurz die Augen, um sie jedoch sogleich wieder zu schließen. Don Rafael beugte sich über ihn und rief seinen Namen.
Bei dem Klang dieser Stimme schlug der treue Diener von Neuem die Augen auf und erkannte seinen jungen Herrn, dem er die Hände entgegenstrecken versuchte, während sein Gesicht sich verklärte.
»Rodriguez«, flüsterte Don Rafael, »sprich, wenn du noch Kraft hast. Was ist vorgefallen?«
»Gelobt sei Gott, der Euch auf meinen Weg gesendet hat!«, sagte Rodriguez mit schwacher Stimme. »Die Hazienda del Valle …«
»Ist niedergebrannt?«
Der Verwundete machte ein verneinendes Zeichen.
»Ist belagert?«
»Ja«, sagte Rodriguez.
»Und mein Vater?«, fragte der junge Offizier mit klopfendem Herzen.
»Er lebt … er hat mich zu Don Mariano geschickt … Hilfe zu holen. Ich wurde von den Insurgenten verfolgt … eine Kugel … eilt … wenn ein Unglück passiert … es ist Antonio Valdes … hört Ihr … Antonio Valdes, der sich rächt! … Lebt wohl! … Ihr werdet Messen lesen lassen … für den alten Rodriguez, der Euch gesehen hat … ganz klein …«
Der alte Mann schwieg und fiel erschöpft zurück, um sich nicht wieder zu erholen. Als man in der Hazienda ankam, hob man einen schon kalten Leichnam aus der Sänfte.
»Ach, wenn Costal hier wäre!«, rief Don Mariano, als Don Rafael, der den Befehl gab, schleunig sein Pferd zu satteln, ihm die traurige Nachricht mitgeteilt hatte. »Er kam diesen Morgen mit Clara, einem Schwarzen, aus dem ich mir nichts mache, um Abschied zu nehmen und seine Funktion als Tigerjäger niederzulegen. Sie wollen beide dem Priester Hidalgo ihre Dienste als Kundschafter anbieten. Holla«, fuhr der Besitzer der Hazienda fort, »ruft mir den Haushofmeister.«
Einige Minuten später erschien der Haushofmeister.
Man würde sich täuschen, wenn man sich unter diesem Haushofmeister einen Mann mit weißer Krawatte, gepuderter Perücke und einem Stöcklein in der Hand vorstellte. Der Mann, der mit der Überwachung einer Hazienda beauftragt ist, die zuweilen die Größe einer unserer Provinzen erreicht, muss ein unermüdlicher Reiter sein, der stets im Sattel sitzt oder doch zu jeder Zeit bereit ist, sich in denselben zu schwingen.
Der Haushofmeister stieg gerade in dem Augenblick vom Pferd, als Don Mariano ihn rufen ließ. Es war ein munterer Bursche, mit sonnengebräuntem Gesicht, langen Reiterstiefeln und gewaltigen Sporen. Sein ungeordnetes Haar fiel in langen schwarzen Zöpfen auf seinen Hals, ähnlich der Mähne der halbwilden Pferde, die er täglich bestieg.
»Gib zwei meiner Hirten, dem Bocadro und Arroyo, den Befehl, augenblicklich ihre Pferde zu satteln, um den Señor Don Rafael zu begleiten.«
»Seit acht Tagen habe ich weder Arroyo noch Bocardo gesehen«, erwiderte der Haushofmeister.
»Du wirst jedem von ihnen bei ihrer Rückkehr auf vier Stunden Fesseln anlegen.«
»Ich bezweifle, dass sie überhaupt je wiederkommen werden, Señor Don Mariano.«
»Sind sie zu Valdes gestoßen?«
»Ich argwöhne«, antwortete der Haushofmeister, »dass diese beiden Taugenichtse, aus denen Ihr Euch aber keinen Pfifferling zu machen braucht, auf eigene Faust Guerillas oder vielmehr Strauchdiebe geworden sind. Was dagegen Sancho betrifft, so wissen Euer Herrlichkeit, dass er infolge des gefährlichen Sturzes noch krank im Bett liegt, als das wilde Pferd, welches er zum ersten Mal bestieg, sich mit ihm überschlug.«
Don Mariano wandte sich zu dem jungen Offizier und sagte bekümmert: »Auf diese Weise kann ich Euch von den sechs Dienern, die ich gestern besaß, nur noch den Haushofmeister zur Verfügung stellen, denn ich rede nicht von diesen indianischen Tieren.«
»Mag auch er bleiben«, sagte der Offizier. »Ich halte es für besser, meinem Vater allein zu Hilfe zu eilen. Er soll ja schon so viele Kämpfer haben. Vielleicht fehlt denen ein Anführer.«
Der Haushofmeister wurde mit dieser Antwort verabschiedet.
Während man nun in aller Eile das Pferd des Hauptmanns sattelte, hatten sich die beiden Schwestern in das Zimmer zurückgezogen, wo wir sie im Anfang gesehen haben.
Ihr gegen Don Rafael gegebenes Versprechen hatte die junge Kreolin soeben selbst das fromme, aber auch schmerzliche Gelübde erfüllt. Ihre schönen Flechten waren unter der Schärfe der Schere gefallen. Sie tröstete Marianita, deren Augen in Tränen schwammen, während die ihren vor Befriedigung glänzten.
»Weine nicht, meine arme Marianita«, sagte sie. »Hätte ich nicht die strafbare Schwäche gehabt, die Erfüllung meines Gelübdes aufzuschieben, wer weiß, ob ihm dann dieses Unglück zugestoßen wäre. Nun bin ich über sein Schicksal ruhig. In welche Gefahr er sich auch stürzt, Gott wird ihn mir gesund und frisch wiedergeben. Geh und sage ihm, dass ich ihn hier erwarte, um ihm Lebewohl zu sagen. Bringe ihn mit, bleibe dann aber bei uns, hörst du, bleibe dann bei uns! Denn ich misstraue meiner Schwäche, ich würde ihn nicht abreisen lassen. Geh, trockne deine Augen und komm bald zurück.«
Marianita versuchte zu lächeln, führte ihr Taschentuch an die feuchten Augen und ging.
Als Gertrudis allein war, warf sie einen schmerzlichen Blick auf ihre beiden Haarflechten, die auf dem Tisch lagen und mit denen sie nun nicht mehr den Nacken des Geliebten um winden konnte. Sie hatten ihn wenigstens einmal gefesselt, seine Lippen hatten auf ihnen geruht, und von der Erinnerung tief ergriffen, beugte sich Gertrudis über die beiden Liebesreliquien, um sie zärtlich zu küssen. Dann kniete sie nieder und suchte im Gebet die Stärke wieder zu gewinnen, die ihr zu mangeln anfing.
Das junge Mädchen betete noch, als Marianita und hinter ihr Don Rafael in das Heiligtum der beiden Jungfrauen traten, wohin mit Ausnahme ihres Vaters nie der Fuß eines Mannes gedrungen war.
Ein flüchtiger Blick überzeugte Don Rafael, dass das schmerzliche Opfer schon dargebracht worden war.
Gertrudis erhob sich und setzte sich auf einen Sessel, was auch Marianita tat, während Don Rafael unbeweglich stehen blieb.
»Kommen Sie hierher, nahe zu mir, Don Rafael«, sagte Gertrudis. »Knien Sie vor mir nieder, nein, nur auf ein Knie, denn man wirft sich nur vor Gott auf beide Knie … Schön! Legen Sie nun Ihre Hände in die meinen und blicken Sie mich fest an.«
Don Rafael gehorchte willig ihren Befehlen.
»Erinnern Sie sich noch der Worte, die Sie vor Kurzem zu mir sprachen, Rafael? Sie sagten: ›O, Gertrudis! Selbst die Liebe kann ein solches Opfer nicht bezahlen, und so schön sie auch sein mag, heute ist das junge Mädchen in den Augen ihres Geliebten schöner, als ein Erzengel.‹ Denken Sie immer … Gut!« fuhr sie mit einem anbetungswürdigen Lächeln fort, indem je ihre Hand an die Lippen Don Rafaels legte. »Lassen Sie mich fortfahren. Ihre Augen – was für schöne Augen Sie haben, mein Rafael – sagen es mir genug, dass Sie immer daran denken werden, und es bedarf nicht der Bestätigung durch Worte.«
Auf diese Weise ihrer Furcht, nach dem Verlust ihrer Flechten in den Augen des Geliebten weniger schön zu erscheinen, überhoben, fuhr sie fort: »Sagen Sie mir nicht, dass Sie mich noch mehr lieben, Rafael. Es ist mir angenehm zu glauben, dass Ihre Liebe keiner Steigerung mehr fähig sei. Dennoch …« Gertrudis Stimme zitterte und ihre Augen wurden feucht. »Dennoch müssen wir uns trennen. Ich weiß nicht – wenn man liebt, fürchtet man immer – nehmen Sie eine dieser Flechten, sie wird Sie erinnern, was sich auch ereignen möge, dass Sie nie aufhören dürfen, ein armes Mädchen zu lieben, deren Zärtlichkeit nichts Kostbareres zur Sühne für Ihr Leben hat auffinden können. Ich werde die andere Flechte wie einen Talisman tragen. Und was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist schrecklich. Sollten Sie je aufhören, mich zu lieben, wenn mir es sonnenklar geworden ist, so schwören Sie mir auf Ihre Ehre, dass Sie, in welcher Lage Sie sich auch befinden mögen, dem geheimnisvollen Boten, der Ihnen diese Flechte überreichen wird, in allen Stücken gehorchen wollen. Diese Botschaft soll dann anzeigen: Die Frau, die Ihnen dieses Pfand sendet, hat erfahren, dass Sie ihre Liebe nicht mehr teilen, sie hat aber trotz aller Anstrengungen nicht vermocht, die ihre aus dem Herzen zu reißen, und sie wünscht, Sie noch einmal zu ihren Füßen zu sehen, wie heute.«
»Ich schwöre!«, rief Don Rafael. »Sollte ich auch in dem Augenblick den Dolch auf meinen tödlichen Feind gezückt halten, ich werde mich, ohne zuzustoßen, von ihm abwenden und Ihrem Boten folgen.«
»Der Himmel hat Ihren Eid vernommen!«, rief Gertrudis. »Jetzt drängt die Zeit. Nehmen Sie noch diese Schärpe, die ich für Sie gestickt habe. Jedes Seidenfädchen, das dazu verwendet ist, möge Ihnen einen Gedanken, ein Gebet oder einen Seufzer, dessen Gegenstand Sie gewesen sind, zurückrufen. Nun, auf Lebewohl, mein geliebter Rafael! Reisen Sie ab. Vielleicht sind die Stunden Ihres Vaters schon gezählt. Was gilt eine Geliebte gegen einen Vater?«
»Ja, ich muss aufbrechen«, erwiderte der Offizier.
Dennoch aber blieb er unverändert vor Gertrudis auf den Knien.
Die Zeit verstrich. Wie im Ozean Welle auf Welle rollt, so folgte hier Abschied auf Abschied und Don Rafael ging nicht.
»Sage du ihn, Marianita, dass er sich aufmache«, sagte Gertrudis endlich. »Du siehst, dass mir die Kraft dazu fehlt.«
Don Rafael erhob sich nach einem letzten Lebewohl.
»Drückt Eure Lippen auf die Eurer Braut«, flüsterte Gertrudis, ihren Kopf zu Rafael nieder beugend. »Möge dies das Pfand sein …«
Unter dem glühenden Druck der Lippen des jungen Offiziers erstarb ihre Stimme und halb ohnmächtig lehnte sie ihren Kopf gegen die Lehne des Sessels zurück, denn Schmerz und Glück drangen in diesem Augenblick gleich mächtig auf sie ein.
Als sie wieder zu sich kam, war Don Rafael verschwunden.
Schon vergoldeten die letzten Strahlen der Sonne die Gipfel der Hügel, als Don Rafael über sie fortjagte. In der Ebene angekommen, hoffte er, das Geschrei der Kämpfenden zu hören, aber tiefes Stillschweigen, tödliche Ruhe herrschte im Tal.
Der Offizier setzte seinen Weg mit düsterer Stirn und laut pochendem Herzen fort, die geladene Flinte in der Hand.
Aber noch immer war dieselbe Stille rings um ihn. Kein Schrei ertönte in der Einsamkeit, nirgends durchdrang das Aufblitzen eines Gewehres die Dämmerung. Alles schien den Schlaf des Todes zu schlafen.
Don Rafael war nie in die väterliche Wohnung gekommen. Einen Augenblick hoffte er, sich verirrt zu haben, obwohl die Umgebung dieselbe war, die man ihm beschrieben hatte: eine mit Eschen bepflanzte Allee und am Ende die Hazienda del Valle.
Ein umfassendes Gebäude erhob sich vor ihm, aber wüst und schweigend wie ein Grab.
Das Tor desselben war halb geöffnet.
Plötzlich machte das Pferd einen Seitensprung.
In der Finsternis oder vielmehr in seiner Verwirrung hatte der Offizier den Gegenstand, vor dem sein Pferd scheute, nicht bemerkt.
Es war ein Leichnam, dem der Kopf fehlte.
Bei diesem entsetzlichen Anblick stieß der Offizier einen Schrei aus, auf den allein das Echo antwortete.
Er kam zu spät, alles war vollendet.
Der Kopf des Leichnams war an den Haaren an einen Türpfosten gehängt. Die Züge desselben waren so wenig entstellt, dass Don Rafael leicht in ihnen die seines Vaters wiedererkannte.
Es war leider nur zu wahr! Der Spanier war das Opfer der Aufrührer geworden, die keine Achtung vor seinem verteidigungslosen Alter gehabt hatten. Die Urheber dieser Gräueltat rühmten sich sogar noch derselben. Unter dem Kopf standen die Namen geschrieben:
Arroyo – Antonio Valdes
In Nachdenken versunken, hatte der Offizier den Kopf auf die Brust geneigt. Dann aber rief er laut, gleichsam als Antwort auf seine geheimen Gedanken: »Wo soll ich sie aber finden, wie in meine Gewalt bekommen, diese beiden Köpfe, die ich hier anzunageln habe?«
»Indem du für Spanien mit Leib und Seele einstehst«, antwortete ihm jene Stimme, die so oft aus tiefster Brust zum Menschen spricht.
»Es lebe Spanien!«, rief der junge Offizier mit donnernder Stimme. Ein Sohn kann nicht unter demselben Banner kämpfen wie die Mörder seines Vaters.
Hierauf stieg er vom Pferd und kniete andächtig nieder.
»Verehrungswürdiges, teures Haupt«, sprach er, »ich schwöre bei deinem weißen, mit blutbesudeltem Haar, alle meine Kräfte aufzubieten, um diese gebrandmarkte Insurrektion, deren erster Schritt dich das Leben gekostet hat, mithilfe des Eisens und Feuers noch in der Wiege zu ersticken. Gott stehe mir bei!«
Don Rafael erhob sich und er erinnerte sich in diesem Augenblick der Worte seiner Geliebten: Mögen alle diejenigen, welche ihren Arm zugunsten Spaniens erheben, der Schande und Schmach anheimgegeben sein. Mögen sie nie ein Dach finden, das sie aufnimmt, nie ein Weib, das ihnen zulächelt. Die Verachtung aller derer, die sie lieben, mag das Erbteil der Landesverräter sein.
Aber angesichts des verstümmelten Leichnams seines Vaters schwankte der junge Offizier nicht in seinem Entschluss. Das Gefühl der Pflicht besiegte alle anderen Empfindungen, die in seiner Brust auftauchten. Er folgte willig der inneren Stimme, die ihm zuflüsterte: »Tue, was du musst, mag geschehen, was da wolle!«
Der Mond stand schon hoch am Himmel, als Don Rafael die peinliche Aufgabe vollendet hatte, ein Grab für seinen ermordeten Vater zu graben.
Ehrfurchtsvoll hob er den toten Körper auf und trug ihn in die Gruft. Dann löste er den Kopf vom Pfosten und legte ihn an die Stelle, die er im Leben am Rumpf eingenommen hatte. Nachdem dies geschehen war, zog Don Rafael unter seinem Hemd die lange Haarflechte der Geliebten hervor, nahm die von ihren Händen gestickte weiße Schärpe von seinen Schultern und legte diese Pfänden seiner Liebe nicht weniger ehrfurchtsvoll neben die teuren Überreste seines Vaters.
Dann warf er mit konvulsivisch zuckenden Händen die ausgegrabene Erde wieder in die Grube.
Er begrub in derselben seine teuersten Hoffnungen.
Nach wenigen Minuten bestieg er sein Pferd und sprengte in die Richtung nach Oajaca.
Schreibe einen Kommentar